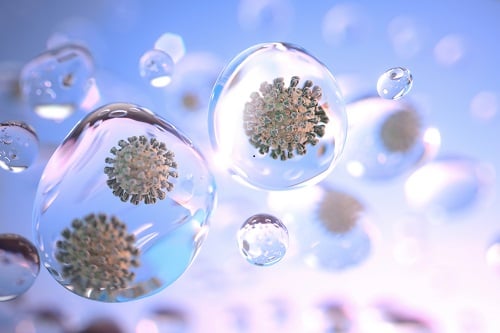Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (§27b SGB V) hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) seine Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren [1] auf die elektive Schulterarthroskopie ausgeweitet.
In der Versorgungsrealität wird das Recht auf die Einholung einer Zweitmeinung schon immer und in den letzten Jahren zunehmend von Patientinnen und Patienten in Anspruch genommen. Nicht immer legen sie dabei den Anlass für einen weiteren Arztbesuch offen. Oft wird dieser erst deutlich, wenn nach früheren Untersuchungen und Befunden gefragt wird. Gefühlt nimmt diese extensive Inanspruchnahme gerade fachärztlicher Leistungen permanent zu, ohne dass darüber verlässliche Zahlen vorliegen. Der unbeschränkte Einsatz der Versichertenkarte könnte nur durch die Krankenkassen kontrolliert und reguliert werden, was jedoch offensichtlich nicht erfolgt. Andererseits propagieren einzelne Krankenkassen über die gesetzlich festgelegten Indikationen hinaus weitere eigene Zweitmeinungsverfahren, z. B. vor Wirbelsäulen-Operationen.
Neu in der G-BA-Richtlinie ist die gesetzliche Verankerung des Rechts auf die Einholung einer Zweitmeinung jetzt auch vor geplanten Schulter-Arthroskopien. So sehr dies aus Patientensicht nachvollziehbar ist, so sehr wird berechtigter Weise von der Fachärzteschaft kritisiert, dass damit auch der Generalverdacht einer nicht sachgerechten Indikationsstellung für diese Operation verbunden ist.
Auswirkungen auf den indikationsstellenden Facharzt („Erstmeiner“)
Die Richtlinie des G-BA schreibt verbindlich vor, dass der indikationsstellende Arzt die Patientinnen und Patienten auf ihr gesetzliches Recht auf die Einholung einer Zweitmeinung hinweisen muss. Darüber hinaus soll auf das entsprechende Merkblatt des G-BA [2] verwiesen werden. Der BDC empfiehlt dringend, die erfolgte Information schriftlich zu dokumentieren, z. B. als Ergänzung in der schriftlichen Operationseinwilligung.
Zu beachten ist die Frist von mindestens 10 Tagen vor der Operation, die eine entsprechende Bedenkzeit und eine Frist zur Suche eines Zweitmeiners einräumen soll. Der Anspruch auf Zweitmeinung umfasst sämtliche arthroskopischen Operationen an der Schulter, auch Rupturen der Rotatorenmanschette.
Sofern von Patientenseite eine Zweitmeinung gewünscht wird, ist der Erstmeiner verpflichtet, die relevanten medizinischen Unterlagen zusammenzustellen und auszuhändigen. Dafür kann er eine Aufwandspauschale nach EBM 01645 (75 Punkte, z. Zt. 8,24 €) abrechnen. Der Erstmeiner braucht keine potenziell geeigneten Zweitmeiner zu benennen, kann aber die Patientinnen und Patienten auf die Internet-Quellen hinweisen. Der im G-BA Merkblatt aufgeführte Link auf die KBV-Homepage führt zurzeit für die Schulter-ASK noch ins Leere (Stand 16.06.2020): https://www.116117.de/de/zweitmeinung.php
Dagegen findet man zum Beispiel über die Homepage der KV Niedersachsen den Verweis auf insgesamt 9 zugelassene Zweitmeiner in Niedersachsen (Stand: 16.06.2020): https://www.kvn.de/internet_media/Patienten/Arztsuche/Zweitmeinungsverfahren_+Schulterarthroskopien-p-23562.pdf
Auswirkungen auf den „Zweitmeiner“
Die Zulassung als „Zweitmeiner“ muss bei der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung beantragt werden. Sofern keine Vertragsarzt-Zulassung oder Ermächtigung vorliegt, wird der Zweitmeiner ausdrücklich nur für diese Leistung für vertragsärztliche Leistungen ermächtigt. Voraussetzung ist eine Facharztqualifikation in Orthopädie und Unfallchirurgie oder Orthopädie oder Chirurgie mit Schwerpunkt/Teilgebiet Unfallchirurgie oder Physikalische Medizin und Rehabilitation. Darüber hinaus werden mindestens 5 Jahre Erfahrung in der unmittelbaren Patientenversorgung im Fachgebiet und „Kenntnisse über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung“ vorausgesetzt. Beurteilungskriterien dafür sind entweder die Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung (!) oder eine Weiterbildungsbefugnis oder eine akademische Lehrbefugnis. Eigene praktische Erfahrungen mit der zu beurteilenden Operationsmethode werden nicht explizit gefordert.
Die Beurteilung der Op.-Indikation soll gemäß der G-BA Richtlinie in der Regel lediglich auf der Grundlage einer Anamneseerhebung und auf der Durchsicht der beim Erstmeiner erhobenen und zur Verfügung gestellten Befunde erfolgen. Es erscheint weltfremd, dass dabei keine körperliche Schulteruntersuchung durchgeführt wird. Gemäß der Richtlinie ist ein persönliches Beratungsgespräch erforderlich. Telefonische Beratungen oder Internet-basierte Verfahren sind nicht vorgesehen. Somit findet regelmäßig ein persönlicher Kontakt beim Zweitmeiner statt und dieser dürfte kaum auf die Gelegenheit verzichten, zur Beurteilung eine eigene orientierende Schulteruntersuchung durchzuführen.
Für die genannten Leistungen kann der zugelassene Zweitmeiner lediglich die Grundpauschale seines Fachgebietes abrechnen. (Für das Kapitel 18 des EBM also zwischen 20,00 € und 24,39 €). Diese wird extrabudgetär vergütet, wobei sich dieser „Vorteil“ durch die Regelungen des TSVG relativiert, weil es sich stets um „Neupatienten“ handeln dürfte, die ohnehin extrabudgetär vergütet werden. Weitere technische Untersuchungen sind möglich und auch abzurechnen, sofern nach Einschätzung des Zweitmeiners die überlassenen Unterlagen nicht ausreichen. Eine wesentliche Grundlage der Beurteilung dürfte dabei einem technisch einwandfreien MRT zukommen, für besondere Fragestellungen auch als Arthro-MRT, z. B. bei Läsionen am Labrum glenoidale.
Die Leistung des Zweitmeiners soll gemäß der Richtlinie auch die umfassende Beratung sowie eine schriftliche Zusammenfassung der Beurteilung zur Mitgabe und auf Wunsch des Patienten auch zur Weiterleitung an den Erstmeiner umfassen.
Diese im Grunde gutachterliche Leistung wird nicht gesondert vergütet.
Summa summarum ist die Zweitmeinung aus betriebswirtschaftlicher Sicht in keiner Weise auskömmlich bewertet, insbesondere, wenn man das Honorar für GKV Patienten mit der Bewertung in anderen Gebührenordnungen vergleicht. So gewährt die DGUV seit einiger Zeit für Zweitmeinungen im D-Arzt-Verfahren ein Honorar in Höhe von 65,00 € gemäß der UV-GOÄ Nr. 34, hier allerdings einschließlich einer umfassenden (und in der Realität auch notwendigen und durchgeführten) Untersuchung. Die Erstellung einer Zweitmeinung bei GKV-Versicherten ist somit überwiegend als Serviceleistung zu beurteilen. Die Motivation des Zweitmeiners kann somit vermutlich nur entweder mit Idealismus erklärt werden oder mit dem Wunsch, die eigene Einrichtung als Kompetenzzentrum für Schulterchirurgie zu profilieren.
Fazit
Die Einbeziehung der Schulter-Arthroskopie in das „strukturierte Zweitmeinungsverfahren“ seit Februar 2020 bietet für die Patientinnen und Patienten eine zusätzliche Möglichkeit, Sicherheit bei der Indikationsstellung vor diesen Operationen zu erlangen. Für die Operateure bedeutet das Verfahren eine zusätzliche zeitliche und bürokratische Belastung und das Ärgernis der Vermutung einer unsauberen Indikationsstellung. Die Tätigkeit als Zweitmeiner ist betriebswirtschaftlich unattraktiv. Der G-BA hat sich im § 10 der Richtlinie selbst die Aufgabe gestellt, die Umsetzung, die Auswirkungen und den Nutzen dieses Verfahrens wissenschaftlich durch ein externes Institut zu evaluieren. Erst wenn dazu erste Ergebnisse vorliegen, wird man sich ein definitives Urteil über die Auswirkungen dieses Verfahrens bilden können.
Literatur
1. Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Konkretisierung des Anspruchs auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung gemäß § 27b Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2044/Zm-RL_2019-11-22_iK-2020-02-20.pdf zuletzt zugegriffen: 7.6.2020
2. Patientenmerkblatt Zweitmeinungsverfahren bei geplanten Eingriffen https://www.g-ba.de/downloads/17-98-4765/2019-10-28_G-BA_Patientenmerkblatt_Zweitmeinungsverfahren_bf.pdf zuletzt zugegriffen: 7.6.2020
Kalbe P: Zweitmeinung vor elektiver Schulterarthroskopie. Passion Chirurgie. 2020 Juni,10(7/8): Artikel 04_06.