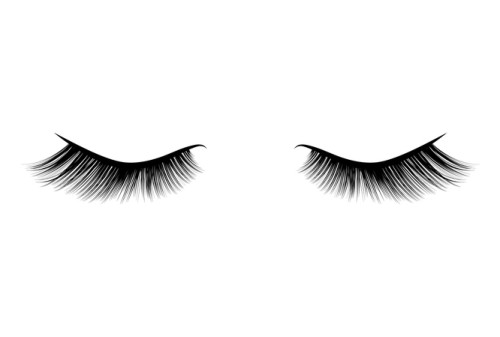Was ist passiert? Eine Patientin meldet sich beim Krankenhaus: Sie brauche einen OP-Termin und bringe ihren Assistenzhund mit. Antwort des Krankenhauses: Tiere im Krankenhaus sind nicht erlaubt. Folgetag: dicker Bericht in der lokalen Presse, dass das Krankenhaus der Patientin die Aufnahme verweigere und sich nicht an Recht und Gesetz halte.
Was ist da los? Es gibt Therapiehunde und Assistenzhunde. Letztere sind von Therapiehunden abzugrenzen.
Assistenzhunde – der bekannteste ist der Blindenführhund – helfen dem Besitzer bzw. der Besitzerin, der/die auf Grund einer Behinderung/Erkrankung Hilfestellungen in der Alltagsbewältigung benötigt. Diese Hilfestellungen können je nach Behinderung/Krankheitsbild ganz unterschiedlich ausfallen.
Therapiehunde hingegen werden unterstützend bei therapeutischen Verfahren – bspw. in der Logopädie oder in der Psychotherapie – eingesetzt.
Grundsätzlich handelt es sich um einen Hund, genauso wie jeder andere Hund mit (Jagdhund, Drogenspürhund) oder ohne (Familienmitglied) spezifische Funktion. Die rechtliche Situation unterscheidet sich allerdings erheblich: Therapiehunde müssen genauso wenig in einer Einrichtung oder am Arbeitsplatz zugelassen werden wie der Arbeitgeber den Mitarbeitern auch nicht zugestehen muss, ihren Privathund zum Arbeitsplatz mitzunehmen.
Über das Teilhabestärkungsgesetz, das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die Assistenzhundeverordnung sieht dies bei einem anerkannten Assistenzhund allerdings anders aus. Unabhängig davon, ob es sich um einen Blindenführhund – der bisher der einzige nach § 33 SGB V als alternatives, medizinisches Hilfsmittel anerkannt ist und damit alternativ zu Langstock oder Rollstuhl auch von den Krankenkassen (nach Prüfung) finanziert wird – oder einen anderen Assistenzhund handelt, kann man einer Person den Zutritt zu (zumindest bestimmten Bereichen) einer Einrichtung nicht verweigern. Bezogen auf den o. g. Fall: Die Patientin ist erst einmal im Recht.
Es empfiehlt sich, frühzeitig hierfür Regelungen zu treffen, am besten auch unter Einbeziehung der Rechtsstelle. So können Vorgaben definiert werden bzw. müssen entsprechend der Gesetzeslage erfüllt sein, z. B.:
- Nachweis über Anerkennung des Hundes als Assistenzhund,
- Vorlage eines Behindertenausweises mit erheblicher Einschränkung oder Vorlage eines Blindenführhundausweises oder eines Zertifikats, das die Eignung des Mensch-Hund-Teams nach § 12g BGG belegt,
- Gesundheitszeugnis des Hundes,
- gepflegtes Äußeres des Hundes,
- Impfnachweis,
- der Hund muss aktuell gesund sein: keine Parasiten, keine Magen-Darm-Erkrankungen, keine Wunden etc.,
- Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung mit Schadendeckung von mindestens 1 Mio. €,
- Angaben dazu, wo der Hund sich hinlegt, wer sich kümmert, wenn der Besitzer ausfällt,
- Kennzeichnung des Hundes als Assistenzhund,
- der Patient muss physisch und psychisch in der Lage sein, Regeln einzuhalten und den Hund sicher zu führen.
 Konkret muss der Zugang zur Station bzw. zum Zimmer geregelt werden – möglichst kurz von außen. Kein Zugang zu bestimmten Räumen, z. B. Küche oder Intensivstation.
Konkret muss der Zugang zur Station bzw. zum Zimmer geregelt werden – möglichst kurz von außen. Kein Zugang zu bestimmten Räumen, z. B. Küche oder Intensivstation.
Auch muss geregelt werden, was mit dem Hund passiert, wenn der Besitzer operiert wird. Wenn letzterer z. B. nach der OP nicht aus dem Bett kann oder auf Intensivstation kommt, was passiert dann mit dem Tier? Hier empfiehlt sich eine Regelung, dass eine weitere externe Bezugsperson des Tieres sich um dieses kümmert. Diese Person muss von Anfang an einbezogen werden.
Weiter sollten die Regeln im Krankenhaus – für Besucher und Mitarbeiter – kommuniziert werden. Ansonsten nimmt die Zahl der Tiere massiv zu: Mitarbeiter bringen ihre Hunde mit („das Tier ist krank und kann nicht allein zu Hause bleiben” – schon erlebt …), Besucher erscheinen mit sogenannten Kampfhunden usw.
Aufgrund der aktuelle Gesetzeslage endet die Begleitung durch Assistenzhunde vor den Patientenzimmern (zumindest bei Mehrbettzimmern) und den Funktionsbereichen. Hier empfiehlt sich zukünftig eine entsprechende Wortlautanpassung durch den Gesetzgeber, um in begründeten Einzelfällen die räumlich erweiterte Begleitung zu ermöglichen. In der Zwischenzeit bleiben lösungsorientierte Rücksprachen mit den Gesundheitsämtern zu ggfs. über den Gesetzeswortlaut hinausgehenden Einzelfall-Entscheidungen.
Parohl N, Edlinger S, Popp W, Jatzwauk L, Kohnen W: Hygiene-Tipp: Assistenzhunde im Krankenhaus. Passion Chirurgie. 2024 März; 14(03/I): Artikel 04_03.