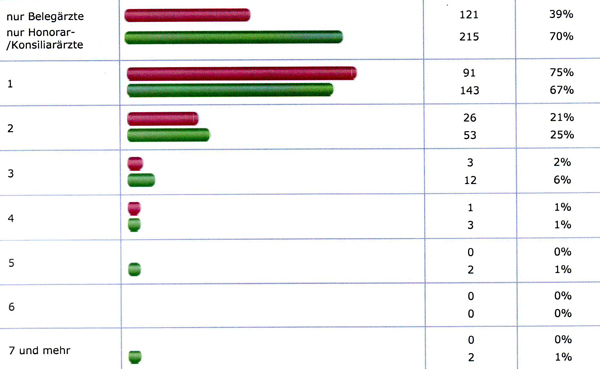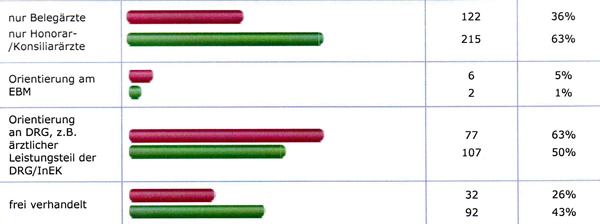Ein Vorschlag zur Diskussion
War noch bis Ende der Neunzigerjahre das Hauptproblem des chirurgischen Nachwuchses die mangelnde Stellensituation infolge der Ärzteschwemme, so hat sich nun innerhalb eines guten Jahrzehnts die Situation nahezu bedrohlich ins Gegenteil verkehrt. Allerorten hört man auf Kongressen und medizinischen Fachtagungen über mangelnden und schlecht ausgebildeten Nachwuchs, der in vielen Abteilungen nur durch Ärzte aus dem Ausland kompensiert werden kann. In Berlin soll nach einer Meldung der Morgenpost vom November 2012 bereits jeder fünfte Arzt aus dem Ausland kommen. Da diese Kollegen, insbesondere wenn sie aus dem osteuropäischen Raum kommen, oftmals nur ungenügend ausgebildet und der deutschen Sprache nicht mächtig sind, verschärft sich das Problem der Weiterbildung in den Krankenhäusern noch weiter. Die deutsch sprechenden Ärzte werden in der Patientenversorgung auf Station oder in der Ambulanz und bei der medizinischen Dokumentation eingesetzt und die ausländischen Kollegen arbeiten im OP und assistieren bei den immer seltener werdenden Ausbildungsoperationen. Kein Wunder, dass in dieser Situation die deutsch sprechenden Weiterbildungsassistenten schnell das Weite suchen.
War früher die Weiterbildung im Wesentlichen ein Problem, mit dem sich interessierte Kollegen in den medizinischen Fachgesellschaften und auf den Ärztetagen auseinandergesetzt haben, so wird das Thema Weiterbildung heute bestimmt durch eine immer weiter aufgehende Schere zwischen erhöhtem Bedarf und schrumpfenden Ressourcen.
Der Bedarf wird im Wesentlichen über die Demographie mit dem Älter- und damit Kränkerwerden der Gesellschaft definiert. Aber auch die Altersstruktur der chirurgischen Fachärzte lässt die Alarmglocken schrillen. So sind die im chirurgischen Bereich tätigen Ärzte im Krankenhaus in den Jahren von 1993 bis 2009 nach Angaben der Bundesärztekammer im Durchschnitt um drei Jahre gealtert. Im vertragsärztlichen Bereich stellt sich die Situation noch dramatischer dar: Hier ist das Durchschnittsalter eines niedergelassenen Facharztes von 46,5 Jahren auf knapp 52 Jahre im Jahr 2009 gestiegen, bei den Chirurgen sogar auf 53 Jahre. Der Umstand, dass diese Gruppe im Durchschnitt immer älter wird, ist nur dadurch zu erklären, dass nicht ausreichend interessierte Fachärzte zur Verfügung stehen und nachrücken. Warum das so ist, ist in den letzten Jahren vielfach -auch von unserem Berufsverband – untersucht worden und soll hier nur kursorisch dargestellt werden.
Der Attraktivitätsverlust beginnt bereits während des Studiums. So ist zwar auf der einen Seite der Studienplatz selber begehrt wie eh und je, ablesbar an einen Numerus Clausus, der nahe bei 1,0 liegt. Auf der anderen Seite aber stehen uns nach Abschluss des Studiums immer weniger Kollegen für die kurative Medizin zur Verfügung. Etwa 20 Prozent der Medizinstudenten führen das Studium nicht zu Ende und noch einmal die gleiche Prozentzahl geht nach dem Examen in Tätigkeiten wie zum Beispiel Wirtschaftsberatung, Controlling, Medien oder Forschung und stehen somit der Versorgung am Patienten ebenso nicht zur Verfügung, wie die ins Ausland drängenden Kollegen. Nach einer neueren Untersuchung des Hartmannbundes aus dem Jahr 2012 können sich sogar 50 Prozent der Medizinstudenten eine Tätigkeit außerhalb der kurativen Medizin vorstellen.
Weiß man aber weiterhin, dass zum Anfang eines Medizinstudiums etwa 25 Prozent der Studienanfänger eine chirurgische operative Tätigkeit anstreben möchten, am Ende des Studiums aber nur 10 Prozent tatsächlich in eine chirurgische Weiterbildung eintreten, so muss man nüchtern feststellen, dass unser Fachgebiet ganz offensichtlich unter einem erheblichen Attraktivitätsverlust leidet. Die Krone der Medizin war gestern, der Mangel ist heute.
Nach einer Umfrage des BDC unter Weiterbildungsassistenten aus dem Jahr 2011 wurden als Hauptgrund für den Attraktivitätsverlust familienunfreundliche Arbeitszeiten und eine andere Lebenseinstellung („work life balance“) genannt. Unmittelbar dahinter rangiert aus Sicht der Weiterbildungsassistenten eine ungenügende Qualität der chirurgischen Weiterbildung.
Genau so sehen dies auch die ausbildenden Chefärzte. Der Unterzeichner hat zur Jahreswende 2011/2012 eine Online-Umfrage unter den im BDC organisierten leitenden Ärzten in Schleswig-Holstein durchgeführt. Eine für solche Umfragen ansehnliche Rücklaufquote von 36 Prozent von 56 angeschriebenen Chefärzten spricht auch hier für ein hohes Interesse an dem Thema. Zusammengefasst beantworteten alle leitenden Ärzte die Frage, ob nach ihrer Einschätzung die Qualität der Weiterbildung in den letzten Jahren abgenommen hat mit Ja. Befragt zu den Gründen dafür wurde an erster Stelle angegeben, dass ein absoluter oder relativer Ärztemangel, resultierend aus der konsequenten Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes herrscht. An zweiter Stelle folgt aus Sicht der Chefärzte die Verlagerung von klassischen Weiterbildungsoperationen in ambulante Operationszentren und Praxiskliniken.
Auch die medizinischen Fachgesellschaften haben die Problematik mittlerweile erkannt. So veranstaltete die DGOU in Berlin am 05. Oktober 2012 einen Meinungsaustausch zu der Frage, ob die Qualität der Weiterbildung im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie den ursprünglich in die neue Weiterbildungsordnung gesetzten Erwartungen entspricht. Dabei kam zu Tage, dass die Ausbildungsinhalte immer seltener vollumfänglich erfüllt werden können und eine notwendige breite Erfahrung bis zum Ende der Weiterbildung nur selten erreicht wird. Selbst der im Vergleich zur alten Weiterbildungsordnung nicht unerheblich abgespeckte OP-Katalog wird immer öfter nur dadurch erfüllt, dass erste Assistenzen als eigenständig durchgeführte Operationen attestiert werden. Von jungen frischgebackenen Fachärzten wurde im Rahmen dieser Sitzung beklagt, dass sie sich trotz einer fünfjährigen Weiterbildung und erfolgreichem Abschluss der Facharztprüfung nicht in der Lage sehen, als Oberarzt oder niedergelassener Vertragsarzt eigenständig zu arbeiten.
Speziell für den Vertragsarztbereich treten hier noch weitere Probleme zu Tage. Zum Einen leidet die Tätigkeit als Vertragsarzt unter einem nicht unerheblichen Attraktivitätsverlust. Als Gründe dafür werden eine unbefriedigende finanzielle Ausstattung, eine ausufernde Bürokratie und zunehmende Gängelung durch Behörden infolge einer ausufernden Verordnungsflut (Medizinproduktegesetz, Medizinbetreiberverordnung, Qualitätssicherungsvereinbarungen, Infektionsschutzgesetz etc.) und eine Angst vor Regressforderungen bei der Verordnung von Medikamenten und Hilfsmitteln bei Befragungen angegeben.
Zum Anderen gelten im vertragsärztlichen Bereich weitere qualitative Anforderungen, die oftmals nicht oder nur schwer zu erfüllen sind. Ein Problem stellt hier die Teil-Radiologie dar. Wurde beim alten Facharzt für Chirurgie oder Unfallchirurgie und auch Orthopädie die Kenntnis in der radiologischen Diagnostik mit der Facharztanerkennung attestiert, so ist dies nach der neuen Weiterbildungsordnung zum Orthopäden und Chirurgen nicht mehr der Fall. Hier werden allein noch Kenntnisse in der intraoperativen Durchleuchtung gefordert. Da es mittlerweile Chefärzte gibt, die selber nicht mehr die Weiterbildung Teil-Radiologie besitzen, kann dies natürlich auch den neuen Fachärzten nicht mehr attestiert werden. Die Folge ist, dass damit ein eigenständiges Röntgen im vertragsärztlichen Bereich nicht möglich ist.
Eine ähnliche Situation liegt bei der Sonografie und Arthroskopie vor. Die für die Facharztanerkennung notwendige Untersuchungs- bzw. Eingriffszahl ist weit von derjenigen entfernt, die von den Qualitätssicherungskommissionen der kassenärztlichen Vereinigung als notwendig erachtet werden, um dies zur Abrechnung zu bringen.
Eine weitere Problematik ergibt sich aus der zunehmenden Spezialisierung bzw. Hyperspezialisierung. Entgegen der ursprünglichen Vorstellung, dass im Rahmen des Common Trunk eine breite chirurgische Basiserfahrung erworben werden soll, zeigt die Erfahrung, dass bereits während dieses ersten Abschnitts der fachärztlichen Weiterbildung in der Hauptsache mehr oder weniger spezialfachärztliche Kenntnisse erworben werden. Im Ergebnis ist der heutige Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie – aber sicherlich auch in anderen chirurgischen Disziplinen – ein Spezialist mit einem eng umrissenen Spektrum. Damit ist der Weg in die Niederlassung nur dann möglich, wenn dies mit anderen Kollegen zusammen erfolgt, im Regelfall im städtischen oder großstädtischen Bereich. Eine Versorgung im ländlichen oder kleinstädtischen Bereich, wo im Regelfall eine Einzel- oder maximal Zweierpraxis besteht, kann mit diesen Kollegen kaum gewährleistet werden.
Damit kann an dieser Stelle zusammenfassend festgestellt werden, dass wir uns bei der chirurgischen Versorgung – insbesondere im vertragsärztlichen Bereich – in einem Dilemma befinden. Auf der einen Seite besteht ein erhöhter und bedingt durch die Demographie zunehmender Bedarf an chirurgischen Leistungen, auf der anderen Seite schwinden unsere Ressourcen durch eine Überalterung der Fachärzte und einen zusätzlichen Attraktivitätsverlust der chirurgischen Fächer und damit verbundenem sinkenden Facharztzahlen. Diese immer weiter aufgehende Schere hat eine solch erhebliche Dynamik gewonnen, dass es dringend Zeit wird, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen.
Dabei gibt es nun ein weiteres Problem und das ist die z. T. quälende Langsamkeit des bisherigen Systems. So werden Änderungen in der Weiterbildungsordnung üblicherweise von den Fachgesellschaften diskutiert und empfohlen, dann in der Weiterbildungskommission der Bundesärztekammer beraten und zu einer Vorlage zusammengestellt, es folgt die Diskussion und im günstigen Fall Verabschiedung auf dem Deutschen Ärztetag zu einer Musterweiterbildungsordnung und dann muss noch der Weg durch die Instanzen, sprich die Verabschiedung in den Landesärztekammern genommen werden. Selbst bei optimistischer Schätzung dauert ein solcher Vorgang leicht fünf Jahre. Ich persönlich habe die Befürchtung, dass dann nicht mehr allzu viel zu retten ist.
Aus meiner Sicht ist daher ein neues Denken angezeigt – auch außerhalb der gegenwärtigen Weiterbildungsstrukturen – um gegebenenfalls zu unkonventionellen Lösungen zu gelangen. Dies ist nach meiner festen Überzeugung nicht nur ein rein innerärztliches Problem, sondern hier müssen zumindest auch in Teilen sämtliche gesellschaftliche Gruppen mit einbezogen werden.
Als erstes gilt es Fragen zu stellen, die von der Gesellschaft zu beantworten sind.
1. Kann die Gesellschaft es sich weiterhin leisten, Medizinstudenten auszubilden ohne die Verpflichtung kurativ tätig zu werden?
2. Ist die Finanzierung der Weiterbildung allein eine Aufgabe der Selbstverwaltung (Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft, kassenärztliche Vereinigung) oder doch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe?
3. Kann es toleriert werden, dass die Versorgung mit Assistenzärzten und Fachärzten nur in attraktiven Ballungsräumen funktioniert?
Trotz einer ausgeprägten liberalen politischen Grundeinstellung und als glühender Anhänger der sozialen Marktwirtschaft bin ich mittlerweile zu der festen Überzeugung gekommen, dass sämtliche der oben genannten Fragen mit nein zu beantworten sind. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist in großen Teilen des Landes konkret in Gefahr. Zwar sind mittlerweile Anreizprogramme aufgelegt worden, um die Versorgung in unattraktiven ländlichen Räumen zu verbessern, einen wesentlichen Erfolg dieser Maßnahmen habe ich aber bisher nicht wahrnehmen können. Wettbewerb und Anreizsysteme alleine lösen somit das Problem nicht und dem folgend, scheinen intelligente Lenkungsmaßnahmen unausweichlich.
Auch innerhalb der Ärzteschaft gilt es natürlich eine ganze Reihe von grundsätzlichen Fragen zu diskutieren. In erster Linie geht es dabei zu beantworten, ob das bisherige Weiterbildungssystem überhaupt noch zeitgemäß ist. So erscheint die derzeit übliche Weiterbildungsermächtigung eines leitenden Arztes einer Abteilung zunehmend anachronistisch, wenn große und zentrale Anteile der Weiterbildungsinhalte gar nicht mehr im Krankenhaus angeboten werden.
Ein möglicher Ausweg aus dieser Misere stellt ein Modell zur strukturierten Weiterbildung im Rahmen eines Verbundes dar. Ähnliche Systeme funktionieren schon seit Jahren in mehreren westlichen Ländern, wie zum Beispiel den USA. Hier bewirbt sich ein Weiterbildungskandidat nicht bei dem Chefarzt einer Abteilung, sondern für ein Weiterbildungsprogramm an einer Universität. Dem Weiterbildungsprogramm der Universität sind dann eine ganze Reihe von Krankenhäusern unterschiedlicher Versorgungsstufen und auch ambulante Operationszentren angeschlossen. Die Universität ist somit Herrin des Verfahrens und schickt den Weiterbildungsassistenten in einem zu Beginn der Weiterbildung festgelegten Rotationsprogramm in die angeschlossenen Weiterbildungsstätten. Am Ende des Programms hat der Weiterbildungskandidat nicht nur alle Abteilungen durchlaufen sondern er hat auch sämtliche notwendigen Eingriffe eigenständig durchgeführt.
In Deutschland wäre es gut vorstellbar, wenn die Herrin des Verfahrens nicht eine Universität, sondern die Ärztekammer ist. Schließlich ist diese sowieso schon mit der Weiterbildung befasst. Die Finanzierung der Weiterbildung würde damit auch nicht mehr über den Stellenplan bzw. die DRG-Erlöse eines Krankenhauses erfolgen. Vielmehr müsste ein Fonds geschaffen werden, der aus unterschiedlichen Finanzquellen gespeist werden könnte. Zum einen sind hier die Vertragspartner der Selbstverwaltung zu nennen (Krankenkassen, KV, Krankenhausgesellschaft), denkbar wäre aber auch eine Umlage der Ärztekammer und natürlich auch Mittel aus dem Landeshaushalt. Schließlich besteht ein im wahrsten Sinne des Wortes vitales Interesse aller gesellschaftlichen Gruppen an einer funktionierenden fachärztlichen Versorgung.
Die Weiterbildungsermächtigung oder –hoheit liegt in einem solchen System bei der Ärztekammer. Von dieser werden dann Teilweiterbildungsermächtigungen für qualifizierte Weiterbilder in Krankenhaus, Praxis oder ambulantem Operationszentrum ausgesprochen. Diese Teilweiterbildungsermächtigung wird in erster Linie nicht an das Weiterbildungsfach, sondern an das angebotene Spektrum geknüpft. Damit ist sichergestellt, dass die für den Weiterbildungskatalog notwendigen Eingriffe und Fähigkeiten auch tatsächlich in den teilnehmenden Abteilungen angeboten werden. Diese Weiterbildungseinheiten erhalten dann ihrem Spektrum entsprechend für eine definierte Zeit einen Weiterbildungsassistenten zugewiesen.
Die Zuweisung sollte bereits mit Beginn des Weiterbildungsprogramms für die gesamten sechs Jahre klar formuliert werden. So wird dem Weiterbildungsassistenten, aber auch natürlich den Weiterbildungsstätten, eine Planungssicherheit gegeben. Damit wird ein mandatorisches und überörtliches Rotationsverfahren implementiert, das zwar den Nachteil in sich birgt, dass der Weiterbildungsassistent umziehen muss, auf der anderen Seite wird ihm aber eine Eingriffszahl und hohe Qualität der Ausbildung garantiert.
Eben dies wird ständig evaluiert durch Befragung der Weiterbildungsassistenten, dies spätestens zum Zeitpunkt der Facharztprüfung, die ja von der Aufsicht führenden Ärztekammer vorgenommen wird. Sollte dabei zu Tage treten, dass eine Weiterbildungseinheit ihren zugesicherten Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, so würde diese im Wiederholungsfalle auch damit rechnen müssen, zukünftig keine Weiterbildungsassistenten mehr zugewiesen zu bekommen. Somit besteht ein ureigenes Interesse der weiterbildenden Einheiten an einer qualitativ hochwertigen Ausbildung, denn nur so wird ihnen über den Weiterbildungsverbund eine Arbeitskraft zugeteilt. Andererseits darf der Weiterbildungsassistent für seine Arbeitskraft eine qualitativ hochwertige Ausbildung erwarten. Neudeutsch würde man dies als klassische win-win-Situation bezeichnen.
Wie oben schon ausgeführt, wird dieses System zwangsläufig dazu führen, dass die Wahlmöglichkeit der Weiterbildungsassistenten im Vergleich zu heute nicht unerheblich eingeschränkt wird. Verbunden müsste dieses System in jedem Falle mit einem weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten an den entsprechenden Einrichtungen. Auch von den Krankenhäusern zur Verfügung gestellter Wohnraum wäre hier anzustreben, insbesondere bei nur kurzfristiger Rotation über wenige Monate. Der Nachteil der höheren Mobilität wird aber dadurch aufgefangen, dass durch das Kennenlernen von anderen Krankenhäusern und Arbeitsweisen, der Erfahrungsschatz des einzelnen Weiterbildungskandidaten weiter vergrößert wird. Der Vorteil für die Gesellschaft ist, dass die Weiterbildungsassistenten nicht alleine nach ihrem persönlichen Weiterbildungsbedarf eingesetzt werden können, sondern auch nach dem speziellen Versorgungsbedarf. So könnten schlecht versorgte Gebiete, wie zum Beispiel nahe der polnischen Grenze oder an der schleswig-holsteinischen Westküste, in einem solchen System bei qualitativ hochwertiger Weiterbildung durchaus bevorzugt werden.
Im Ergebnis würde das vorgestellte Verfahren nach meiner festen Überzeugung zu gut oder zumindest zu besser ausgebildeten chirurgischen Fachärzten führen. Dies erhöht in gleichem Maße dann auch die Attraktivität der Weiterbildung. Darüber hinaus kann die fachärztliche Versorgung sowohl in der Fläche als auch für die Zukunft betrachtet, am ehesten gesichert werden. Und last, but not least, führt das sektorenübergreifende Arbeiten in dem Ausbildungsverbund zu einem besseren Verständnis der beteiligten Ärzte auf Niederlassungs- oder Krankenhausseite und es ist durchaus vorstellbar, dass so auch die vertragsärztliche Tätigkeit für junge Kollegen wieder interessant wird.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass wir uns mit der fachärztlichen Versorgung in einem ausgeprägten Dilemma zwischen steigendem Bedarf und schwindenden Ressourcen befinden. Aufgrund der erheblichen Dynamik dieser Entwicklung ist unkonventionelles Denken und die Entwicklung von mit den gegenwärtigen Strukturen nicht kompatiblen Lösungsvorschlägen angezeigt. Ein gangbarer und erfolgversprechender Weg ist dabei die Implementierung von strukturierten, die Sektorengrenzen überschreitenden Ausbildungsverbünden, nach Möglichkeit unter Führung der Ärztekammer oder auch einer Universität. Da ein solches System auch nicht unerhebliche gesamtgesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt, darf dieses Thema nicht nur allein innerärztlich diskutiert werden, sondern muss auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden.
Es ist viel zu tun – packen wir’s gemeinsam an.