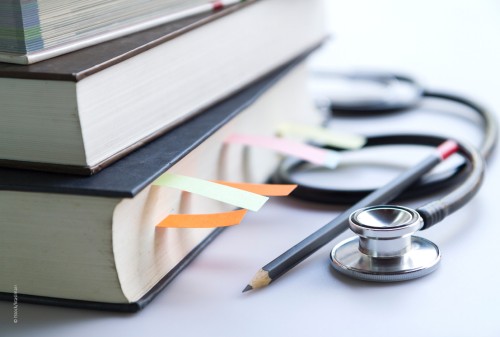Zukunft der chirurgischen ärztlichen Weiterbildung im Kontext der Krankenhausstrukturreform
Der Status Quo ist ernüchternd: Noch nicht einmal zehn Prozent der in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte arbeiten im ambulanten oder stationären Bereich chirurgisch. Zugleich steigt die Abwanderung ins (europäische) Ausland und viele erfahrene Kolleg:innen gehen in den Ruhestand. Die Zahl der Bewerber:innen für chirurgische Fächer sinkt spürbar, was sich negativ auf die Versorgungsqualität auswirkt. Das abnehmende Interesse an der Chirurgie lässt sich dabei nicht nur auf die als erschöpfend wahrgenommene Arbeitsrealität und eine oft unbefriedigende Weiterbildung zurückführen. Hinzu kommen die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fehlende Wertschätzung im klinischen Alltag sowie eine begrenzte individuelle Entwicklungsperspektive. Auch zunehmender ökonomischer Druck und bürokratische Hürden tragen zur Entfremdung vom Fach bei. [1, 2, 3, 4]
Die politisch forcierte Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft birgt das Risiko eines weiteren Qualitäts- und Erfahrungsverlusts in der chirurgischen Weiterbildung, insbesondere durch Ambulantisierung und Zentralisierung, Fallzahlreduktion und einen noch höheren ökonomischen Druck. Die im Gesetz genannten Mindestvoraussetzungen inklusive weiterer Auswahlkriterien und der personellen Ausstattung mit Qualifikationen und Verfügbarkeit von Fachärztinnen und -ärzten erschweren die Möglichkeiten der ärztlichen Weiterbildung. Eine adäquate Abbildung der ressourcenintensiven Weiterbildung in der Krankenhausstrukturreform findet sich nicht.
Dennoch: Die Krankenhausstrukturreform stellt die chirurgische Weiterbildung in Deutschland zwar vor grundlegende Herausforderungen, eröffnet aber zugleich Chancen für eine nachhaltige Weiterentwicklung, Innovation und Qualitätssteigerung. Um dem drohenden Erfahrungsverlust entgegenzuwirken, könnten rotierende Weiterbildungsmodelle oder Kooperationen zwischen Kliniken und ambulanten Einrichtungen etabliert werden. Solche Ansätze ermöglichen eine bessere Vernetzung und bieten Nachwuchschirurg:innen die Chance, unterschiedliche Versorgungssituationen kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Zusätzlich könnten gezielte Förderprogramme und strukturierte Rotationen dazu beitragen, die Qualität der Weiterbildung nachhaltig zu sichern, Weiterbildungszeiten zu verkürzen, eine transparente Finanzierung zu ermöglichen und flexibel auf die veränderten Anforderungen zu reagieren. Studien aus dem Ausland zeigen, dass die Integration von strukturierten Weiterbildungsprogrammen nicht zu einer Verschlechterung der Versorgungsqualität führt, sondern gerade in reformierten Strukturen eine stabile Patientenversorgung möglich ist. [1, 5]
→ Positiv gesehen, eröffnet die Krankenhausstrukturreform also die Möglichkeit, bestehende Defizite gezielt anzugehen und die Weiterbildung zukunftsfähig zu gestalten, etwa durch die strukturierte und für alle Beteiligten verlässliche Weiterbildung in Verbünden, eine transparente Finanzierung, die stärkere Einbindung chirurgischer Fachgesellschaften und Berufsverbänden und die Berücksichtigung
sozialer Rahmenbedingungen für Nachwuchschirurg:innen.
Herausforderungen und Chancen der Krankenhausstrukturreform für die ärztliche Weiterbildung
Ambulantisierung, Zentralisierung und Weiterbildungsverbünde
Die geplante Verschiebung zahlreicher chirurgischer Eingriffe in den ambulanten Sektor sowie die Zentralisierung von vor allem komplexeren Eingriffen auf wenige große Kliniken, erschweren die Umsetzung einer strukturierten Weiterbildung. Auch Maximalversorger und Universitätskliniken werden in der Regel nicht mehr die volle Weiterbildungsbefugnis erhalten können. Kleinere chirurgische Fächer und ländliche Regionen könnten weiter ausgedünnt werden und damit sowohl die Weiterbildungsqualität als auch die Versorgungssicherheit gefährdet werden. Die Einführung von Weiterbildungsmodellen in Verbünden von Kliniken und Praxen/MVZs verschiedener Größe und mit unterschiedlichem Angebot ist – je nach Ärztekammer – weitestgehend unproblematisch und gewünscht. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein und die entsprechenden Beteiligten haben mit verschiedenen Modellprojekten z. B. in der Chirurgie und der Kinder- und Jugendmedizin sehr gute Erfahrungen gemacht. Auswertungen zeigen eine Win-Win-Situation für Weiterzubildende und Befugte, insbesondere für den Zugewinn an Wissen auf beiden Seiten, gegenseitiges Verständnis und Vernetzung. Neben einer notwendigen Flexibilität für z. B. Veränderungen beim Arbeitsweg und der wiederkehrenden Integration in andere Teams, profitieren die Weiterzubildenden v. a. von größeren Fallzahlen, strukturierten Rotationen und einen möglichen Abschluss der Weiterbildung in der Mindestzeit ohne Suche nach Anschluss-Stellen und ein „Hintenanstellen“ in neuen Teams. Die Befugten haben verlässliche Nachfolger für Weiterzubildende und müssen sich nicht auf die Suche nach neuen Weiterzubildenden begeben (Abb. 1).

Abb. 1: Ärztin in Weiterbildung auf Wanderschaft angelehnt an die Wanderjahre von Handwerksgesellen. Die Abbildung wurde von der Autorin kreiert und als Microsoft 365-Abonnentin lizenzfrei verwendet
Sektor- und einrichtungsübergreifende Verbundmodelle mit Rotations- und Kursangeboten müssen jedoch noch arbeits- und versicherungsrechtlich abgesichert werden. Die Problematik der arbeitsvertraglichen und versicherungsrechtlichen Gestaltung (Stichwort Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und sektoren- und arbeitgeberübergreifende Arbeitsverträge) wird derzeit ebenfalls auf Bundesebene geklärt.
Finanzierung und Ressourcen
Die ärztliche Weiterbildung erhält bislang keine angemessene finanzielle Kompensation. Kliniken und Praxen werden für die Weiterbildung des ärztlichen Nachwuchses nicht ausreichend vergütet, was nicht nur die Motivation zur Weiterbildung mindert, sondern auch die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Infolgedessen verliert die Weiterbildung zunehmend ihren Status als hoheitliche und ehrenvolle Aufgabe, da wirtschaftliche Zwänge in den Vordergrund rücken.
Derzeit werden verschiedene Modelle und Ansätze diskutiert, wie eine adäquate und unabhängige Finanzierung der Weiterbildung aussehen könnte. Im Fokus stehen dabei Finanzierungsmechanismen, die sowohl den tatsächlichen Aufwand als auch die Bedeutung der Weiterbildung für das Gesundheitssystem berücksichtigen und Anreize für Kliniken und Praxen schaffen.
Ein wichtiger Schritt ist die Einführung und gesetzliche Verankerung (KHVVG, SGB V) einer ärztlichen Personalbedarfsbemessung neben der fachärztlichen personellen Ausstattung. In Berechnungsmodellen wie dem Ärztlichen Personalbemessungssystem der Bundesärztekammer (ÄPS-BÄK) wird die Weiterbildungstätigkeit von Befugten sowie die Arbeitsleistung von Weiterzubildenden erstmals explizit berücksichtigt. Damit erfolgt zumindest eine indirekte finanzielle Anerkennung und Wertschätzung der ärztlichen Weiterbildung, die zukunftsweisend für das gesamte Gesundheitssystem ist. Diese Entwicklung stärkt die nachhaltige Qualitätssicherung in der Weiterbildung und unterstreicht ihre gesellschaftliche Bedeutung. [6, 7]
Auch ein vermehrter Einsatz qualifizierter, auch akademisierter Gesundheitsfachberufe, wie z. B. Physician Assistants, könnten Weiterzubildende entlasten und Valenzen für eine adäquate Weiterbildung schaffen.
Föderalismus
In Deutschland gibt es 17 Landesärztekammern, welche als Körperschaften des öffentlichen Rechtes mit Sicherstellungsauftrag eine starke Rechtskraft besitzen. Eine der Kernaufgaben ist die Regelung und Überwachung der ärztlichen Weiterbildung. Die föderale Organisation führt zu 17 Weiterbildungsordnungen mit z. T. unterschiedlichen Inhalten und Anerkennungen z. B. bei einer Änderung der zuständigen Kammer durch Wechsel des Arbeitgebers. Die immer wieder geforderte bundesweit einheitliche und verbindliche Weiterbildungsordnung mit klaren Kerncurricula und Kompetenzprofilen wird es in einem föderalen Staat mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben und die Bundesärztekammer ist hier als nicht eingetragener Verein ohne Rechtspersönlichkeit als Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern zu verstehen. Auf Bundesebene versuchen die Landesärztekammern bundesweite Standards und Erleichterungen bei einem Wechsel und der gegenseitigen Anerkennung von Weiterbildungszeiten zu ermöglichen.
Zudem werden zurzeit sogenannte verpflichtende Train-The-Trainer-Programme nach einem Beschluss des Deutschen Ärztetages 2024 im Sinne einer didaktischen Qualifizierungsmaßnahme für Befugte von den Landesärztekammern mit jeweils eigenen Programmen ausgearbeitet und eingeführt.
Die Evaluation der Weiterbildung zur Qualitätssicherung erfolgt zumindest punktuell und sollte verpflichtend ausgebaut werden.
Familienfreundlichkeit, Bewerbermangel, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitmodelle
Die hohe Arbeitsdichte, Personalnot und schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie führen zu einem Rückgang des Interesses an chirurgischen Karrieren. Befristete Verträge und mangelhafte soziale Rahmenbedingungen verschärfen das Problem.
Die Dauer der Weiterbildungszeiten in Deutschland übersteigt oftmals die von der Europäischen Union vorgegebene Mindestdauer laut Berufsanerkennungsrichtlinie (vgl. Mindestdauer der fachärztlichen Weiterbildungen gemäß Anhang V der EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (BARL) 2005/36/EG). [8] Um die Attraktivität des Standorts Deutschland für junge Chirurg:innen zu erhöhen, empfiehlt sich eine kritische Überprüfung der Weiterbildungsinhalte sowie eine Anpassung der Weiterbildungszeiten, sodass die tatsächliche Weiterbildung im Vordergrund steht. Erleichterte Rotationsmöglichkeiten und die Förderung von Weiterbildungsverbünden, die von den Landesärztekammern begrüßt werden, bieten hier praktikable Ansätze.
Flexibilität und familienfreundliche Strukturen sind essenzielle Faktoren für die Nachwuchsgewinnung und -bindung in der Chirurgie. Befristete Verträge sowie unzureichende soziale Rahmenbedingungen, beispielsweise fehlende Kinderbetreuung, verschärfen den Bewerbermangel. Dafür sind entfristete (Weiterbildungs-)Verträge, Home-Office-Optionen, flächendeckende und flexible Betreuungsangebote für Kinder sowie strukturierte Modelle für Elternzeit und Wiedereinstieg entscheidend. Zudem ist die Sensibilisierung von Führungskräften und Betriebsmediziner:innen für die Bedürfnisse von Chirurg:innen in besonderen Lebenssituationen – etwa beim Operieren in Schwangerschaft und Stillzeit – unerlässlich. Positive Entwicklungen, wie unterstützende Programme für schwangere Chirurginnen und ein wachsendes Bewusstsein für individuelle Lebenslagen, zeigen bereits, dass ein Kulturwandel möglich und eingeleitet ist. [9, 10]
Innovationsstau
Moderne Verfahren wie Robotik, Simulationstrainings, Augmented und Virtual Reality sowie digitale Weiterbildungsformate inklusive onlinebasierter Lernmodule werden bislang nur vereinzelt in Weiterbildungscurricula integriert, obwohl sie die Möglichkeit bieten, Lerninhalte ggf. auch orts- und zeitunabhängig hocheffizient zu vermitteln. Hier gibt es immer mehr Ärztekammern (wie z. B. in Schleswig-Holstein), die diese Formate anerkennen und sehr gute Erfahrungen damit machen.
Die fortschreitende Digitalisierung bietet großes Potenzial zur Entlastung und Modernisierung der ärztlichen Weiterbildung. Digitale Werkzeuge und innovative Technologien, etwa bei der Erstellung von Arztbriefen, können nicht nur die klinische Versorgung strukturieren, sondern auch die Zeitbelastung spürbar senken. Werden diese Lösungen gezielt gefördert, entstehen wertvolle Kapazitäten für die praktische Weiterbildung, was wiederum die Effizienz und Qualität der Weiterbildung deutlich steigert. [11, 12]
Fazit
Die Krankenhausstrukturreform birgt erhebliche Risiken für die chirurgische Weiterbildung. Gleichzeitig eröffnet sie die Chance, als Katalysator für eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige chirurgische Weiterbildung genutzt zu werden, wenn eine unabhängige und transparente Finanzierung sowie innovative, praxisnahe Weiterbildungs-Modelle und digitale Tools systematisch integriert werden. Um außerdem dem Bewerbermangel entgegenzuwirken und die Attraktivität der Chirurgie langfristig zu steigern, sind eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Sinne einer wertschätzenden Weiterbildungskultur mit evidenzbasierten, modernen und sozial nachhaltig gestalteten Strukturen erforderlich. Nur durch gezielte Verbesserungen kann die chirurgische Weiterbildung fit für die Zukunft gemacht werden, wieder mehr Nachwuchs begeistern und so eine qualitativ hochwertige und quantitativ ausreichende ärztliche Versorgung in Deutschland auf Facharztniveau gesichert werden. Lösungen und Veränderungen sind nur gemeinsam durch enge Zusammenarbeit zwischen Ärztekammern, den jeweiligen Fachgesellschaften und Berufsverbänden unter Einbezug der sich weiterbildenden Ärztinnen und Ärzte umsetzbar. Nachfolgend sind auch die weiteren Akteure im deutschen Gesundheitswesen, die Politik und die Gesellschaft gefragt.
Literatur
[1] Schlottmann F, Drossard S, Dey Hazra M, Blank B, Herbolzheimer M, Mulorz J, Kröplin J, Huber T, Doukas P, Sadat N, Rüsseler M, Rösch R, Bouffleur F, Lif Keller S, Freund G. Herausforderungen und Chancen für die chirurgische Weiterbildung : Ein fachgesellschaftsübergreifendes Positionspapier vor dem Hintergrund der Krankenhausstrukturreform [Challenges and options for advanced training in surgery : An interdisciplinary position paper against the background of the hospital structural reform in Germany]. Chirurgie (Heidelb). 2024 Jul;95(7):539-545. German. doi: 10.1007/s00104-024-02113-x. Epub 2024 Jun 12. PMID: 38864879; PMCID: PMC11190013.
[2] Persönliche Abfrage bei der Bundesärztekammer sowie Blum M. Ärztestatistik 2022 Warten auf die Wende. Dtsch Ärztebl. 2023;120:A848–B724.
[3] Vallböhmer D. „Nehmen wir jetzt jeden?“. Eine Umfrage in Deutschen chirurgischen Kliniken. Passion Chir. 2018;8:04–02.
[4] Schneider KN, Masthoff M, Gosheger G, et al. Generation Y in der Chirurgie – der Konkurrenzkampf um Talente in Zeiten des Nachwuchsmangels. Chirurg. 2020;91:955–961. doi: 10.1007/s00104-020-01138-2.
[5] Louis M, Gibson B, Krause M. Impact of Surgical Residency Integration on Trauma and Acute Care Surgery Outcomes: A Retrospective Analysis. J Surg Educ. 2024 Sep;81(9):1293-1296. doi: 10.1016/j.jsurg.2024.06.009. Epub 2024 Jul 2. PMID: 38955660.
[6] https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/AEPSBAEK/Praesentation_DAET_aktualisiert_28082024.pdf; letzter Zugriff 24.01.2025
[7] https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/aeps-baek; letzter Zugriff 01.09.2025#
[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036; letzter Zugrif. 01.09.2025
[9] https://www.opids.de/fileadmin/OPidS/Dokumente/Fächerübergreifender_Konsens_in_der_Chirurgie_operative_Tätigkeiten_in_Schwangerschaft_und_Stillzeit.pdf, letzter Zugriff 01.09.2025
[10] Richardt D, Niethard M, Kreuder A. Operative Tätigkeiten in der Schwangerschaft und Stillzeit, Passion Chirurgie 03/2025, https://www.bdc.de/karriere-operative-taetigkeiten-in-der-schwangerschaft-und-stillzeit/, letzter Zugriff 01.09.2025
[11] Vogel C, Bertsch V, Rollmann MF, Herath SC, Histing T, Braun BJ. Digitalisierung in der chirurgischen Weiterbildung : Status quo, Chancen und Herausforderungen [Digitalization in surgical training : Status quo, opportunities and challenges]. Chirurgie (Heidelb). 2025 Jun;96(6):482-491. German. doi: 10.1007/s00104-025-02285-0. Epub 2025 May 5. PMID: 40323369; PMCID: PMC12098399.
[12] Brunner S, Kröplin J, Meyer HJ, Schmitz-Rixen T, Fritz T. Einsatz chirurgischer Simulatoren in der Weiterbildung – eine deutschlandweite Analyse [Use of surgical simulators in further education-A nationwide analysis in Germany]. Chirurg. 2021 Nov;92(11):1040-1049. German. doi: 10.1007/s00104-020-01332-2. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33399900; PMCID: PMC8536651.
Richardt D, Burgdorf F: Weiterbildung weitergedacht. Passion Chirurgie. 2025 Oktober; 15(10): Artikel 03_03.