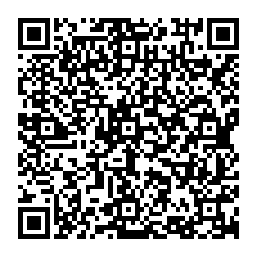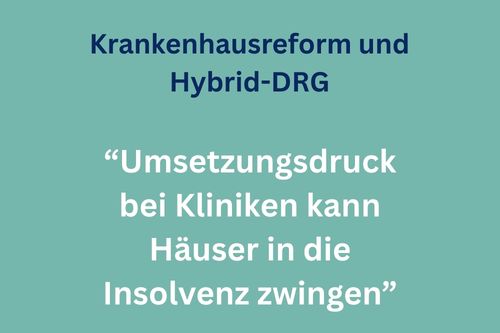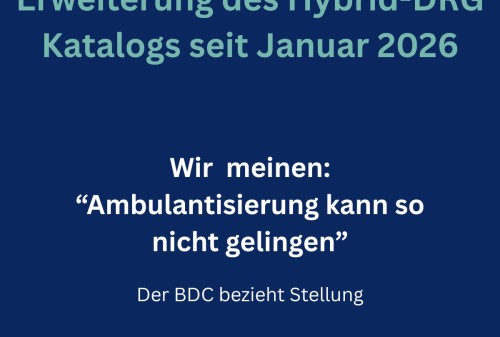Interview mit Professor Carolin Tonus und Dr. Björn Schmitz
Im September 2025 wurden Professor Dr. Carolin Tonus und Dr. Björn Schmitz als Doppelspitze zu Sprechern der BDC-Landesverbandsvorsitzenden und der Regionalvertretungen ernannt. Der BDC hat nachgefragt, wie die beiden sich ihre Arbeit mit den Mandatsträgerinnen und -trägern in den Landesverbänden des BDC vorstellen und welche Pläne sie verfolgen. Das Interview führte Olivia Päßler vom BDC.
Passion Chirurgie: Welchen Auftrag haben Sie sich als Vertreter der BDC-Landesverbände auf die Fahne geschrieben? Welche Pläne haben Sie bereits besprochen?
Carolin Tonus (CT): Es ist der Moment gekommen, in dem wir bei unserer Arbeit einen integrativen Ansatz verfolgen müssen. Dies meinen wir in alle Richtungen: Wir möchten nicht nur die Landesverbände an einen Tisch, sondern auch Kliniker und Niedergelassene miteinander ins Gespräch bringen und zur Zusammenarbeit einladen. Wir wollen unsere Themen und Projekte auch in enger Abstimmung mit Vorstand und Geschäftsführung vorantreiben.
Björn Schmitz (BS): Mit der Neuwahl möchten wir einen Neuanfang wagen. Wir haben eine Riesenchance, als Landesverbände gemeinsam sichtbarer zu werden. Den integrativen Ansatz wollen wir dabei nach außen wie auch nach innen verfolgen. Wenn wir als berufspolitischer Chirurgieverband etwas bewegen wollen und etwa bei den großen Themen wie Krankenhausreform und Weiterbildung gehört werden und mitbestimmen wollen, geht das nur, wenn wir uns einig sind und mit einer Stimme sprechen.
Welche Vorteile versprechen Sie sich von Ihrer Doppelspitzenfunktion?
BS: Ich kann sehr stark von Carolins Erfahrung profitieren. Sie ist in mehreren Funktionen in Hamburg und darüber hinaus aktiv, hat sogar eine Funktion als Aufsichtsrat an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH inne. Das ist extrem wertvoll für die Vernetzung und die berufspolitische Tätigkeit im BDC.
CT: Und ich profitiere von Björns jugendlichem Elan und seinen Ideen. Wir ticken ähnlich und ergänzen uns gut. Aufgrund meiner vielen Ämter hätte ich diese Aufgabe alleine nicht übernommen und ich bin dankbar, dass wir das gemeinsam machen. Zusammen haben wir einfach mehr Power und Perspektive. Es tut gut, wenn man sich mit seinen Gedanken ergänzt – natürlich auch gemeinsam mit allen anderen Playern.
Zu den Personen
Prof. Dr. med. Carolin Tonus
1. Vorsitzende BDC|Landesverband Hamburg
Sprecherin der Landes- und Regionalvertreter:innen im BDC
Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie
Asklepios Klinik St. Georg
Professor Carolin Tonus im Portrait…
Dr. med. Björn Schmitz, MHBA
Vorsitzender des Landesverbands BDC|Westfalen-Lippe
Sprecher der Landes- und Regionalvertreter:innen im BDC
Mitglied BDC-Themenreferat „Krankenhausstrukturen, sektorenübergreifende Versorgung und Nachhaltigkeit“
Knappschaft Kliniken Westfalen
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Proktologie
Dr. Björn Schmitz im Portrait…
|
Welche Verantwortung und welchen Einfluss haben speziell die Landesverbände aus Ihrer Sicht?
CT: Die Landesverbände sind die Sprecher der Basis. Und die Basis braucht Gewicht: Der Erfolg der Chirurgie in Deutschland hängt davon ab, dass bekannt ist, wo in den einzelnen Regionen der Schuh drückt. Das möchten wir transparent machen, zusammentragen und mit der Verbandsführung diskutieren. Nutzen wir die Stärke der Basis. Wir möchten sichtbar und wirksam werden und fordern daher auch von unseren Mitgliedern Engagement und Einsatz.
BS: Bei uns ist es ähnlich wie in der Politik. Wir als Landesvertretungen wollen bewirken, dass unser Vorstand und unsere Führungsspitze unsere Interessen vertreten. Dafür müssen wir aktiv werden, unsere Anliegen sammeln und konsentierte Themen beim Vorstand adressieren. Kurzgefasst: Wir identifizieren gemeinsame Themen, kommunizieren und begleiten sie.
Wie möchten Sie mit den Landesverbänden kooperieren, was erwarten Sie von den Landesverbänden?
CT: Eines ist klar: Wir fordern die Zusammenarbeit mit allen und untereinander ein. Wir sind keine Alleinunterhalter und wir können nicht die Kuh zum Kalben tragen. Deshalb begrüßen wir in den Ämtern für den BDC engagierte Mandatsträgerinnen und -träger, die etwas bewegen wollen. Wir sehen unsere Rolle so, dass wir eine Plattform bieten, informieren und begleiten möchten. Zudem möchten wir als Bindeglied Richtung Politik und BDC-Vorstand agieren.
BS: Der kleine praktische Schritt, wie wir dies umsetzen können, sind unsere regelmäßige gemeinsame Zoom-Konferenzen. Viele können schnell zusammenkommen. Das hat Zukunft, und die Termine für dieses Jahr stehen schon fest. Wichtig ist ein produktives Miteinander. Wir können nicht die Treiber sein, ein Mandat in den Landesverbänden erfordert Eigenengagement. Und ich kann sagen: Das zahlt sich für jeden einzelnen und jede einzelne aus!
Welche Herausforderungen sehen Sie für sich selbst in Ihrer Position?
CT: Zunächst einmal sind wir als Ärztinnen und Ärzte keine Lobbyexperten. Wir arbeiten aus Überzeugung und Erfahrung heraus. Bei mir kommt noch dazu, dass meine Generation es als Baby-Boomer gewöhnt ist, sich durchzubeißen und gegeneinander zu konkurrieren. Die heutige Generation ist geprägt von Kooperation. Dieses Mandat auf Alleinherrschaft ist also vorbei. Wir wollen den Föderalismus überwinden und die Schwarmintelligenz untereinander fördern. Je mehr wir uns vernetzen und austauschen, desto besser sind wir. Das sehe ich in der Klinik auch: Egal ob in der Ärzteschaft oder der Pflege oder übergreifend: Ein Team ist immer stärker als die einzelnen Charaktere.
Ein Schlusswort bitte!
CT: Nochmal – durch Zusammenarbeit können wir mehr PS als die jeweils einzelnen Landesverbände auf die Straße bringen. Das Zusammen ist also wichtig, bedarf aber auch der Loyalität.
BS: Die Landesverbände sollen eine Basis des gemeinsamen Gedeihens sein. Wir fordern Loyalität von allen Seiten, das heißt auf der horizontalen und auf der vertikalen Ebene, und aktives Mitgestalten. So können wir sichtbar werden und uns für unsere Belange effektiv einsetzen. Für den einzelnen erweitert es den Horizont, denn wir alle können voneinander lernen.
Päßler O: Erklärtes Ziel: Schulterschluss aller Chirurginnen und Chirurgen in allen Regionen Deutschlands. Passion Chirurgie. 2026 Januar/Februar; 16(01/02): Artikel 07_03.