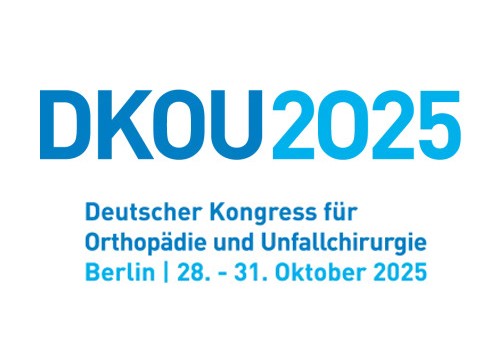Die Kinder- und Jugendmedizin steht vor einer spannenden, aber auch sensiblen Transformation. Künstliche Intelligenz (KI) verspricht nicht weniger als eine bessere Diagnostik, präzisere Planung, effizientere Abläufe und letztlich sicherere Behandlungen für junge Patientinnen und Patienten.
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in der Kinder- und Jungendmedizin zunehmend an Bedeutung. Speziell in der Kinderchirurgie kann die KI durch Datensammlung und -auswertung bei der Forschung und Entwicklung von Behandlung seltener Krankheiten/Erkrankungen sehr hilfreich sein.
Als zentrale operative Bereiche werden die Notfallversorgung und die stationäre Versorgung identifiziert mit ihren potenziellen Auswirkungen:
Stellenwert der KI in der Kinder- Notfallambulanz
Im klinischen Alltag unterstützt KI in der notfallärztlichen Kinderversorgung bereits bei schneller Risikobewertung, Entscheidungsunterstützung, Bildbefundung, Telemedizin und Ressourcenmanagement. Ziel ist eine schnellere, konsistente Versorgung ohne Ersetzen der klinischen Expertise.
So kann der initiale Einsatz der KI mit der Eingabe der Patientendaten und der Anamnese beginnen. Vergleichbar mit den Gesundheits-Apps, die auf dem Markt sind. Ziel ist es, dadurch sehr viele Unterstützungsprozesse in Gang zu setzen:
1) Schnelle Risikostratifizierung (Triagierung)
2) Bildgebungsgestützte Vorab-Bewertung
3) Ressourcen- und Kapazitätsmanagement
4) Dokumentation und Nachverfolgung
Stellenwert der KI in der stationären Versorgung
Die KI unterstützt die Ärzte in der praestationären Planung ebenso wie in der stationären Versorgung:
1) Unterstützung in der Anamneseerhebung und Planung der Diagnostik
2) Intraoperative Unterstützung (Kinderchirurgie)
3) Postoperative Überwachung und Klinikmanagement (Kinderchirurgie)
Fazit
KI bietet in der Kinder- und Jugendmedizin enormes Potenzial, Patientensicherheit zu erhöhen, Effizienz zu steigern und die Behandlungsqualität zu verbessern. Erfolgreich ist sie jedoch nur, wenn KI-Systeme verantwortungsvoll eingeführt werden: mit klarem Fokus auf Transparenz, menschlicher Überprüfung, lokaler Validierung und robusten Datenschutzmechanismen. So wird KI zu einem verlässlichen Partner im Dienste der jungen Patientinnen und Patienten – unterstützt durch Ärztinnen und Ärzte, die Verantwortung, Fachwissen und Empathie vereinen.
Autor: Dr. Joachim Suß, Chefarzt für Kinderchiurgie am Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift Hamburg
www.dgkjch.de