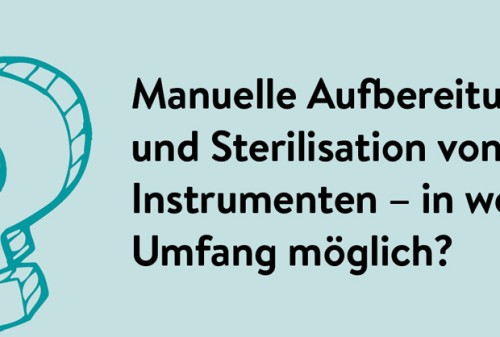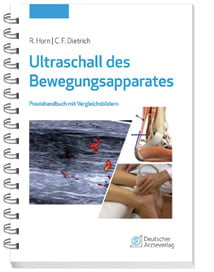Der BDC hat sich im Jahr 2023 wieder mit insgesamt vier sehr gut besuchten berufspolitischen Sitzungen am Bundeskongress Chirurgie (10./11.02.2023) in Nürnberg beteiligt. Hier folgt ein kleiner Bericht über die BDC-Sitzungen auf dem Kongress.
Sitzung Neuigkeiten bei der Gebührenordnung
Den Auftakt am Freitagmorgen machte die Darstellung der aktuellen Entwicklungen der Gebührenordnungen durch die beiden BDC-Vizepräsidenten. Dr. Jörg-A. Rüggeberg stellte zunächst die Grundzüge der Zusammenlegung der Kapitel 7 (Chirurgie) und 18 (Orthopädie) in ein gemeinsames neues Kapitel 7 dar. In Zukunft wird die Abrechnung der Grundleistungen, z. B. auch der Verbände, für alle Säulen gemäß Weiterbildungsordnung möglich sein. Für die speziellen Leistungen werden für alle Säulen außer der Herzchirurgie eigene Kapitel geschaffen, darüber hinaus auch eine Zusatzpauschale für die Handchirurgie. Zukünftig wird zwischen einer einmaligen Diagnostikleistung und mehrfach abrechenbaren und auch delegierbaren Therapieleistungen differenziert. Im Behandlungsfall können maximal zwei Komplexe nebeneinander abgerechnet werden. Der BDC hat sich sehr dafür stark gemacht, dass Allgemeinchirurgen auch die Diagnostik von degenerativen Erkrankungen der Bewegungsorgane abrechnen können, allerdings nur, wenn sie mindestens 42 Monate Weiterbildung in Orthopädie und Unfallchirurgie nachweisen können.
Das neue Kapitel ist in der KBV abgestimmt, muss aber noch mit den Krankenkassen verhandelt werden, sodass noch Änderungen zu erwarten sind. Sobald das neue Kapitel final verabschiedet ist, wird der BDC dazu Schulungsseminare anbieten.
Die Honorar-Abwertung der sehr häufigen ambulanten Operationen der Kategorien 1 und 2 sorgte bei den ambulanten Operateuren für berechtigten Unmut. Damit wurde allerdings schließlich der Uralt-Beschluss aus dem Jahr 2012 zur kostenneutralen EBM-Reform endgültig umgesetzt. „Dies eröffnet für die nahe Zukunft die Chance, endlich substanzielle Honorarverbesserungen für die ambulanten Operationen (AOP) aufgrund einer betriebswirtschaftlich kalkulierten und an die aktuellen Hygienevorgaben angepassten Berechnung zu erreichen“, betonte Dr. Peter Kalbe.
Ausgewählte höherwertige Eingriffe werden seit dem Januar mit 60 Millionen Euro zusätzlichem Honorarvolumen gefördert, wodurch z. B. ambulante Hernien-Operationen bis zu 40 Prozent höher bewertet sind. Außerdem wurden einzelne Eingriffe zusätzlich in den Anhang 2 des EBM aufgenommen. Die neu geschaffene Möglichkeit der verlängerten Nachbeobachtung ermöglicht jetzt eine postoperative Betreuung bis zu 16 Stunden und damit in Einzelfällen auch eine Behandlung über die Mitternachtsgrenze hinaus. Weiterhin wurden als Einstieg in eine schweregradabhängige Vergütung eine Aufschlagsziffer für Rezidiv-Operationen eingeführt. Der BDC ist über den „Workshop AOP“ der KBV aktiv an der weiteren Fortentwicklung beteiligt, die vor allem die massiv gestiegenen Hygienekosten berücksichtigen soll.

Abb. 1: Dr. Rüggeberg (re.) und Dr. Kalbe in der Sitzung
Bezüglich der GOÄ-Reform wies Dr. Rüggeberg darauf hin, dass in dieser Wahlperiode des Bundestags schon allein aus politischen Gründen nicht mit einer Umsetzung zu rechnen ist. Die Bewertung der einzelnen Honorarpositionen ist zwischen Bundesärztekammer (BÄK) und PKV-Verband bis auf Details weitgehend konsentiert. Zurzeit wird eine Stichprobe einzelner Rechnungen als Prognose zu erwartender Änderungen analysiert. Bei einer anhaltenden Weigerung des Bundesgesundheitsministeriums, die Reform-GOÄ umzusetzen, will die BÄK alternativ die regelhafte Ansetzung der maximalen Steigerungsfaktoren und die vermehrte Abdingung propagieren. Der BDC war und ist an den weiteren GOÄ-Reformschritten beteiligt.

Abb. 2: Frau Haisler und Dr. Kalbe am BDC-Stand
Im Gegensatz zur Privat-GOÄ wird die UV-GOÄ zur Abrechnung mit den Berufsgenossenschaften fortlaufend weiterentwickelt. Die Durchgangsärzte sollten sich daher regelmäßig auf der Homepage der KBV über den aktuellen Stand informieren. Zum Januar 2023 wurde eine mit 35,00 Euro dotierte Zuschlagsziffer (UV-GOÄ Nr. 411) für die sonografische Frakturkontrolle eingeführt, um die Frequenz von Röntgenkontrollen bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren. Die Zuschläge für das ambulante Operieren (Nrn. 442- 445) wurden um 10 Prozent angehoben und die Gebühr für den Durchgangsarztbericht als zentrale Leistung des D-Arzt-Verfahrens auf 20,00 Euro angehoben. Die Leistungen für telemedizinischen Beratungen nach den Nrn. 10 und 10a dürften in der unfallchirurgischen Behandlung nur selten zum Zuge kommen.
Es wurde allgemein besonders begrüßt, dass Frau Claudia Haisler von der DGUV an der Sitzung teilnahm und die Wünsche der teilnehmenden Chirurgen insbesondere nach einer Verbesserung der Honorare für das ambulante Operieren und für aufwändige Beratungsleistungen mitnahm. Der BDC ist in Person von Dr. Kalbe an den regelmäßigen Beratungen der Gebührenkommission nach § 52 des Ärztevertrages beteiligt.
Sitzung Sektorenverbindende Versorgung
Dr. Arndt Voigtsberger aus Sondershausen bot zu Beginn einen Überblick über die aktuellen politischen Initiativen und stellte dabei vor allem die Quintessenz des IGES-Gutachtens vor. Er ging dann auch ausführlich auf die Systematik der geplanten Krankenhausstrukturreform mit drei bundeseinheitlichen Leveln und 128 Leistungsgruppen mit Strukturvorgaben ein. Insbesondere im Level 1i wird eine sektorenverbindende Kooperation der regional vorhandenen medizinischen Ressourcen unerlässlich werden. Es ist noch vollkommen unklar, unter welchen finanziellen Bedingungen dies für niedergelassene Ärzte attraktiv gestaltet werden kann. Es können sich hierdurch aber Chancen für eine gemeinsame Nutzung vorhandener Strukturen ergeben, die auch für ambulante Operationen genutzt werden können, unter Umständen auch mit erhöhtem und verlängertem Betreuungsbedarf.
Rechtsanwalt Oliver Butzmann aus der Kanzlei Dr. Heberer hob darauf ab, dass sich die Erfahrungen auf die Anwendung geltenden Rechts und auf konkrete Fälle der Mandanten beschränken. Im Vordergrund juristischer Verfahren stehe nach wie vor das Risiko eines Vorwurfs der Bestechlichkeit durch Zuweisung gegen Entgelt. Er beurteilte verschiedene Kooperationsmodelle unter dem Aspekt des Antikorruptionsgesetzes und berichtete, dass die befürchtete Klagewelle nach Einführung der Paragraphen 299 und 300 des Strafgesetzbuchs nicht eingetreten sei. Gleichwohl müssten Kooperationsverträge unter diesen Aspekten juristisch bewertet werden, um diese Risiken gering zu halten oder auszuschließen.
Dr. Stephan Dittrich hat in Deutschland die größte praktische Erfahrung mit Hybrid-DRGs aus dem Modellprojekt mit der Techniker Krankenkasse und dem BDC in Thüringen. Er stellte die Bedeutung eines definierten Behandlungspfads und die Gewährleistung einer einheitlichen Qualität bei allen Beteiligten heraus. Im Modellprojekt wurde darauf geachtet, möglichst wenige Fremdleistungen in die Pauschalen einzubeziehen, um die Komplexität der Berechnung zu begrenzen. Die bisherigen Erfahrungen ergaben eine hohe Zufriedenheit der beteiligten Chirurgen und Krankenhäuser sowie der behandelten Patienten. Dr. Dittrich wurde aufgrund seiner Erfahrungen als Berater für die Neugestaltung der Hybrid-DRGs gemäß § 115f SGB V hinzugezogen. Die Expertise des BDC ist somit vertreten.
Dirk Farghal sah in seinem abschließenden Vortrag durchaus neue Chancen für die belegärztlichen Kollegen im Rahmen der anstehenden Krankenhausreform. Für die sektorenverbindende Tätigkeit in den Level-1i-Krankenhäusern würde sich die belegärztliche Tätigkeit in vielen verschiedenen Fachbereichen geradezu aufdrängen. Als Zukunftsaufgabe der stationären Strukturen sieht Herr Farghal vor allem alle Notfallbehandlungen, während die elektive Chirurgie sich eher auf den ambulanten und belegärztlichen Bereich konzentrieren würde. Er ist als Delegierter des BDC auch im Beirat des Bundesverbands der Belegärzte tätig.
Sitzung Wandel im Berufsbild der niedergelassenen Chirurgen – nur noch angestellte Ärzte und MVZ?
Der BDC Vizepräsident Dr. Peter Kalbe führte zunächst mit Zahlen und Beispielen zum Thema ein. Die KBV-Statistik zeigt, dass immer mehr junge Chirurginnen und Chirurgen nur im Angestelltenstatus und sehr häufig auch auf Teilzeitstellen arbeiten. Vom Nachwuchs wird der Tätigkeit in kollegialen Strukturen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein hoher Stellenwert beigemessen. Diese Forderungen lassen sich in einer chirurgischen Einzelpraxis nur schwerlich umsetzen. Der bundesweite Trend geht zu Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) und zu MVZ, die Einzelpraxis überwiegt aber noch zahlenmäßig. Zum Anteil investorengeführter MVZs gibt es keine eindeutigen Indikatoren. Die vorhandenen Zahlen sprechen für einen prozentualen Anteil an allen MVZs im niedrigen einstelligen Bereich. Trotzdem sorgt dieses Thema für große mediale Aufmerksamkeit und gesetzgeberische Initiativen. Beim DKOU im Oktober 2022 haben sich die großen Player im orthopädischen Bereich (Helios, Kinios und Atos) selbstbewusst und positiv präsentiert. Der BDC empfiehlt seinen Mitgliedern seit vielen Jahren, Kooperation mit anderen Kollegen und mit Krankenhäusern anzustreben, wenn sich die Chance dazu bietet.
Dr. Susanne Armbruster präsentierte die Position der KBV zu MVZs und riet ebenfalls zu einer differenzierten Betrachtung. Sie erinnerte an die eigentliche Zielsetzung der MVZ-Struktur und stellte die zahlreichen strukturellen Änderungen seit 2004 dar. Aktuell stellen Chirurgen und Orthopäden die zweitgrößte Fachgruppe der in MVZs tätigen Ärzte nach den Hausärzten. Die KBV betrachtet den zunehmenden Einfluss von Investoren ebenfalls mit Sorge und verspricht sich Verbesserungen vor allem durch die im Gutachten von Professor Andreas Ladurner für das Gesundheitsministerium erarbeiteten Maßnahmen. Armbruster und Kalbe waren sich einig, dass in allen Strukturen vor allem die Stellung der ärztlichen Leiter gestärkt und die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen von ökonomischen Interessen gewährleistet werden muss.
Abschließend hatten noch die Repräsentanten von zwei „Aufkäufern“ die Gelegenheit, ihre Aktivitäten darzustellen. Alexander Zauter von der Atos-Gruppe stellte verschiedene Kooperationsmodelle vom „Joint Venture“ über den partiellen und vollen Anteilskauf vor. Der Fokus der Atos-Gruppe liege auf der hochqualitativen elektiven orthopädischen Chirurgie und ökonomische Einflussnahme würde allenfalls im kollegialen Diskurs erfolgen. Bei Übernahme werde auf einen sanften Übergang unter langfristiger Erhaltung bewährter Strukturen geachtet.

Abb. 3: BDC-Stand beim BCH mit Dr. Rüggeberg (li.) und Dr. Kalbe
Abschließend beantwortete der Chirurg Dr. Christoph Haenisch als Mitglied der Geschäftsführung der 360°-Gruppe die Frage, ob die chirurgische Einzelpraxis noch eine Zukunft habe, eindeutig und sehr pointiert mit „Nein“. Er wies zur Begründung vor allem auf die umfangreichen und stetig wachsenden Verwaltungsaufgaben einer Praxis hin, die sich im Verbund und ab einer gewissen Praxis-Größe auch mit einem professionellen Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin optimieren ließen. Als Beispiel nannte er die Umsetzung der jetzt verpflichtenden elektronischen Arbeitszeiterfassung. Dies löste vehementen Protest der anwesenden Chirurgen aus Einzelpraxen aus, die sehr wohl fähig seien, all dies umzusetzen. Die anschließende lebhafte Diskussion zeigte denn auch, dass sich die Kolleginnen und Kollegen auch als Einzelkämpfer in der Lage sehen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Der BDC vertritt dazu die Auffassung, dass unabhängig von den Praxis- oder BAG/MVZ-Strukturen vor allem die chirurgische Grundversorgung gewährleistet werden muss. Dies sollte auch bei der Bedarfsplanung und bei den Entscheidungen der Zulassungsausschüsse Berücksichtigung finden.
Sitzung Gefäßchirurgie in Deutschland heute und morgen
Dr. Sven Gregor stellte als niedergelassener Gefäßspezialist dar, dass grundsätzlich auch höherwertige Gefäßoperationen, z. B. in der Carotis-Chirurgie, grundsätzlich technisch ambulant durchführbar wären, dies jedoch vor allem aus medizinischen Sicherheitserwägungen keinen Sinn habe. In weiten Bereichen ist die Gefäßchirurgie von endoluminalen Interventionen abgelöst worden. Die Varizenchirurgie kann nach Einschätzung von Dr. Gregor regelhaft ambulant erfolgen und wird heute meist auch endoluminal durchgeführt. Einziges Hindernis einer weitergehenden Ambulantisierung ist die unzureichende Vergütung im EBM. Alternativen sind i. v. Verträge nach § 140 SGB V. Hier seien Ergänzungen im Anhang 1 des EBM erforderlich. Entscheidend für den Operationserfolg ist nach seiner Einschätzung weniger der Ort der Leistungserbringung, sondern es zählen vielmehr die Qualität der chirurgischen Arbeit, die Infrastruktur und die Ausstattung im Operationssaal.
Professor Markus Steinbauer bot einen Überblick über die Organisationsstruktur seiner gefäßchirurgischen Klinik in Regensburg. Er stellte vor allem dar, welchen immensen Aufwand die Implementierung von geeigneten Strukturen für ambulante Operationen in den Kliniken bedeutet. Im Zuge der anstehenden Krankenhausreform wird die Kooperation der Klinik mit dem ambulanten Versorgungsbereich immer wichtiger. Er plädierte für u. a. für transsektorale Zentrumsstrukturen und für „Wundnetze“. Er hob auch auf das Problem des zunehmenden Fachkräftemangels ab. Darüber hinaus wird es immer schwieriger, eine umfassende Weiterbildung für die nachrückende Generation von Gefäßchirurgen zu gewährleisten. Er konnte zeigen, dass durch eine gute Organisation attraktive Weiterbildungsstellen geschaffen werden können, sodass er zurzeit keinen Mangel an Assistenzärzten bzw. -ärztinnen hat.
Dr. Martin Krajci betreibt in Erfurt gemeinsam mit chirurgischen Kollegen ein Venen- und Op.-Zentrum. Er stellte noch einmal ausführlich die Ergebnisse des IGES-Gutachtens dar und die bisher nur rudimentäre Umsetzung durch die ersten Schritte der EBM-Reform. Dr. Krajci pflegt vor Ort eine enge Kooperation mit einem Krankenhaus, betonte aber ebenfalls, dass die Venenchirurgie heute keine stationäre Leistung mehr sei und sehr häufig vom MD regressiert werde.
Abschließend forderte Dr. Kerstin Schick die Gefäßchirurgen auf, mutig und aktiv die eigene Versorgungsqualität darzustellen. Sie stellte das gemeinsame Qualitätssiegel der Fachgesellschaft und des Berufsverbands der Phlebologen vor und forderte eine weitergehende Implementierung ähnlicher Qualitätssiegel auch für andere chirurgische Spezialisierungen zum Zweck des Marketings. Diese Forderung wurde in der anschließenden Diskussion kontrovers diskutiert und es wurde vor allem die Problematik schlechter Bewertungen auf den Arzt-Portalen bemängelt. Der Umgang der anwesenden Chirurginnen und Chirurgen mit negativen Arzt-Bewertungen variiert zwischen Gelassenheit und juristischen Gegenmaßnahmen.
Der BDC bietet Seminare zum Thema „Praxis-Optimierung“ an, Infos erhalten Sie über die BDC|Akademie.
Kalbe P: BDC-Sitzungen beim gemeinsamen Bundeskongress Chirurgie (BCH). Passion Chirurgie. 2023 Juni; 13(06): Artikel 03_03.