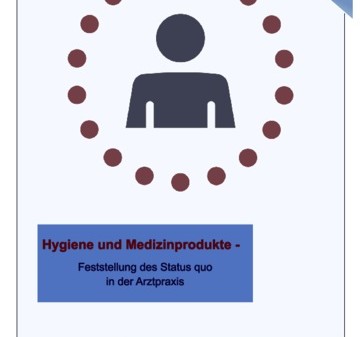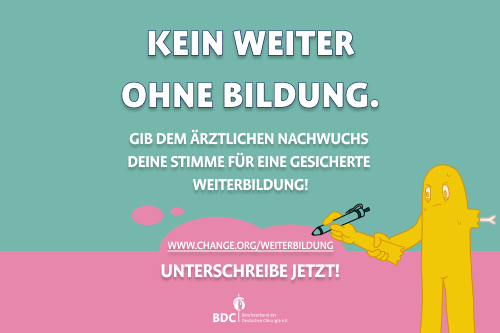In Deutschland wird im internationalen Vergleich zu viel operiert. Darauf macht die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie e.V. (DGCH) anlässlich des Welttags der Patientensicherheit aufmerksam, der am 17. September 2024 zum Thema „Diagnosesicherheit“ stattfindet. „Für die Chirurgie bedeutet das Indikationssicherheit, also die Frage, ob eine Operation tatsächlich angezeigt ist“, sagt DGCH-Generalsekretär Professor Dr. med. Thomas Schmitz-Rixen. Um die Indikationssicherheit zu erhöhen, raten DGCH-Experten zur Ausdehnung des Zweitmeinungsverfahrens, zu höherwertigen Studien und mehr Empowerment auf Seite der Patientinnen und Patienten.
In Deutschland wird – ebenso wie in den USA – in vielen Bereichen nach wie vor oft unnötig operiert, ohne eindeutige Indikation. „Die Gründe dafür liegen häufig im ökonomischen Druck, der mit dem Erreichen bestimmter Mindestmengen-Vorgaben oder Fallzahlen verbunden ist“, so Schmitz-Rixen. Um Patientinnen und Patienten vor unnötigen Behandlungen zu schützen, besteht daher seit 2019 für eine Reihe planbarer Eingriffe und Operationen ein gesetzlicher Anspruch auf ein geregeltes ärztliches Zweitmeinungsverfahren, das die Kassen übernehmen. Die Liste der zweitmeinungsberechtigten Eingriffe wird laufend erweitert – zuletzt im Juli um Eingriffe am Hüftgelenk, ab Oktober um geplante Eingriffe an Aortenaneurysmen.
„Aortenaneurysmen werden häufig unnötig operiert“, bestätigt Schmitz-Rixen. Zwar empfehlen die Leitlinien, erst ab einer Aortaausdehnung von mehr als 5,5 Zentimetern zu operieren. „Wir liegen in Deutschland aber im Durchschnitt statistisch gesehen bei 5,5 Zentimetern und gehen davon aus, dass in 40 Prozent der Fälle außerhalb der Leitlinie operiert wird“, so Schmitz-Rixen. Auch bei vergleichsweise einfachen Eingriffen gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. „Patientinnen und Patienten mit rechtsseitigen Unterbauchschmerzen werden in Deutschland viel häufiger operiert als in anderen Ländern“, berichtet DGCH-Präsident Professor Dr. med. Udo Rolle. Während eine akute Blinddarmentzündung sofort operiert werden muss, kann bei einer unkomplizierten Appendizitis als Alternative auch eine Behandlung mit Antibiotika in Betracht gezogen werden.
Zwar haben gesetzlich Versicherte im Rahmen der freien Arztwahl immer die Möglichkeit, mit einer hausärztlichen Überweisung einen weiteren Facharzt oder Fachärztin zu konsultieren, um eine zweite Meinung zu einer vorgeschlagenen Behandlung, Untersuchung oder Operation einzuholen. Dennoch empfehlen die DGCH-Experten, die strukturierten gesetzlichen Zweitmeinungsverfahren zu erweitern. „Dies sollte der Fall sein vor allem für schwerwiegende und lebensverändernde Operationen etwa an Bauchspeicheldrüse, Speiseröhre oder Mastdarm“, meint Schmitz-Rixen. „Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit, sofern es sich nicht um akute Erkrankungen handelt, die sofort behandelt werden müssen“, ergänzt Rolle. Wer eine Zweitmeinung einholen möchte, sollte den behandelnden Arzt oder Ärztin darüber informieren und sie bitten, Befunde, Berichte, Laborwerte und Ergebnisse von Röntgenuntersuchungen auszuhändigen.
Zwei weitere Ansätze sehen die DGCH-Experten, um die Indikationssicherheit zu erhöhen. „Leitlinien sind ein wichtiges Instrument“, so Schmitz-Rixen. „Aber Leitlinien sind nur so gut wie die Evidenz, auf der sie beruhen, und es gibt zu wenig prospektiv-randomisierte Studien.“ Häufig fehle auch der Bezug zur Ergebnisqualität, „Wir benötigen eine höherwertige Studienkultur und mehr Versorgungsforschung“, kritisiert Schmitz-Rixen. Schließlich könnten auch Patientinnen und Patienten selbst zur sicheren Versorgung beitragen. „Wir möchten Betroffene ermuntern, sich über Diagnose und Behandlung zu informieren, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern und ihre Meinung kundzutun. Zusätzlich können Patientinnen und Patienten sich aktiv an klinischen Studien in der Versorgungsforschung beteiligen“, erklärt Rolle. „Die angeführten Maßnahmen werden sicherlich dazu führen, dass die immer noch erhebliche Zahl von Behandlungsfehlern deutlich reduziert werden kann“, subsummiert Professor Dr. med. Dr. med. h.c. Hans-Joachim Meyer, Präsident des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgie (BDC). „Dieses gilt auch für die Empfehlungen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, denen sich von Seiten des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgie auch in aller Regel vollständig angeschlossen wird.“
Der Welttag der Patientensicherheit ist einer der globalen Gesundheitstage der WHO. Er wurden 2019 auf Initiative des Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) auf den 17. September festgesetzt. Das diesjährige Motto lautet: „Sichere Diagnose. Richtige Behandlung. Gemeinsam für Diagnosesicherheit“. Das APS ruft bundesweit Mitarbeitende und Institutionen im Gesundheitswesen auf, sich mit Aktionen rund um den 17. September zu beteiligen. Alle Aktionen sind unter www.tag-der-patientensicherheit.de gelistet. Um ein Signal für mehr Patientensicherheit zu setzen, sollen außerdem am 17. September Fassaden in Orange leuchten.
Quelle: DGCH