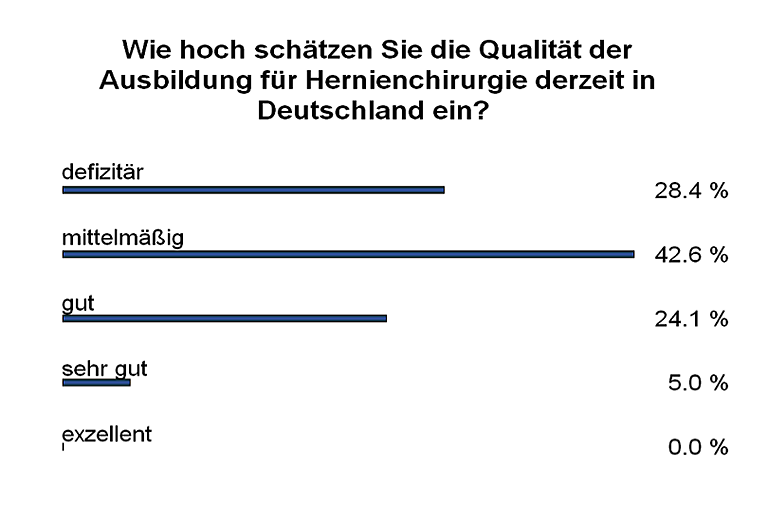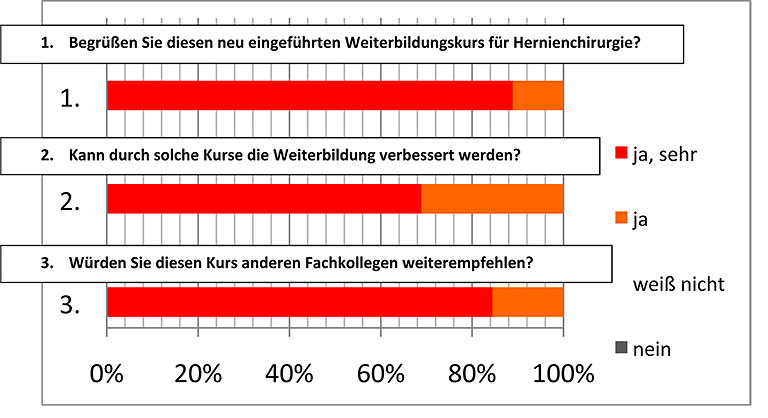Vor genau 100 Jahren gründete Albert Schweitzer sein Urwaldhospital in Lambarene in Gabun – ein wunderbarer aktueller Anlass über einen Arbeitsplatz in Entwicklungsländern nachzudenken.
Viel mehr chirurgische Kollegen als Sie glauben leisten bereits heute einen persönlichen aktiven Beitrag, um das globale Ungleichgewicht wenigstens minimal auszugleichen. Jede Einzelaktion ist einerseits zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aus dem mit Ihrer persönlichen Hilfe jedoch ein Strom entstehen kann.
Insbesondere auch nach Beendigung der aktiven Chirurgenlaufbahn ist ein Einsatz im Ausland eine hervorragende Möglichkeit, die lebenslang gesammelten beruflichen Erfahrungen auch an jüngere Kollegen weiterzugeben. Während Sie diesen Artikel lesen, bereitet sich beispielsweise ein im Ruhestand befindlicher niedergelassener Chirurg aus Berlin auf seinen dreimonatigen Einsatz in Malawi vor. Er wird dort das Team eines Versorgungskrankenhauses unterstützen und zusätzlich jüngere Kollegen ausbilden.
In diesem Artikel will ich Ihnen nicht nur einen Überblick über die Möglichkeiten der humanitären Hilfe geben, sondern auch über die Bedingungen, Fallstricke und das Arbeitsumfeld für Chirurgen in Entwicklungsländern berichten. Lesen Sie im Folgenden die häufigsten Fragen zum Thema „Arbeitsplatz Entwicklungsland“.
Welche Anforderungen sollte ein Chirurg für diesen Arbeitsplatz in Entwicklungsländern erfüllen?
Sicher sollte ein Chirurg Entdeckerfreude, Zielstrebigkeit, Improvisationstalent, Anpassungsfähigkeit und eine gewisse Furchtlosigkeit für einen Arbeitsplatz in Entwicklungsländern mitbringen. Bereits Albert Schweitzer musste für seine Vision der Gründung eines Missionskrankenhauses in Gabun Beharrlichkeit beweisen. So soll er erst nach längerer Zeit aufgrund einer Sondergenehmigung zum Medizinstudium zugelassen worden sein, da er zu diesem Zeitpunkt bereits als Dozent für Theologie an der Universität Strassburg tätig war. Eine breite Kenntnis auf dem Gebiet der Allgemein- und Unfallchirurgie ist generell von Vorteil. Da der häufigste operative Eingriff z. B. in Afrika der Kaiserschnitt ist, ist es sicher sinnvoll, sich ein paar gynäkologische Grundkenntnisse auch über geburtshilfliche Notfälle anzueignen. Durchaus kontrovers kann man die von einigen Hilfsorganisationen empfohlene Zusatzausbildung Public Health beurteilen. Für die eigentliche medizinische Arbeit vor Ort ist sie meines Erachtens nicht nötig.
Notwendig sind in jedem Falle englische und/oder französische Sprachkenntnisse. Auch sind vorherige Urlaubsreisen in Entwicklungsländer von Vorteil, um Infrastruktur, Menschen und Kultur besser zu begreifen.
Zahlreiche nationale und internationale Hilfsorganisationen existieren heutzutage. Es gibt NGO (non-governmental organisations), die vorwiegend in Krisengebieten agieren (z. B. Ärzte ohne Grenzen). Hier ist vorwiegend der breit ausgebildete Allround-Chirurg gefragt.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich einer fachspezialisierten internationalen Hilfsorganisation wie zum Beispiel Operationhernia (siehe Link am Ende des Artikels) anzuschließen. Hier wird der erfahrene Hernienchirurg solche Patienten operieren, mit denen er auch im eigenen Lande die größte Erfahrung hat. Prof. Andrew Kingsnorth und Chris Oppong aus Plymouth in England begründeten diese Organisation in Jahre 2006. Begann man damals nur mit humanitären Einsätzen in Ghana sind zwischenzeitlich zahlreiche internationale Teams auch für kürzere ein- bis zweiwöchige Missionen in vielen Entwicklungsländern vor allem Afrikas, aber auch in Asien und Südamerika engagiert.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche kirchliche Organisationen (z. B.: Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst (EED), Bischöfliches Hilfswerk Misereor) und zahlreiche Stiftungen (z. B. Alexander von Humboldt- Stiftung, Heinrich Böll-Stiftung, Friedrich Ebert-Stiftung, Konrad Adenauer-Stiftung), die entsprechende Kontakte vermitteln.
Warum sollte ich gerade in ein Entwicklungsland gehen?
Der Mangel an Ärzten in Entwicklungsländern ist bereits jetzt enorm. Die UNESCO beziffert heute 57 Länder mit kritischer Unterversorgung im Gesundheitswesen. Von diesen befinden sich 37 in Afrika [1].
Die Gesundheitsversorgung wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten jedoch keinesfalls verbessern. Diese wird sich durch das sogenannte brain drain (Abwanderung von Akademikern aus den Entwicklungsländern in hochentwickelte Industrieländer) und die weitere Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern sogar noch weiter dramatisch verschlechtern.
Wie ist die ärztliche Versorgung in den Krankenhäusern der Entwicklungsländer?
Es gibt erhebliche Unterschiede in den einzelnen Entwicklungsländern und zusätzlich regional. Auch wenn die Spanne weit reicht, ist sie generell mit einer europäischen medizinischen Versorgung (siehe Tab. 1) nicht zu vergleichen.
Tab. 1: Auszug aus World Health Statistics 2012 – Ausgewählte Länder [2]
| Land | Bevölkerung in Mio. Einwohner | Ärzte Anzahl absolut | Ärzte/10.000 Einwohner | Kranken-schwestern Anzahl absolut | Kranken-schwestern/ 10.000 Einwohner |
| Deutschland | 82,3 | 297.835 | 36,0 | 918.000 | 111,0 |
| Nigeria | 158,4 | 55.376 | 4,0 | 224.943 | 16,1 |
| Ghana | 24,4 | 2033 | 0,9 | 24.974 | 10,4 |
| Malawi | 14,9 | 257 | 0,2 | 3896 | 2,8 |
| Ruanda | 10,6 | 221 | 0,2 | 4050 | 4,5 |
| Liberia | 4,0 | 51 | 0,1 | 978 | 2,7 |
In den meisten Krankenhäusern z. B. in Westafrika gibt es lediglich einen einzigen praktischen Arzt, der das gesamte Krankenhaus betreut und leitet. Dieser ist dann gleichermaßen für die Behandlung aller häufigen Infektionskrankheiten wie Malaria und Tuberkulose, für die Versorgung von Notfällen und Unfällen, für die Durchführung von Operationen z. B. Appendektomien und Herniotomien, aber auch für Entbindungen und Kaiserschnitte zuständig. Krankenschwestern übernehmen hier recht häufig auch ärztliche Tätigkeiten, die in unserem Gesundheitssystem völlig undenkbar wären. Urlaubs- oder Vertretungsregelungen entfallen. So kann es schon mal vorkommen (wie selbst in Ghana erlebt), dass eine frisch examinierte Anästhesieschwester ohne jegliche Berufserfahrung für die Durchführung einer Narkose alleinig zuständig ist. Entgegen so mancher Vorurteile habe ich sehr oft ein hochmotiviertes und engagiertes medizinisches Personal erleben dürfen.
Welche Patienten erwarten mich in Entwicklungsländern?
Sie sollten Patienten mit oftmals sehr ausgeprägten Krankheitsbildern erwarten, welche meist über Jahre bisher medizinisch unversorgt blieben. Die Leidensfähigkeit und Geduld der Patienten beeindruckt fast ebenso wie die unglaubliche und emotional berührende Dankbarkeit nach erfolgter Therapie. Es gibt darüber hinaus zahlreiche Erkrankungen, die unseren Breiten völlig unbekannt sind. Andere bei uns häufige Erkrankungen spielen im Gegenzug in Entwicklungsländern kaum eine oder gar keine Rolle. Auf die Infektionswege und Ansteckungsmöglichkeiten sollte man stets achten. In vielen allerdings nicht in allen Hospitälern wird vor einer geplanten Operation ein Hepatitis- und/oder HIV-Test des zu operierenden Patienten obligat durchgeführt. Die Verwendung von doppelten Handschuhen und eines Augenschutzes helfen zusätzlich für die eigene Sicherheit während der Operationen.
Die Patientenakquise für einen kurzzeitigen humanitären Einsatz sollte vorab rechtzeitig in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Hilfsorganisation geplant werden. Meist werden die potentiellen Patienten über die regionalen Medien, wie Rundfunk und Zeitungen, informiert.
Welche Arbeitsbedingungen erwarten mich in den Krankenhäusern?
Die technische und apparative Ausstattung der Krankenhäuser ist von Land zu Land verschieden und auch regional sehr unterschiedlich, meist jedoch auf niedrigem Niveau. Die extremsten Unterschiede erlebte ich persönlich im Jahre 2010 auf Mauritius, wo sehr einfach ausgestattete staatliche Kliniken direkt neben, von zumeist indischen Investoren, bestausgestatteten Privatkliniken existierten.
 Abb. 3: Ein Op-Team bei der Arbeit vor Ort
Abb. 3: Ein Op-Team bei der Arbeit vor Ort
Meist sind die Kliniken in der Dritten Welt auf ausrangierte Geräte und Spenden aus den Industrieländern angewiesen. Stromausfälle und fehlende Notstromversorgung erschweren die Arbeitsbedingungen zum Teil erheblich. Es macht dennoch insgesamt durchaus viel Spaß, Medizin unter einfachen Bedingungen zu machen. Die Vorstellungen von Arbeitszeiten, Termineinhaltungen und Zuverlässigkeit sind kulturell unterschiedlich. Hier sollten Sensibilität und Kompromissbereitschaft aber auch Disziplin sich ergänzen und zielführend wirken.
Was wird in den Krankenhäusern der Entwicklungsländer benötigt?
Wir versuchen bei jedem geplanten humanitären Einsatz viele Dinge möglichst zum dortigen Verbleib mitzunehmen. Dazu ist es immer notwendig, in dem jeweiligen Krankenhaus anzufragen, was ggf. vorhanden und was benötigt wird. Für chirurgische Einsätze zählen hierzu Monitore, Elektrokautergeräte, einfache Autoklaven, chirurgische Instrumente, resterilisierbare OP- Abdeckungen und -kittel und natürlich sämtliche Verbrauchsmaterialien. So manches bestens funktionierendes allerdings in der deutschen Klinik durch ein neueres und besseres High-Tech-Gerät ersetztes findet so ein neues Zuhause. Hier kann der Kontakt zu den Medizinprodukteherstellern oft überraschende Spenden generieren. Damit jedoch das gespendete Gerät nicht wie so oft in irgendwelchen Abstellkammern afrikanischer Krankenhäuser verstaubt, sollten wirklich nur benötigte Geräte mitgeführt werden und ggf. auch Ersatzteile mitgenommen werden. Ansonsten könnte so manch gut gemeinte Gabe die Wirkung verfehlen oder gar gefährlich für das medizinische Personal oder Patienten werden [3].
 Abb. 4: Europäische und afrikanische Ärztinnen im OP
Abb. 4: Europäische und afrikanische Ärztinnen im OP
Versuchen Sie darüber hinaus immer auch Kontakt zu Ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen, um für das zu planende Übergepäck ggf. Sonderkonditionen zu verhandeln. Damit alles auch am rechten Ort ankommt scheint es immer sinnvoll zu sein, das gesamte Equipment mit dem eigenen Transport mitzuführen.
Welche bürokratischen Hürden gibt es zu beachten?
Über die entsprechende Hilfsorganisation sollten vorab Kontakte zu den entsprechenden Krankenhäusern bzw. regionalen Gesundheitsbehörden hergestellt werden, um eine Arbeitserlaubnis für alle Teammitglieder zu beantragen. Dieses offizielle Einladungsschreiben ist für den Visumantrag bzw. für die Einreise nötig. Darüber hinaus sollte für das mitgeführte medizinische Equipment über das zuständige Gesundheitsministerium eine Einfuhrgenehmigung bzw. Zollbescheinigung erwirkt werden. Auch hier helfen im Allgemeinen die Hilfsorganisationen.
Die Planung eines humanitären Einsatzes benötigt viel Zeit, ein Zeitfenster von bis zu sechs Monaten ist sinnvoll, um alles in Ruhe vorbereiten zu können.
Darüber hinaus benötigen Sie für einen solchen humanitären Einsatz natürlich finanzielle Mittel. Viele internationale Organisationen haben ihren Sitz nicht unbedingt in Deutschland, sodass diese für ggf. eingehende Spendengelder keine Spendenbescheinigung ausstellen können. Große Hilfsorganisationen haben darüber hinaus einen nicht geringen Verwaltungs- und Werbeaufwand.
Wir haben aus diesem Grund 2011 einen steuerbegünstigten, nicht eingetragenen Verein CHIRURGEN für Afrika gegründet, damit den Sponsoren garantiert werden kann, dass die Spendengelder fast ausschließlich für die Projektarbeit verwendet werden und darüber hinaus auch eine entsprechende Bescheinigung für das Finanzamt ausgestellt werden kann.
Vor der Abreise sollten Sie sich natürlich auch über empfohlene Impfungen informieren und Ihren Versicherungsschutz (z. B. Krankenversicherung, Rücktransportversicherung) prüfen.
Sind Sie dann schließlich mit ihrem Team und ihrem Material am Einsatzort angekommen werden Sie überrascht sein, dass man auch mit wenig Bürokratie gute Medizin machen kann. Sie werden sicher auch im eigenen Interesse ein OP-Buch führen. Weitere Formalitäten bestehen jedoch im Allgemeinen nicht. Das heißt, Sie müssen weder akribisch Patientenakten führen, OP-Einwilligungen ausführlich dokumentieren, OP-Berichte oder Entlassungsberichte schreiben, geschweige denn die in deutschen Krankenhäusern und Praxen allgegenwärtigen Versicherungsanfragen beantworten.
Sie werden nach einem solchen humanitären Auslandseinsatz stets geistig und emotional bereichert und vielleicht auch geerdet zurückkehren.
Habe ich Ihr Interesse für eine solche andersartige Erfahrung geweckt?
Literatur
[1] Policies and practices of countries that are experiencing a crisis in human resources for health: tracking survey Human Resources for Health Observer – Issue No. 6, December 2010 , WHO, http://www.who.int/hrh/resources/observer6/en/index.html
[2] World Health Statistics 2012, http://www.who.int/healthinfo 2012,
[3] Schäfer S. Medizinische Spenden können Armen schaden in Spiegel online 02.08.2012 http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/medizinische-geraete-zu-spenden-ist-als-entwicklungshilfe-ungeeignet-a-847181.html
Lorenz R. Arbeitsplatz Entwicklungsland: Albert Schweitzers next generation. Passion Chirurgie. 2013 Februar; 3(02): Artikel 02_05.