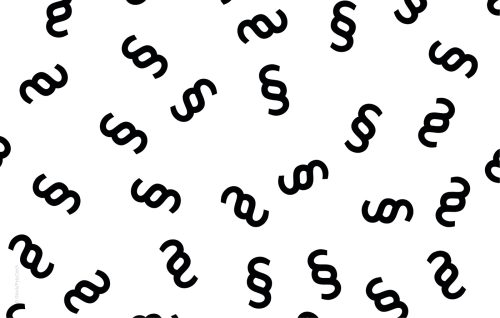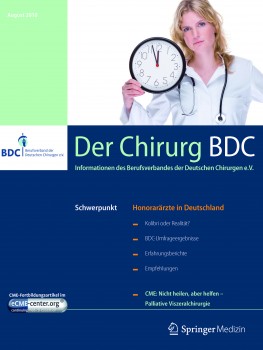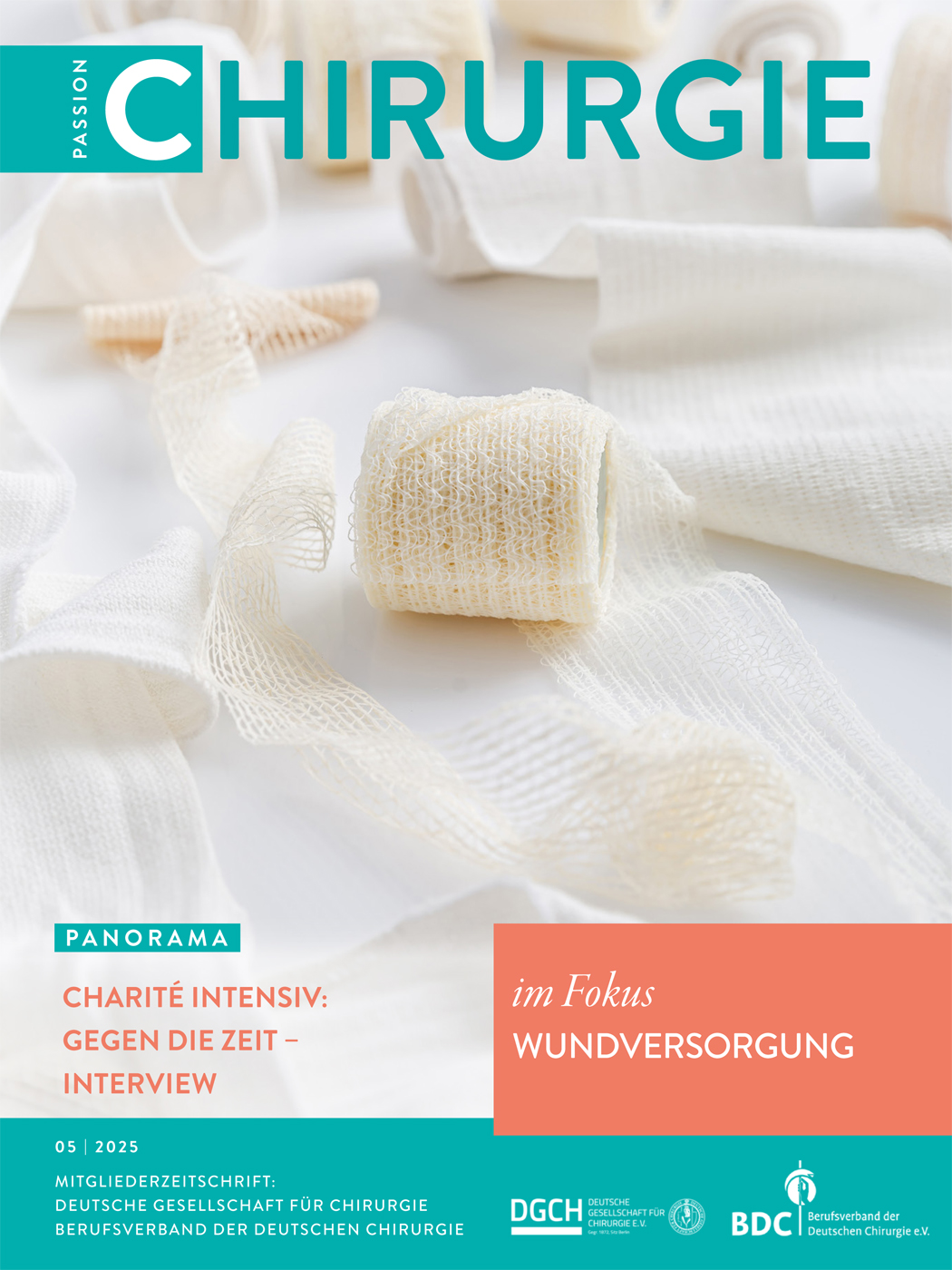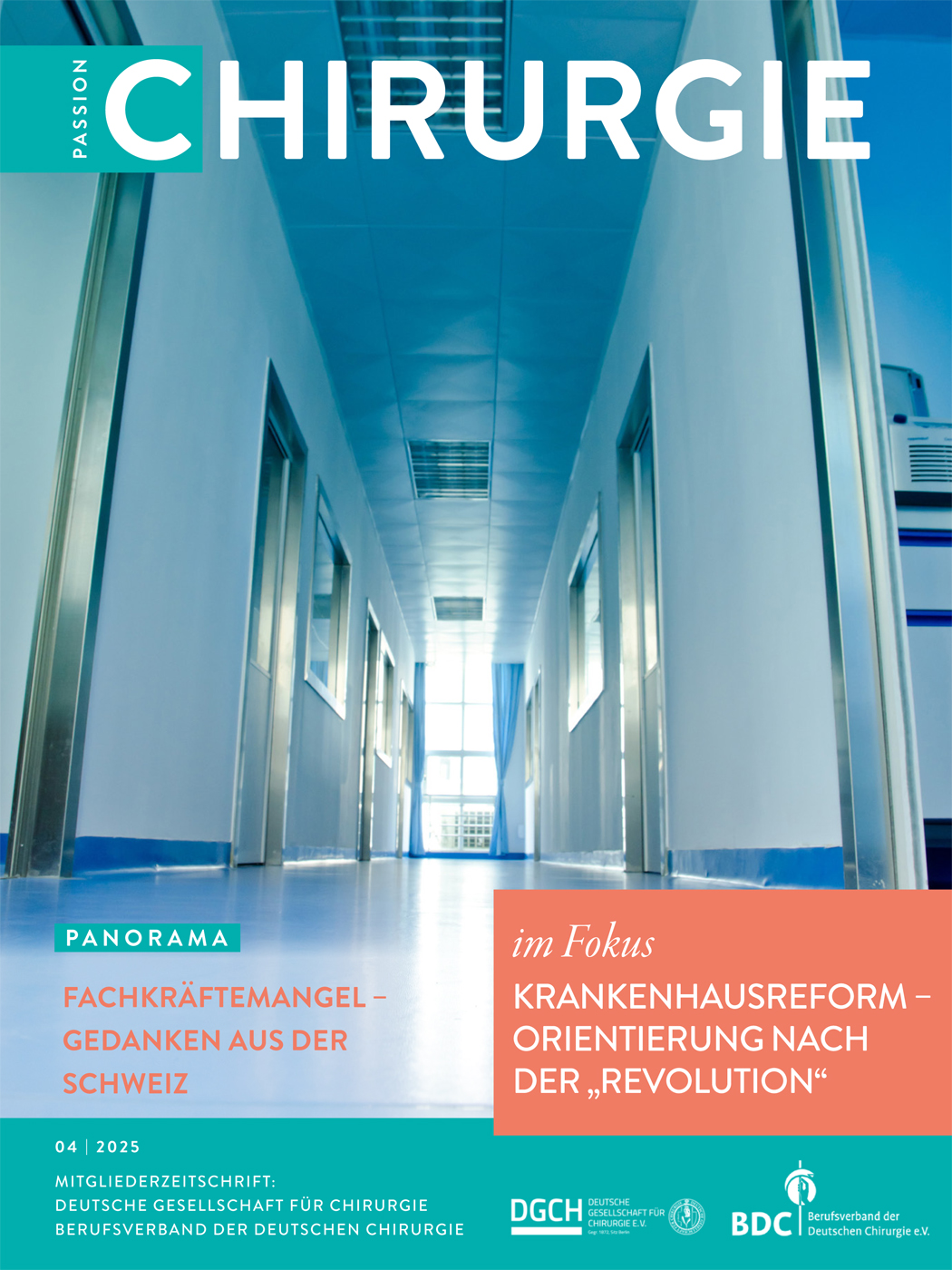01.08.2010 Honorararzt
Konfliktfeld oder eine Frage der Kommunikation?

Chancen des Konsiliararztmodells
Seit mehreren Jahren hat sich ein neues System in vielen deutschen Krankenhäusern entwickelt – das sogenannte Konsiliararztmodell. Schon die Begriffsbestimmung scheint problematisch, da ein Konsiliararzt per definitionem ein Arzt ist, der von anderen Ärzten herangezogen wird, um eine weitere Meinung oder einen Rat einzuholen. Er ist eigentlich vertraglich nicht mit dem Patienten verbunden und eine Haftung wird primär ausgeschlossen. Gemeint ist mit dem Begriff Konsiliararzt allerdings heute in der Regel, dass ein niedergelassener Arzt sogenannte Kernleistungen (z. B. Operationen) im Krankenhaus erbringt (siehe auch aktuelles Mustergerichtsurteil VG Frankfurt vom 09.02.2010 – 5 K 1985/08.F). Im Gegenzug erhält der Konsiliararzt für die Akquiseleistung und die Durchführung der Kernleistung einen frei(?) verhandelbaren Teil aus dem erwirtschafteten DRG.
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird die Tätigkeit des Konsiliararztes oft mit Beleg- und Honorarärzten gleichgesetzt oder gar verwechselt.
Die Initiative zum Abschluss von Konsiliarverträgen geht primär von drei Seiten aus:
- dem Krankenhausträger,
- den leitenden Krankenhausärzten,
- den niedergelassenen Ärzten.
In unserem konkreten Fall ist die Idee einer möglichen sektorenübergreifenden Zusammenarbeit vor 5 Jahren von dem damaligen Chefarzt einer chirurgischen Klinik (Vivantes Klinikum Berlin Spandau) angeregt worden. In der Vorbereitungsphase wurden längst nicht alle Details einer künftigen Zusammenarbeit besprochen. Nachdem die Eckdaten der gemeinsamen Arbeit festgelegt waren, wurden die ersten praktischen Erfahrungen gesammelt und das seit mittlerweile fünf Jahren mit wachsenden Zahlen und mit wachsender Zufriedenheit für alle Beteiligten vor allem auch für die Patienten.
Was sind die möglichen Vorteile dieses Systems?
Auch heute ist vielen Patienten das Krankenhaus zu anonym und in deren Augen ein Massenbetrieb. Der Patient schätzt eine individuelle Behandlung, die im Krankenhaus oft zu kurz kommt und wünscht sich eine Behandlungskontinuität vom Vorgespräch über die Erbringung der Operation bis zur Nachbehandlung. Durch das Konsiliararztmodell ist dies möglich. Es ist als sogenanntes „consulting“-Modell auch international anerkannt und weit verbreitet.
- Für die Krankenhausträger stehen wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund:
- Durch Sicherung von Zuweisungen und Fallzahlerhöhungen sind Gewinne zu erzielen.
- Die vorhandenen eigenen Ressourcen können ggf. optimaler genutzt werden.
- Darüberhinaus ist die Portfolioerweiterung ein positiver Nebeneffekt.
Für die Krankenhauschirurgen besteht die Chance das bestehende Behandlungsspektrum zu ergänzen und zu erweitern. Durch die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Chirurgen können Behandlungspfade überarbeitet und optimiert werden. Zusätzlich ist die Erreichung von Mindestmengen zur Schaffung von klinikbezogenen Spezialisierungen oder Zertifizierungen denkbar.
Auch für die niedergelassenen Chirurgen gibt es vielfältige Vorteile:
- Durch die Einbindung in ein bestehendes Ärzteteam besteht die Möglichkeit des fachlichen Austausches.
- Daneben stellt die Kooperation mit Kliniken für niedergelassene Chirurgen mit qualitätsorientierter Fachspezialisierung und großen Fallzahlen eine sinnvolle Ergänzung ihres Behandlungsangebotes dar.
- Bei multimorbiden Patienten, bei denen ambulante Operationen nur eingeschränkt möglich sind, kann der niedergelassene Chirurg eine professionelle Nachbetreuung garantieren und sicherstellen.
- Entgegen dem allgegenwärtigen Trend erhält der niedergelassene Chirurg erstmals Geldmittel aus dem Krankenhaussektor. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der noch immer bestehenden Kostenunterdeckung des ambulanten Operierens in Deutschland besonders wichtig.
Darüberhinaus bestehen jedoch offensichtlich weitere eher indirekte Vorteile des Konsiliararztmodells:
Die chirurgische Weiterbildung wird heutzutage immer komplexer und ist oft von einem einzigen Krankenhaus nicht mehr zu gewährleisten. Teilbereiche der Chirurgie (z. B. Phlebologie, Proktologie, Gastroenterologie und Teile der Hernienchirurgie) sind darüber hinaus bereits teilweise oder gar komplett in den niedergelassenen Sektor abgewandert. Obgleich es nicht wenige niedergelassene Chirurgen mit Weiterbildungsermächtigung für Chirurgie gibt, findet im ambulanten Sektor eine chirurgische Weiterbildung quasi nicht statt. Ein erster Schritt in Richtung einer künftigen Verbundweiterbildung unter Einbeziehung der niedergelassenen Chirurgen könnte durch diese Konsiliartätigkeit ermöglicht werden. Mögliche neue Fortbildungskonzepte sind auch bei der von den Autoren beschriebenen konkreten Kooperationsform ein Gesprächsthema.
Durch die bestehenden z. T. rigiden Vertragsstrukturen ist es im ambulanten Sektor nur in Ausnahmefällen möglich sinnvolle medizinische Neuentwicklungen einzusetzen. Stellvertretend seien hier die dopplergestützte Hämorrhoiden-Arterien-Ligatur (HAL) und die Hämorrhoidenstapler-Operation nach LONGO genannt, die im ambulanten Bereich nur über regionale Sonderverträge abrechenbar sind. In unserem konkreten Falle konnte die Kooperation mit dem Vivantes Klinikum eine einfache Lösung schaffen, um diese materialkostenintensiven Spezialbehandlungen einsetzen zu können.
Durch die ambulant-stationäre Kooperation kann die gesetzlich geforderte sektorenübergreifende Qualitätssicherung initiiert und mit Leben erfüllt werden. Als konkretes Beispiel kann auf das von Prof. Köckerling initiierte und neu geschaffene Deutsche Hernienregister „Herniamed“ verwiesen werden.
Nicht zuletzt stellt die Kooperation auch ein Imagegewinn für alle beteiligten Partner dar.
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit sind neben der Bereitschaft sich auf veränderte Hierarchien im Klinikalltag einzulassen, auch ein hoher Qualitätsanspruch und eine Transparenz der medizinischen Behandlung aller Beteiligten. Dies dürfte in der deutschen Krankenhauslandschaft mit den gewohnten Chefarztstrukturen eine besondere Herausforderung darstellen. Zwar sind aus unserer Sicht noch zahlreiche noch offene Probleme zu lösen und eine Rechtssicherheit zu schaffen (s. Artikel „Empfehlungen des Landesverbandes Berlin zur Gestaltung von Konsiliararztverträgen“, S. 420). Aber letztendlich ermöglicht diese Form der Kooperation die längst geforderte Überwindung der starren Sektorengrenzen.
In unserem konkreten Beispiel der ambulant stationären Verzahnung erleben wir, die3CHIRURGEN die Zusammenarbeit mit dem Team von Prof. Dr. Ferdinand Köckerling und dem Vivantes Klinikum Spandau als außerordentlich bereichernd und zukunftsweisend.
Fazit
Alles entscheidend für den Erfolg und eine positive Bewertung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit ist eine hohe Bereitschaft zur Kommunikation zwischen den beteiligten Vertragspartnern!
Autoren des Artikels
Dr. med. Ralph Lorenz
1. Vorsitzender des BDC LV|BerlinHavelklinik Berlin3+CHIRURGENKlosterstr. 34/3513581Berlin kontaktierenProf. Dr. med. Ferdinand Köckerling
ChefarztZentrum für HernienchirurgieVivantes Humboldt-Klinikum kontaktierenWeitere aktuelle Artikel
08.08.2019 Honorararzt
Wer haftet für den Honorararzt?
Niedergelassene Vertragsärzte, die in Krankenhäusern auf freiberuflicher Basis allgemeine Klinikleistungen, insbesondere Operationen, durchführen, sind aus dem Alltag vieler Krankenhäuser nicht mehr wegzudenken.
01.07.2019 Honorararzt
Sozialversicherungspflicht für Honorarärzte
In zunehmendem Maße übernehmen externe Ärzte Aufgaben in Krankenhäusern, meist in der Konstruktion des Honorararztes, der für eine konkrete Leistung, im Falle der Chirurgie meist definierte Operationen, vom Krankenhaus unmittelbar aus dem DRG-Erlös bezahlt wird.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.