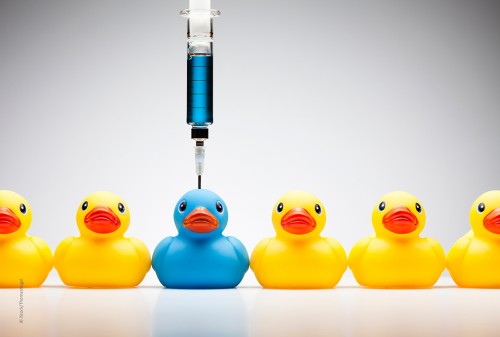Die Gefäßchirurgie
H.-H. Eckstein, A. Kühnl
Der in der Öffentlichkeit heiß diskutierte Anstieg der OP-Zahlen in Deutschland wurde auf dem letztjährigen Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie aus Sicht verschiedener operativer Fachrichtungen aufgegriffen. Die Frage ist berechtigt, nicht nur aufgrund internationaler Vergleichsdaten sondern aufgrund des evidenten Anstiegs der beim Statistischen Bundesamt dokumentierten OP-Ziffern (OPS-Ziffern Gruppe 5) von 12 Millionen auf > 15 Millionen (+ 30 %) im Zeitraum 2005 bis 2012! Betrifft dies in gleichem Umfang auch die Gefäßchirurgie und wenn ja, gibt es hierfür epidemiologische oder medizinische Gründe?
Tatsächlich hat sich die Anzahl aller peripheren endovaskulären Prozeduren im o.g. Zeitraum von 72.000 auf 131.000 beinahe verdoppelt (+ 82 %). Außerdem ist die Anzahl der peripheren Thrombenarteriektomien (TEA) und Bypass-Operationen von 75.000 auf 93.000 (+ 24 %) angestiegen. Im gleichen Zeitraum ist es aber auch zu einer Zunahme der peripheren arteriellen Hauptdiagnosen von 199 auf 226/100.000 Einwohner bei der pAVK (insgesamt ca. 180.000/Jahr) und 22 auf 27 Fälle/100.000 Einwohner (insgesamt ca. 22.000/Jahr) der akuten Extremitätenischämie gekommen. Auch diese Zunahme ist vermutlich durch den zunehmenden Anteil > 80-jähriger PatientInnen erklärt. Somit sind die steigende Lebenserwartung und die immer besseren Behandlungsmöglichkeiten als Ursachen des Anstiegs der peripheren Revaskularisationen sehr wahrscheinlich. Immerhin – und das ist das Wichtigste – hat die Anzahl der Major-Amputationen seit 2005 von ca. 29.000 auf 19.500 (- 32 % !) abgenommen. Vermehrt revaskularisierende Maßnahmen zahlen sich also vermutlich aus, trotz immer älterer PatientInnen und trotz einer Zunahme der PAVK! Eine, wie ich finde, überaus erfreuliche Entwicklung.
Beim abdominalen Aortenaneurysma (AAA) zeigt sich ein ähnlicher Trend. Auch hier lässt sich ein Anstieg der Hauptdiagnosen 171.4 (nicht-rupturiertes AAA) auf zuletzt 13.600 in 2012 (+ 17 % seit 2005) vermerken, aber auch hier wird dieser Zuwachs nahezu ausschließlich über die deutlich angestiegene Anzahl > 80-jähriger PatientInnen erklärt. Das Durchschnittsalter der AAA-PatientInnen hat seit 2005 von 69 auf 72 Jahre (Männer) und 73 auf 75 Jahre (Frauen) zugenommen. Gleichzeitig werden mittlerweile > 60 % aller elektiven AAAs endovaskulär versorgt, hierdurch steht eine vergleichsweise sichere Therapie auch für ältere PatientInnen zur Verfügung [2]. Dies sollten wir als Fortschritt verbuchen!
Bei der Carotisstenose bewegen wir uns seit einigen Jahren laut der Berichte des AQUA Institutes bei ca. 27.000 offenen Operationen und ca. 6.000 Carotis-Stents. Trotz einer Zunahme des Anteils der >80-jährigen Patienten von 13 % in 2005 auf 16 % in 2014 ist allenfalls eine sehr geringe Zunahme der Carotis-OPs zu verzeichnen. Dies kann man auch als eine zunehmend kritische Indikationsstellung, gerade auch bei älteren PatientInnen interpretieren. In jedem Fall erweist sich das gern gepflegte und in manchen Fachkreisen verbreitete Vorurteil, in der Gefäßchirurgie würde jede Carotisstenose kritiklos operiert, als vermutlich gegenstandslos.
Die Diskussion um „zu viele Operationen“ ist auch in der Gefäßchirurgie berechtigt, jedoch ist der unzweifelhaft bestehende Zuwachs am wahrscheinlichsten durch den demographischen Wandel bedingt und wird zudem durch neue Behandlungsverfahren, die nun auch bei älteren Patienten sicher eingesetzt werden können, verstärkt. Allerdings verfügen wir derzeit – mit Ausnahme der Carotisstenose – über viel zu wenige belastbare Daten zur Ergebnisqualität der verschiedenen Behandlungsregime auf nationaler Ebene und auf Ebene der einzelnen Kliniken. Ob wir allerdings dem Beispiel der Engländer und Amerikaner folgen sollten, auch arzt-bezogene Fallzahlen und Komplikationen zu erfassen (und zu publizieren) sei dahingestellt. Lassen wir doch unsere Kollegen in UK und USA erst einmal ihre Erfahrungen mit dieser Art der „schönen neuen Welt“ machen.
Eine schwierige Baustelle bleibt die einfache Tatsache, dass vermutlich zu viele Kliniken komplexe und im Einzelfall auch komplikationsträchtige arterielle Eingriffe vornehmen. So wurden in 2014 insgesamt über 33.000 offene oder endovaskuläre Eingriffe im Bereich der extracraniellen A. carotis in 654 (!) deutschen Krankenhäusern erbracht, und ca. 14.000 operativ behandelte abdominale Aortenaneurysmen in 516 Krankenhäusern (im Durchschnitt ca. 15 Prozeduren/Jahr) versorgt.
Gerade für Eingriffe mit einem bewiesenen „Volume-Outcome-Zusammenhang“ (und hierzu gehört sicherlich das Aortenaneurysma) erscheint es überaus problematisch, wenn komplexe operative Behandlungen in viel zu vielen „low-volume-Kliniken“ erfolgen. Persönlich sind wir überzeugt, dass sich auch die Gefäßchirurgie auf Dauer der sicherlich schwierigen und z. T. auch schmerzhaften Diskussion um eine schrittweise Zentralisierung der Behandlung von komplexen Gefäßerkrankungen wird stellen müssen.
Literatur
[1] Kühnl A, Sollner H, Flessenkamper I, Eckstein HH Status quo der Gefäßchirurgie in Deutschland. GEFASSCHIRURGIE. 2013;18: 355-364.
[2] Trenner M, Haller B, Sollner H, Storck M, Umscheid T, Niedermeier H, Eckstein HH. 12 Jahre „Qualitätssicherung BAA“ der DGG Teil 1: Trends in Therapie und Outcome des nicht rupturierten abdominellen Aortenaneurysmas in Deutschland zwischen 1999 und 2010 GEFASSCHIRURGIE 2013;18: 206-213.
Die Orthopädie & Unfallchirurgie
D. Pennig
Im Jahre 1984 beschäftigte sich Wennberg mit der Frage, warum die diagnostischen und operativen Eingriffe im Medicare-Programm in dreizehn Großregionen der Vereinigten Staaten eine auffällig große Varianz zeigten. Die Beantwortung der Frage, welche Eingriffszahl für eine bestimmte Population noch angemessen, normal oder richtig sei, konnten die Autoren schon vor 30 Jahren nicht schlüssig beantworten.
Wenn von einigen Teilnehmern der öffentlichen Diskussion der Eindruck erweckt wird, Patienten kämen quasi direkt von der Straße auf den Operationstisch, so ist dies fern von jeglicher Realität. Es greift in dem Behandlungspfad eines Patienten grundsätzlich das Mehraugen-Prinzip. Patienten, die letztendlich eine Endoprothese der Hüfte oder des Kniegelenks erhalten oder einem wirbelsäulenchirurgischen Eingriff unterzogen werden, haben regelhaft eine längere Leidensgeschichte hinter sich, werden über die Kette Hausarzt-Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie-Klinik untersucht, beraten und letztendlich bei entsprechender Indikationsstellung operativ behandelt. Hinzu tritt die Diskussion, ob im internationalen Vergleich in Deutschland eine Überversorgung mit den oben genannten Eingriffen vorliegt. Im Bereich der Hüftendoprothetik sind von 2005 bis 2011 die Zahlen stabil, d. h. eine Steigerung hat nicht mehr stattgefunden. Im Bereich der Knieendoprothetik im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Eingriffe moderat von etwa 61.000 im Jahr 2005 auf etwa 69.000 im Jahr 2011 (Gesamtzahl) gestiegen. Eine deutliche Steigerung ist bei den Wirbelsäulenoperationen zu verzeichnen. Im Jahre 2005 wurden 97.027 Eingriffe durchgeführt, im Jahre 2011 lag die Eingriffszahl bei 229.206. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 136 % in dem genannten Zeitraum. Unstrittig ist, dass es bei den oben genannten Eingriffen regionale Unterschiede nach Bundesländern bezogen auf das Jahr 2011 gibt. Die Varianz beträgt bei der Berücksichtigung von Kreisen in den Bundesländern 1:2,2 in Bezug auf die Hüftendoprothetik, 1:2,5 in Bezug auf die Hüftendoprothetik bei Arthrose, bei der Kniegelenksendoprothetik beträgt die Varianz 1:2,9. In Großbritannien beträgt die Varianz in Bezug auf die Hüfttotalendoprothetik 1:2,8; in den USA für die gleiche Eingriffsart 1:6,6. In der Versorgungsrate mit Knieendoprothese beträgt die Varianz in den USA 1:5,2.
Es bleibt somit festzuhalten, dass in anderen entwickelten Ländern eine hohe Varianz zu beobachten ist, ohne dass eine schlüssige Erklärung hierfür vorliegt. Auch werden von der Politik keinerlei Steuerungsmechanismen basierend auf diesen Zahlen ergriffen.
In Deutschland sind die Operationszahlen bei Hüfttotalendoprothesen umgekehrt proportional zur Zahl der niedergelassenen Orthopäden. Dies gilt analog zur Knieendoprothetik. Hier ist die Inzidenz der Knieendoprothetik umgekehrt proportional zur Anzahl der Arthroskopien.
Im internationalen Vergleich werden in Deutschland, der Schweiz und Frankreich pro 100.000 Einwohner mehr Hüftendoprothesen implantiert als in anderen Ländern. Allein aus dieser Tatsache lässt sich jedoch keinesfalls ableiten, dass die Operationsrate zu hoch ist. Bei einem breit differenzierten Angebot konservativer Behandlungsmöglichkeiten ist die Rate der implantierten Hüftendoprothesen geringer als in Gebieten, in denen weniger niedergelassene Ärzte sich auch konservativ um den Bewegungsapparat bemühen. Der Eingriff der Politik in dieses Versorgungssystem muss mit größter Sorge beobachtet werden. Da die Rate der implantierten Knieendoprothesen umgekehrt proportional zur Zahl der durchgeführten arthroskopischen Eingriffe ist, muss mit berechtigter Sorge beobachtet werden, ob die Herausnahme der Indikation Gonarthrose, behandelt im Rahmen arthroskopischer Eingriffe, basierend auf zwei Studien, die von den zuständigen wissenschaftlichen Fachverbänden mit berechtigter Kritik bewertet werden folgenlos bleibt. Letztendlich hat der Patient den berechtigten Wunsch, dass sein Beschwerdebild individuell bewertet und therapiert wird. Jeder Eingriff in das Verhältnis Arzt-Patient durch staatliche und halbstaatliche Organisationen muss unweigerlich zu Lasten der betroffenen Patienten gehen und ist damit abzulehnen.
Eine vereinfachte Betrachtungsweise der Versorgungszahlen in Deutschland ist dementsprechend nicht zielführend. Bei differenzierter Betrachtung bleibt zu bemerken, dass weder im Bereich der Hüft- noch der Knieendoprothetik in den oben genannten Zeiträumen weitere Steigerungsraten zu bemerken sind. Die Steigerungsraten im Bereich der Wirbelsäuleneingriffe müssen und werden durch die zuständigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften bewertet werden. Im Rahmen des Arzt-Patientenverhältnisses und gerade im Bereich des Bewegungsapparates ist jede Form der Polemik abzulehnen. Die klinisch tätigen Ärzte üben ihre Rolle in der Beratung des Patienten als Anwalt der Interessen dieses Patienten aus und versuchen, dem individuellen Beschwerdebild des Patienten unter Berücksichtigung der Patientenpersönlichkeit gerecht zu werden.
Literatur
J E Wennberg Dealing with medical practice variations: a proposal for action
Health Affairs, 3, no.2 [1984]:6-32; doi: 10.1377/hlthaff.3.2.6.
Die niedergelassenen Chirurgen
J.-A. Rüggeberg
Diese Fragestellung, ob in Deutschland zu viel operiert würde, ist ebenso provokant wie irreführend. Bekanntlich erfüllt jeder Eingriff per se den Tatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung und bedarf insofern der expliziten Einwilligung der Patienten, die strengen juristischen Anforderungen unterliegt, Voraussetzung ist ferner eine nachweisbare medizinische Indikation, die dokumentiert werden muss und meist durch Leitlinien der Fachgesellschaften vorgegeben ist. Man muss daher schlussfolgern, dass jede Operation zunächst nach wissenschaftlichen Kriterien sorgfältig in ihrer Indikation geprüft wurde und jedenfalls nicht überflüssig oder fahrlässig veranlasst wurde.
Interessanter ist die Frage, ob in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern vergleichbarer Infrastruktur angesichts hoher Eingriffszahlen bei der Alternativabwägung zwischen verschiedenen Behandlungsformen (konservativ versus operativ) eher eine Entscheidung zugunsten einer interventionellen Lösung getroffen wird. Und wenn ja, warum?
In der öffentliche Diskussion wird an diesem Punkt regelmäßig eine ökonomische Fehlsteuerung des Systems beklagt, bei dem operative Therapien höhere Fallpauschalen erzielen lassen, Kliniken sich auf lukrative Eingriffe spezialisieren, Mengenausweitungen durch Bonussysteme provoziert werden oder ambulante OP-Zentren die extrabudgetäre Vergütung zur Finanzierung der konservativen Praxis nutzen.
Letzteres lässt sich jedenfalls schon lange nicht mehr belegen. Während (politisch gewollt) ambulante Operationen in den Praxen der Vertragsärzte Mitte der achtziger Jahre bis etwa zur Jahrtausendwende eine deutliche Steigerungsrate aufwiesen, stagnieren die Zahlen seit Jahren. Es lässt sich erkennen, dass einerseits das Angebot einer Ambulanten Operation aus den verschiedensten Gründen von den Patienten angenommen worden ist, bestimmte Patientengruppen aber nach wie vor eine stationäre Behandlung bevorzugen. Gäbe es eine ungerechtfertigte Indikationsausweitung, so müssten die Operationszahlen trotzdem steigen. Das aber ist nicht der Fall. Eher steht zu befürchten, dass die Zahlen zurückgehen, weil die Erlössituation in der Regel kaum die Kosten deckt, die ihrerseits durch steigende (gesetzlich induzierte) Anforderungen noch weiter anziehen (Hygieneerfordernisse, Haftpflicht, Personal etc.).
Nun lässt sich mit Statistiken alles und jedes beweisen oder widerlegen, nicht aber eine wertende Frage nach einem „Zuviel“. Eingriffszahlen an sich beweisen zunächst nur einen Wandel in der Behandlungsstrategie. Ein implantiertes Hüft- oder Kniegelenk verschafft den Patienten wieder schmerzfreie Mobilität, ein Bandscheibeneingriff behebt in der Regel lang andauernde Schmerzen, eine Staroperation ermöglicht klares Sehen. Für sich genommen jeweils segensreiche Verbesserungen für die Patienten. Zweifelsfrei könnte in jedem Einzelfall auch weiter konservativ behandelt werden, allerdings mit Einschränkungen für die Betroffenen und sei es auch nur (?) eine chronische Medikation.
Volkswirtschaftlich ist Letzteres sicher preiswerter, solange die Menschen nicht weiter immer älter werden und daher auch länger entsprechende Medikamente kostenpflichtig verbrauchen.
Hier wäre eine Gegenrechnung zwischen Operation und konservativer Folgekosten interessant, aber im Prinzip unethisch.
Denn letztlich ist es der Patient, der selbstbestimmt über seine Behandlungsoptionen entscheidet und diese Entscheidung sollte nicht unter ökonomischen Aspekten erfolgen. Vielmehr erleben wir in der täglichen Praxis, dass die Menschen auch in zunehmendem Lebensalter nicht bereit sind, altersbedingte Einschränkungen hinzunehmen, wenn es denn dank des Fortschritts der Medizin Möglichkeiten gibt, diese Defizite zu beseitigen. Es kann und darf nicht Aufgabe des Arztes sein, den Willen der Patienten unter finanziellen Gesichtspunkten zu negieren. Allerdings bedarf es in der konkreten Beratung und Aufklärung der Benennung von Alternativen. Wenn diese dann nicht gewünscht werden, ist es im Ergebnis der Patient, der „zu viele“ Operationen abfordert. Aus diesem Grund ist die öffentliche Diskussion über dieses Thema völlig fehlgeleitet, wenn die sogenannten Leistungserbringer an den Pranger gestellt werden, auch wenn Einzelfälle dieses suggerieren. Wenn Politik, Gesellschaft und sonstige interessierte Kreise „Zuviel“ rufen, so müssen sie auch den Mut haben, den Bürgern zu sagen, wer auf was in Zukunft zu verzichten hat. Eine systemoffene Diskussion über die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme ist längst überfällig, wird aber zugunsten ständiger vergeblicher Regulierungsversuche innerhalb des Systems verzweifelt vermieden. Wer allen alles verspricht, darf sich nicht wundern, wenn die Geschenke auch angenommen werden.
Eckstein H.-H. / Kühnl A. Wird in Deutschland zu viel operiert? – Meinungen aus der Chirurgie. Die Gefäßchirurgie. Passion Chirurgie. 2015 September, 5(09): Artikel 02_02_01.
Pennig D. Wird in Deutschland zu viel operiert? – Meinungen aus der Chirurgie. Die Orthopädie & Unfallchirurgie. Passion Chirurgie. 2015 September, 5(09):
Artikel 02_02_02.
Rüggeberg J.-A. Wird in Deutschland zu viel operiert? – Meinungen aus der Chirurgie. Die niedergelassenen Chirurgen. Passion Chirurgie. 2015 September, 5(09): Artikel 02_02_03.