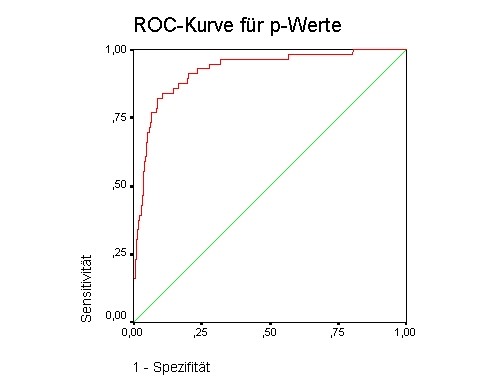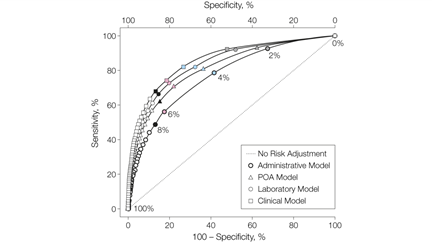Die Entwicklung des Medizinsystems wird in den nächsten Jahren vor allem durch vier Faktoren richtungsweisend beeinflusst:
- Die demographische Entwicklung
- Das Arbeitszeitgesetz
- Die neue Weiterbildungsordnung
- Die Ressourcenallokation
Ad1. Die demographische Entwicklung und die „Rente mit 63″ werden dazu führen, dass sich die Bemessungsgrundlage der GKV bis zum Jahre 2036 asymptotisch einem Maximalwert angenähert haben wird – dies aber nur unter der Annahme einer permanent guten konjunkturellen Lage. Die Kosten, getriggert durch die medizinische Entwicklung, die steigenden Ansprüche an Qualität und Sicherheit und die zunehmenden altersbedingten Anforderungen an die Medizin, werden aber weiter steigen.
Nach den Daten von Eurostat und dem statistischen Bundesamt wird die Mobilität der Menschen abnehmen. Die Zahl der Singlehaushalte in den großen Städten wird bis auf 60% steigen aber auch in den ländlichen Regionen werden aller Voraussicht nach 30 bis 40% erreicht werden.
Daneben wird es auf dem „Markt” einen zunehmenden Wettbewerb um die besten Köpfe geben, so dass eine Vernunft geleitete Allokation von Expertise und Spezialistentum absolut notwendig wird.
Eine deutliche Anpassung des Systems wird damit unausweichlich.
Zunehmende Spezialisierung und Arbeitsteilung
Ad2. Das Arbeitszeitgesetz und der veränderte Anspruch der Leistungsträger im Medizinsystem an die Lebensqualität, die mit der vereinfachenden Formel, „Freunde, Freizeit, Familie” beschrieben werden kann, muss bei der Ausgestaltung der künftigen Weiterbildungsinhalte berücksichtigt werden. Außerdem ist die Feminisierung der Medizin zu berücksichtigen. Die logischen Konsequenzen daraus sind eine zunehmende Spezialisierung und Arbeitsteilung – aber auch eine konsequente interdisziplinäre Kooperation.
Unabdingbar: die Sektor-übergreifende Versorgung, Weiterbildung und Bezahlung
Ad3. Die neue WBO wird in sogenannte Weiterbildungsblöcke gegliedert sein. Diese weisen eine hierarchische, auf jeweils erworbene Grundlagen aufbauende Struktur auf, die mit den Schlagworten Wissen, Kennen, Können, Beherrschen, beschrieben werden kann. Die Weiterbildungsermächtigung wird daher an die objektivierbaren Leistungszahlen der Kliniken gebunden werden. Dies wird zu einer zunehmenden Zentralisierung der Weiterbildung führen, da eine bestimmte Klinikgröße und eine bestimmte Anzahl von Weiterbildern erforderlich sein wird, um die zunehmenden Anforderungen an die Art der Weiterbildung, die nicht zuletzt von der EU bestimmt sein wird, erfüllen zu können. Da eine zunehmende Zahl von medizinischen Leistungen in den ambulanten Sektor abgewandert ist und wohl weiterhin abwandern wird, ist eine Sektor-übergreifende Versorgung, eine Sektor-übergreifende Weiterbildung und eine Sektor-übergreifende Bezahlung medizinischer Leistungen anzustreben. Eine hierarchische Strukturierung der Versorgungslandschaft mit einer klaren Definition der Grund- und Regel- der Schwerpunkt- und Maximalversorgung und eine Netzwerkbildung zwischen den verschiedenen Versorgungsstufen und dem niedergelassenen Bereich auf bindender vertraglicher Grundlage wird die unausweichliche Folge sein.
Kostenoptimierung: Qualität und Patientensicherheit leiden
Ad4. Medizin und medizinische Leistungen hatten und haben stets einen ökonomischen Rahmen. Die Entwicklung des Medizinsystems in den letzten Dekaden war jedoch primär geprägt vom „Principal Client Phänomen”. Selten waren die strukturellen Überlegungen so durchdrungen vom Streben nach dem optimalen Patientenwohl oder dem Gedanken der medizinischen Ökonomik nach David Osoba und Franz Porzsolt, der da sagt, medizinische Strukturen und Maßnahmen sollten dem Prinzip folgen, den nach wissenschaftlicher Erkenntnis größten Behandlungserfolg mit dem geringsten Aufwand für den Patienten und die Gesellschaft zu erzielen.
Die medizinische Versorgungslandschaft konnte sich so kleinteilig entwickeln. Eine übergeordnete Steuerung auf dem Boden von gesicherten Erkenntnissen aus der Versorgungsforschung ist nicht erfolgt. Den daraus resultierenden strukturellen Verwerfungen und unabsehbaren Kostensteigerungen sucht man seit geraumer Zeit mit dem Mittel wettbewerblicher Prinzipien zu begegnen. Dem permanenten Euphemismus der Hebung von Effizienzreserven, der Leistungs- und der Kostenoptimierung wird noch immer gehuldigt, obwohl man längst erkannt haben sollte, dass das billig, billig, schneller, schneller notwendigerweise einen motivationsvernichtenden Einfluss auf die Leistungsträger hat, Qualität und Patientensicherheit leiden könnten und möglichst viele überflüssige Leistungen zum Maximalpreis abgesetzt werden müssen, um oft abenteuerliche EBITDA- Erwartungen befriedigen zu können. Hier muss durch vernunftgeleitete Maßnahmen gegengesteuert werden.
Mögliche Perspektiven chirurgischer Netzwerke
Da diese kurz zusammengefassten Entwicklungen und Verwerfungen unter den weitsichtigen Vertretern der Krankenkassen, der Ökonomie und der Ärzteverbände – sofern sie sich nicht einem spezifischen „Principal Client“-Problem verpflichtet fühlen – m. E. im Konsens betrachtet werden, könnte man daraus perspektivisch Vorschläge für die Organisationsstruktur eines chirurgischen Netzwerkes modellhaft für weitergehende Maßnahmen ableiten.
- Das Ziel eines Maximalversorgers muss es sein, von der Bevölkerung auf möglichst vielen Gebieten als die Nummer eins in der Region wahrgenommen zu werden. Dazu bedarf es einerseits einer genauen Betrachtung des möglichen eigenen Leistungsportfolios und seiner perspektivischen Entwicklungsmöglichkeiten aber auch der Konkurrenzsituation im Umfeld.
- Zur Sicherung von Patientenströmen und einer stabilen wirtschaftlichen Situation bedarf es neben der Leitung einer Klinik sogenannter „Leuchttürme”, hocheffizienter, möglichst perfekter klinischer Leistungsträger, die über einen langen Zeitraum am Klinikum tätig, Vertrauen aufbauen und weithin sichtbare klinische Reputation erwerben können – dies umso mehr, je intensiver Konkurrenz in einem bestimmten Umfeld erlebt wird.
- In der Zusammenschau von neuer WBO, Arbeitszeitgesetz, Feminisierung der Medizin und veränderter Anforderungen an den Lebensstil, erscheint eine Kompartimentierung der großen Kliniken und eine zunehmende Spezialisierung dringend angezeigt.
- Die ökonomischen Rahmenbedingungen und die außerordentlich hohen Vorhaltekosten von Maximalversorgern zwingen zu einer Konzentration hochwertiger medizinischer Leistungen und zu einer Netzwerkbildung mit umliegenden Kliniken, Einzelpraxen und Praxisnetzwerken auf möglichst definierter vertraglicher Grundlage. Entsprechend der Säulenstruktur des chirurgischen Gebietes könnten Maximalversorger und Universitätsklinika organisiert werden. An der Spitze einer Klinik stünde ein Klinikleiter oder Direktor, dem die Organisation und die Personalverteilung bzw. Rotation und die Weiterbildungsverantwortung obliegen würde. Er verträte darüber hinaus ein spezifisches Gebiet. Anhand des vorliegenden Zahlenmaterials und der ökonomischen Kennziffern aber auch anhand der Vorstellungen von ökonomischer und ärztlicher Direktion, würde zu entscheiden sein, wie intensiv die Kompartimentierung erfolgen soll. Aus Gründen der Patientensicherheit und der Patientenversorgung aber auch der Ökonomie könnte es sinnvoll sein zumindest übergreifende Dienste zu organisieren – dies beispielsweise in der Viszeral- Thorax- und Gefäßchirurgie. Bei all diesen Überlegungen wäre auch zu definieren, welche Kooperationen mit Praxisnetzwerken Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgern zu schließen wären. Diese würden jene Eingriffe ausführen, welche bei Maximalversorgern und an Universitätskliniken nicht mehr kostendeckend abgearbeitet werden können. Eine entsprechende Zuweisung hochwertiger Eingriffe im Gegenzug und eine Rotation der Weiterzubildenden, aber auch eine Rotation der Fachärzte im Sinne des lebenslangen Lernens und einer optimalen Patientenversorgung auf dem neuesten Stand, könnten damit zu verbunden werden.
- Die zunehmende Spezialisierung besitzt darüber hinaus ernsthaft zu bedenkende Folgen für die wissenschaftlichen Strukturen an Universitätskliniken. Je spezialisierter gearbeitet werden muss, je höher die Anforderungen an Leistungszahlen und den ärztlichen Ruf, umso weniger wird es möglich und finanzierbar sein für Abteilungen oder Sektionen eigene wissenschaftliche Strukturen aufzubauen. Die Universitäten haben in den letzten Jahren bereits wissenschaftliche Schwerpunkte entwickelt entlang derer Berufungen erfolgen. Es mag unter den gegebenen Bedingungen daher sinnvoll sein sogenannte „Core Facilities“ z. B. für die schneidenden Fächer zu etablieren, die eine entsprechende Wissenschaftsinfrastruktur und Expertise vorhalten und gegebenenfalls zur Verfügung stellen.