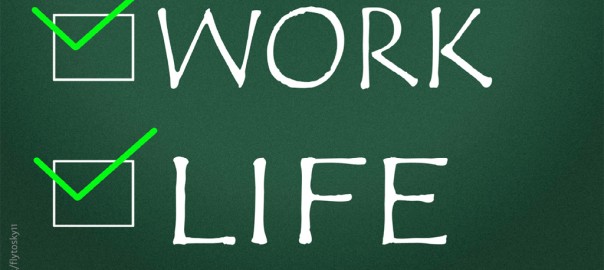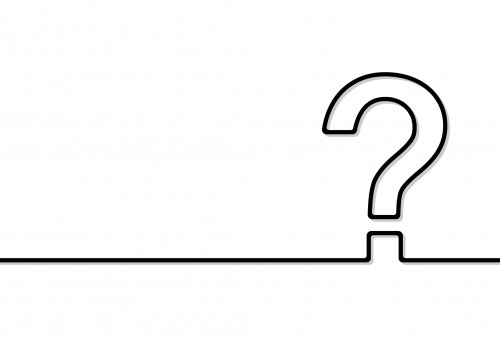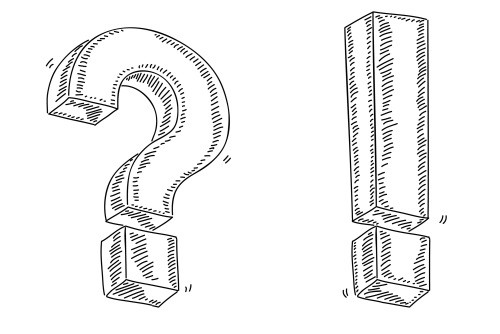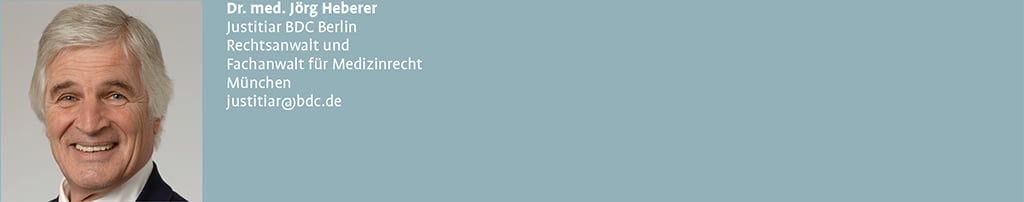Änderung der §§ 103 Abs. 3a Satz 3 Hs. 1, Abs. 4 Satz 9 SGB V
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht eine für die niedergelassenen Ärzte vermutlich einschneidende und mit negativen Auswirkungen verbundene Änderung im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren vor. Ziel des Vorhabens ist der Abbau von Überversorgung für eine langfristig ausgewogene Verteilung der Sitze und die Sicherung der finanziellen Stabilität der GKV. Dies soll aus Sicht der Großen Koalition dadurch erreicht werden, dass die gesetzlichen Vorgaben für den Aufkauf von Arztsitzen von einer „Kann“ in eine „Soll“-Vorschrift geändert werden (vgl. Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 54 HIER).
Zu Recht führt dieses Änderungsvorhaben zu einem Aufschrei unter den niedergelassenen Vertragsärzten.
Gesetzliche Regelungen des §§ 103 Abs. 3a Satz 3 Hs. 1, Abs. 4 Satz 9 SGB V
Durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz wurde dem Zulassungsausschuss die Möglichkeit an die Hand gegeben, in Fällen, in denen die Zulassung des abgebenden Arztes durch Tod, Verzicht oder Entziehung endet und die Praxis durch einen Nachfolger fortgeführt werden soll, in überversorgten Gebieten den Antrag des Vertragsarztes auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens abzulehnen.
Wörtlich heißt es in § 103 Abs. 3a Satz 3 Hs. 1 SGB V: „Der Zulassungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist.“
Ausnahme: Dieses Ablehnungsrecht gilt jedoch gemäß § 103 Abs. 3a Satz 3 Hs. 2 SGB V lediglich dann nicht, sofern die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in § 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 5 und 6 bezeichneten Personenkreis angehört. Dies ist der Fall, wenn es sich bei dem Bewerber um den Ehegatten, den Lebenspartner, ein Kind, einen angestellten Arzt des bisherigen Vertragsarztes oder einen bisherigen Partner handelt, mit dem die Praxis gemeinschaftlich betrieben wurde.
Entspricht der Zulassungsausschuss der Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens und kommt dieser dann im Rahmen seines Auswahlermessens hinsichtlich der Bewerber zu dem Ergebnis, dass ein Bewerber auszuwählen ist, der nicht dem vorgenannten Personenkreis des Absatz 4 Satz 5 Nr. 5 und 6 angehört, so „kann er auch die Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes mit Stimmenmehrheit ablehnen, wenn eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist“, sprich bei Überversorgung (§ 103 Abs. 4 Satz 9 SGB V).
Diese Ablehnungsrechte kommen aus juristischer Sicht einer Einziehung der Zulassung gleich. Bisher entfalteten diese Bestimmungen in der Praxis zwar kaum Relevanz. Betroffen waren primär Hausarztpraxen mit unterdurchschnittlicher Fallzahl und auch dies bundesweit nur sehr wenige, jedenfalls weit im einstelligen Bereich. Dies wird sich bei tatsächlicher Umsetzung des Koalitionsvorhabens jedoch zukünftig maßgeblich ändern.
Bedeutung der Änderung von einer „Kann“ in eine „Soll“-Vorschrift
Entsprechend dem Vorhaben im Koalitionsvertrag sollen diese Regelungen nun in eine Soll-Vorschrift geändert werden.
Durch eine Kann-Vorschrift wird dem Zulassungsausschuss ein recht weites Entscheidungsermessen eingeräumt.
Eine Soll-Vorschrift räumt dem Zulassungsausschuss hingegen ein nur begrenztes, sogenanntes gebundenes Ermessen ein. Von der gesetzlich vorgesehenen Rechtsfolge kann er dann nur in Ausnahmefällen abweichen.
Dies hätte nach Auffassung des Verfassers zur Folge, dass zukünftig im Regelfall bei Überversorgung keine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes mehr stattfindet. Hiermit sind jedoch diverse, noch ungeklärte Fragen und erhebliche Konsequenzen verbunden, von denen einige, aus Sicht des Verfassers wichtige, nachfolgend betrachtet werden sollen:
Entschädigungszahlung § 103 Abs. 3a Satz 8 SGB V
Lehnt der Zulassungsausschuss aufgrund einer der oben erwähnten Gründe die Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens bzw. die Nachbesetzung ab, so sieht das Gesetz eine Entschädigungsregelung in § 103 Abs. 3a Satz 8 SGB V vor:
„Hat der Zulassungsausschuss den Antrag abgelehnt, hat die Kassenärztliche Vereinigung dem Vertragsarzt oder seinen zur Verfügung über die Praxis berechtigten Erben eine Entschädigung in der Höhe des Verkehrswertes der Arztpraxis zu zahlen.“
Allerdings stellen sich hierzu einige bislang ungeklärte (Rechts-) Fragen:
Wie wird der Verkehrswert ermittelt, als Fortführungswert oder als Liquidationswert?
Können die einzelnen KVen bzw. Zulassungs- oder Berufungsausschüsse entscheiden, nach welcher Wertermittlungsmethode sie ermitteln, sodass es in den einzelnen Zuständigkeitsbereichen abweichende Ermittlungsmethoden geben kann oder müssen die KVen bzw. Zulassungs- oder Berufungsausschüsse alle dieselbe Wertermittlungsmethode zu Grunde legen?
Beim Fortführungswert wird der Praxiswert unter Betrachtung der zukünftigen Fortführung, d. h. Ertragserzielung und Wert der Praxisausstattung und somit unter Berücksichtigung sowohl des ideellen als auch des materiellen Praxiswerts, ermittelt. Im Rahmen des Liquidationswerts würde der ideelle Wert hingegen unberücksichtigt bleiben.
Welche Bewertungsmethode wird sodann angewendet?
Ist eine Pauschalierung der Entschädigung (wie wohl von den KVen favorisiert) zulässig?
Es gibt eine Vielzahl von Methoden und Ansätzen zur Bewertung von Arztpraxen. Genannt seien hier vor allem das (modifizierte) Ertragswertverfahren, das Substanzwertverfahren bzw. die sog. Bundesärztekammermethode. Je nach Bewertungsmethode können sich hier sehr erhebliche Unterschiede im Ergebnis der Praxiswertberechnung ergeben.
Das modifizierte Ertragswertverfahren wurde zwar durch die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH und des BSG als geeignetes Verfahren zur Ermittlung eines Verkehrswerts einer freiberuflichen Praxis anerkannt (vgl. BGH, Urteil vom 02.02.2011 – XII ZR 185/08, NJW 2011, 2572; BSG, Urteil vom 14.12.2011 – B 6 KA 39/10 R,
GesR 2012, 535). Allerdings besteht der Grundsatz der Methodenfreiheit.
Wer berechnet den Verkehrswert bzw. kann der Arzt auf die Auswahl des Gutachters Einfluss nehmen oder wird dieser ausschließlich von der KV bzw. den Zulassungs- oder Berufungsausschüssen bestimmt?
Kann der Arzt gegen das Verkehrswertgutachten Einwendungen erheben, stehen ihm Rechtsbehelfe zur Verfügung oder steht es ihm frei, ein Gegengutachten einzuholen? Wer trägt die Kosten dieser Gutachten? Welche Folgen ergeben sich bei im Ergebnis abweichenden Gutachten, wie werden Differenzen gelöst?
Folglich besteht zwingender Klärungsbedarf hinsichtlich dieser Fragen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob eine dahingehende Klarstellung im Rahmen der Gesetzesänderung erfolgt bzw. sich eine solche zumindest aus der Gesetzesbegründung ergeben wird.
Entschädigung auch für Folgeschäden?
Nachdem die Entschädigungsregelung des § 103 Abs. 3a Satz 8 SGB V lediglich auf den Verkehrswert der Arztpraxis abstellt, ist vollkommen ungeklärt, ob hiervon auch sogenannte Folgeschäden umfasst sind oder ob der Vertragsarzt, seine Erben, die verbliebenen Berufsausübungsgemeinschaftspartner oder andere Dritte diese zu tragen haben.
Folgeschäden können beispielsweise daraus entstehen, dass ein langfristig befristet abgeschlossener Mietvertrag, langfristig abgeschlossene Leasing- oder Wartungsverträge für medizinische Geräte oder Praxisversicherungen nicht außerordentlich bzw. zeitnah gekündigt werden können. Die Zahlungsverpflichtungen aus diesen Verträgen können unter Umständen somit über mehrere Jahre hinweg – z. B. bei Mietverträgen sind zehn Jahre verbleibende Dauer keine Seltenheit – bestehen bleiben.
Problematisch ist zum einen, dass gesetzliche Vorgaben für einen solchen Entschädigungsanspruch bislang fehlen. Sofern man die Rechtsgrundlage dieses Entschädigungsanspruchs direkt aus Art. 14 GG (Entschädigung bei Enteignung durch staatlichen Eingriff) herleitet (fraglich ist hierbei, ob die Einziehung der Zulassung als Enteignung einzustufen ist) und somit einen Entschädigungsanspruch bejaht, wird man jedoch dem Arzt aus derzeitiger juristischer Sicht empfehlen müssen, dass er nach Rechtskraft eines Einziehungsbeschlusses bestehende Verträge der Praxis sofort kündigt bzw. mit dem Vertragspartner über eine vorzeitige Beendigung verhandelt, da ihm gemäß § 254 Abs. 2 BGB die Pflicht zur Schadensabwehr bzw. Schadensminderung zukommt. Verletzt er diese, kann dies nämlich zur Kürzung eines Entschädigungsanspruchs führen.
Zum anderen wird zu prüfen sein, ob die Zulassungseinziehung als wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung der jeweiligen Verträge berechtigt, sofern nicht im Vertrag ohnehin dem Vertragsarzt ein Sonderkündigungsrecht für den Fall der Beendigung der Zulassung durch Verzicht oder Entzug bzw. der Aufgabe der Praxistätigkeit eingeräumt wurde. Eine solche Vereinbarung könnte vorbeugend auch in derzeit bestehende Verträge im Einvernehmen mit dem Vertragspartner (z. B. des Vermieters) versucht werden mitaufzunehmen. Es ist deshalb anzuraten, bestehende Verträge diesbezüglich zu überprüfen.
Aber bisher sind solche Klauseln in Miet- oder sonstigen Verträgen völlig unüblich.
In Betracht ziehen könnte man grundsätzlich auch einen Anspruch des Arztes auf Anpassung der Verträge gemäß § 313 BGB, wenn durch die Ablehnung der Nachbesetzung die Geschäftsgrundlage weggefallen ist. Zu denken wäre beispielsweise an eine Verkürzung der Vertragslaufzeit oder an eine Reduktion der Zahlungen. Allerdings müsste dann die Nichtnachbesetzung des Vertragsarztsitzes bzw. die vertragsärztliche Zulassung Geschäftsgrundlage des Vertrages sein. Dies kann somit streitig sein und auch vom jeweiligen Vertragstyp abhängen.
Hingegen dürften aus Sicht des Verfassers bestehende Arbeitsverträge mit dem Praxispersonal grundsätzlich wohl relativ unproblematisch, auch bei Geltung des Kündigungsschutzgesetzes, zwecks Betriebsaufgabe beendet werden können.
Anrechnung des Werts für etwaig noch veräußerbare Gegenstände
Gesetzlich nicht geregelt ist, ob sich der Arzt im Falle der Entschädigung des Verkehrswerts den Sachwert für Gegenstände, die er gegebenenfalls noch veräußern kann, anrechnen lassen muss und dieser somit von der Entschädigungsleistung in Abzug zu bringen ist. Dies wird aufgrund des entschädigungsrechtlichen Grundsatzes, dass keine wirtschaftliche Besserstellung erfolgen soll, nach Auffassung des Verfassers wohl zu bejahen sein, wobei allenfalls der zu schätzende Liquidationswert des Praxisinventars anzurechnen sein kann.
Probleme der Versagung der Nachbesetzung für Berufsausübungsgemeinschaften
Auch für Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) stellen sich dieselben Probleme wie für Einzelpraxen, da die Vorschriften des §§ 103 Abs. 3a Satz 3 Hs. 1, 4 Satz 9 SGB V für diese gleichermaßen gelten. Die BAG wird jedoch mit folgenden weiteren Sonderproblemen konfrontiert werden:
Ungeklärt ist, was bei Einziehung der Zulassung mit den etwaig mit dem Sitz verbundenen weiteren Zulassungen, wie z. B. einer Angestelltenzulassung, geschieht.
Unsicher ist, ob auch die BAG die Geltung der Entschädigungsregel für Folgeschäden für sich in Anspruch nehmen kann, wenn sie durch die Zulassungseinziehung eines Praxispartners einen Vermögensverlust aufgrund einer damit verbundenen geringeren Geräteauslastung oder einer Nutzung zu großer Räumlichkeiten erleidet.
Für den aufgrund der Zulassungseinziehung ausscheidenden Gesellschafter wird sicherlich relevant sein, was im Falle einer Differenz zwischen Verkehrswertentschädigung und gesellschaftsvertraglicher Abfindung passiert und wer diesen Unterschiedsbetrag ausgleicht.
Erhält der Vertragsarzt eine Entschädigung des Verkehrswerts, so stellt sich ferner die Frage, welche Konsequenzen dies für die in der BAG vorhandenen Gegenstände (z. B. Computer, Ultraschallgeräte etc.) hat, die ja anteilig durch die KV aufgrund der Entschädigungszahlung aufgekauft wurden. Ist es der KV dann unter Umständen möglich, dass sie im Falle von insgesamt drei Praxispartnern beispielsweise den Computer des ausscheidenden Praxispartners herausverlangt? Was passiert, wenn zum Beispiel nur ein Ultraschallgerät vorhanden ist, an dem der Arzt lediglich zu ein Drittel beteiligt war?
Stellungnahme
Das Vorhaben der Großen Koalition zum Abbau der Überversorgung verfolgt zwar einen legitimen Zweck. Dennoch sind aus Sicht des Verfassers mit der geplanten Änderung der §§ 103 Abs. 3a Satz 3 Hs. 1, Abs. 4 Satz 9 SGBV von einer Kann- in eine Soll-Vorschrift mannigfaltige Probleme verbunden, die es bereits im Vorfeld zu diskutieren und zu lösen gilt, da dies zu einer ansteigenden Versagung der Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen führen wird. Eine gesetzliche Neuregelung sollte deshalb die offenen Fragen klarstellen, insbesondere sollte die Entschädigung von Folgeschäden gesetzlich normiert werden.
Wie weitreichend die Auswirkungen für Vertragsärzte, Berufsausübungsgemeinschaften oder Medizinische Versorgungszentren im Falle einer solchen Umwandlung in eine zwingende Rechtsvorschrift sein werden – möglicherweise katastrophale – kann derzeit nicht vorhergesagt werden. Bereits jetzt ist jedoch aus rechtlicher Sicht anzuraten, bestehende Verträge (z. B. Mietverträge, Leasing-, Wartungsverträge, Praxisversicherungen) auf ein Sonderkündigungsrecht für diesen Fall zu überprüfen bzw. den Versuch zu unternehmen, mit dem Vertragspartner ein solches ergänzend nachträglich zu vereinbaren.
Es bleibt somit nur die Möglichkeit abzuwarten, ob und wann die Große Koalition ihr Gesetzesvorhaben realisiert und wie sie mit den bereits jetzt offensichtlichen Problemen umgehen bzw. diese lösen wird. Die Hoffnung, dass für die Ärzteschaft nicht nur eklatant negative Folgen hieraus resultieren, stirbt aus Sicht des Verfassers wie immer zuletzt.
 |
Diesen Artikel finden Sie auf BDC|Online unter der Rubrik Themen/Recht/Zulassung.
Heberer J. Nachbesetzungsverfahren – geplante Änderung von einer „Kann“ in eine „Soll“-Vorschrift. Passion Chirurgie. 2014 Dezember; 4(12): Artikel 06_01.
|
Geld und Recht