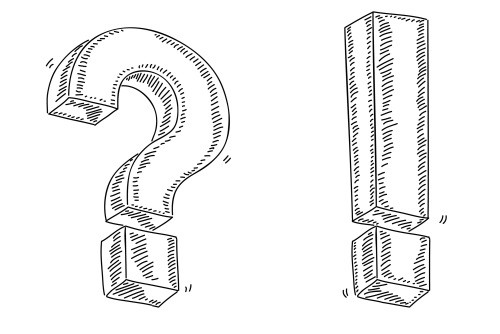Medizinische Kongresse oder ähnliche Veranstaltungen zeichnen sich oftmals unter anderem dadurch aus, dass vom Veranstalter gebuchte Referenten Vorträge zu interessanten Themen vor einem öffentlichen Publikum halten. Der Vortrag des Referenten setzt sich dabei grundsätzlich zusammen aus der persönlichen Darbietung des Referenten sowie einer von ihm erstellten Präsentation auf Bild- oder Tonträgern (z. B. PowerPoint-Präsentation). Dem medialen Fortschritt ist es wohl geschuldet, dass es immer öfter dazu kommt, dass die Teilnehmer den Vortrag beispielsweise per Handy aufnehmen bzw. die gezeigten Folien etc. fotografieren. Dies geschieht oftmals ohne vorherige Einwilligung des Referenten. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob durch die Foto-, Video- und/oder Audioaufnahmen der Teilnehmer von Vorträgen das Urheberrecht des Referenten verletzt wird.
Grundsätzliche urheberrechtliche Regelung
Da in diesem Artikel davon ausgegangen wird, dass der vortragende Referent den Vortrag selbst erstellt hat und somit Urheber des Werks ist, steht ihm gemäß § 15 Abs. 1 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) das ausschließliche Recht zu, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Dies umfasst insbesondere das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), das Verbreitungsrecht (§17 UrhG) und das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG).
Des Weiteren ist es das ausschließliche Recht des Urhebers, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 UrhG. Hierzu zählt insbesondere das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG), das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) und das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG).
Da die Wiedergabe nach § 15 Abs. 2 Satz 1 UrhG öffentlich sein muss, wird in § 15 Abs. 3 Satz 1 UrhG definiert, dass dies der Fall ist, wenn die Wiedergabe für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Gemäß Absatz 3 Satz 2 gehört jeder zur Öffentlichkeit, der nicht mit dem Urheber oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. Aus Sicht des Verfassers gehören somit die zuhörenden Teilnehmer einer solchen Vortragsveranstaltung, wie einleitend dargestellt, grundsätzlich zur Öffentlichkeit.
Der Referent als Urheber des Vortrags kann somit grundsätzlich jederzeit und gegenüber jedermann bestimmen, ob dieser zur Verwertung und/oder Wiedergabe seines Vortrags, der hiermit verbundenen Folien/Grafiken etc. berechtigt sein soll oder nicht. Im Folgenden werden nun die nach Meinung des Verfassers relevantesten Rechte näher dargestellt.
§ 16 UrhG Vervielfältigungsrecht
Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob, in welchem Verfahren und in welcher Zahl Vervielfältigungsstücke (Kopien) seines Werks (= Vortrag) hergestellt werden dürfen. Als Vervielfältigung gilt dabei auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- oder Tonaufnahmen (Bild- oder Tonträger) gemäß § 16 Abs. 2 UrhG. Sowohl dauerhafte als auch vorübergehende Vervielfältigungen sind hiervon umfasst.
Bereits die erste körperliche Festlegung des Werkes (Erstfixierung) stellt eine Vervielfältigung dar, wie beispielsweise das Mitschreiben oder der Mitschnitt eines frei gehaltenen Vortrages (vgl. Dustmann in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, § 16 UrhG Vervielfältigungsrecht Rn. 10, 10. Auflage 2008, Verlag W. Kohlhammer). Auch die Fotografie eines urheberrechtlich geschützten Werkes oder dessen digitale Speicherung, unabhängig davon ob es sich um eine Erstspeicherung (Digitalisierung durch Scannen) oder eine Übertragung von einem Speichermedium in ein anderes handelt, stellen eine Vervielfältigung dar (vgl. Dustmann, a. a. O., § 16 Rn. 12). Erforderlich für eine Vervielfältigung ist dabei stets die Geeignetheit der Festlegung des Werks zur unmittelbaren oder mittelbaren Wahrnehmbarmachung. Von einer mittelbaren Wahrnehmbarmachung spricht man, wenn die Signale erst in analoge Signale umgewandelt werden müssen, damit sie wahrgenommen werden können.
Nach § 16 Abs. 2 UrhG zählt aber auch die Herstellung von Tonband- oder Filmaufnahmen eines Werkes zum Vervielfältigungsrecht. Insbesondere unterfallen alle Formen digitaler Datenträger dem Begriff „Bild- und Tonträger“.
Mit welchem Verfahren Vervielfältigungen vorgenommen werden, ist unerheblich, da jegliche Techniken zur Vervielfältigung von § 16 UrhG erfasst sind. Vervielfältig werden muss nicht nur das vollständige Werk. Vielmehr umfasst das Vervielfältigungsrecht auch lediglich einzelne Teile. Ebenso sind Anzahl der vervielfältigten Stücke und der Vervielfältigungszweck (privat oder gewerblich) völlig unmaßgeblich.
Aus Sicht des Verfassers stellen somit beispielsweise das Abfotografieren von Folien während eines Vortrages oder der Mitschnitt/die Aufnahme eines Vortrages grundsätzlich Vervielfältigungen dar, an denen der Referent zunächst einmal das ausschließliche Recht besitzt und diese somit untersagen kann.
§ 19 UrhG Vortrags- und Vorführungsrecht
§ 19 Abs. 1 UrhG schützt das Vortragsrecht des Urhebers. Dies meint das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen. Das Werk wird in diesem Fall einem unmittelbar anwesenden Publikum in unkörperlicher Form, also nicht durch Bild- oder Tonträger, dargeboten (vgl. Dustmann, a. a. O., § 19 Rn. 1). Somit hat der Urheber das Recht, seinen von ihm verfassten Vortrag den anwesenden Teilnehmern unmittelbar (live) vorzutragen.
Hingegen unterfallen die Aufnahme oder die Vervielfältigung eines Vortrages nicht dem Recht aus § 19 Abs. 1 UrhG, sondern dem Vervielfältigungsrecht des § 16 UrhG. Von § 21 UrhG wird überdies die öffentliche Wiedergabe eines aufgezeichneten Vortrags durch Bild- oder Tonträger erfasst (vgl. Dustmann, a. a. O., § 19 Rn. 10).
Das Vorführungsrecht gemäß § 19 Abs. 4 UrhG ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. Hierunter ist zum Beispiel die öffentliche Powerpoint-Präsentation wissenschaftlicher Darstellungen zu subsumieren (vgl. Dustmann, a. a. O., § 19 Rn. 27). Geschützt vom Anwendungsbereich des Absatzes 4 werden aber nur die hier abschließend aufgezählten Werke. Die öffentliche Wiedergabe eines Sprachwerks ist hiervon nicht umfasst. Unterstützt folglich der Referent seinen persönlichen Vortrag durch eine Powerpoint-Präsentation, so können hier unterschiedliche Verwertungsrechte bestehen. Beinhaltet die Powerpoint-Präsentation auch die Wiedergabe wissenschaftlicher Darstellungen, so greift hier zusätzlich zu den Rechten aus §§ 16, 21 UrhG auch das Recht des § 19 Abs. 4 UrhG.
Als technische Einrichtung im Sinne des Absatzes 4 sind Abspielgeräte und Projektoren jeglicher Art zu verstehen, die Bilder oder Bildfolgen für den Betrachter wahrnehmbar machen können (vgl. Dustmann, a. a. O., § 19 Rn. 29).
§ 21 Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger
Gemäß § 21 UrhG ist das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger das Recht, Vorträge des Werkes mittels Bild- oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar zu machen. Dieses Recht stellt ein sog. Zweitverwertungsrecht dar, da Voraussetzung hierfür die Vervielfältigung des Werks durch Herstellung eines Bild- oder Tonträgers nach § 16 Abs. 2 UrhG durch den Urheber ist (vgl. Dustmann, a. a. O., § 21 Rn. 1). Dementsprechend muss der Vortrag schon einmal stattgefunden haben und aufgenommen worden sein, braucht aber selbst nicht öffentlich gewesen sein (vgl. Dreyer/Kotthoff/Meckel, Urheberrecht, § 21 Rn. 5, 8, 3. Auflage 2013, Verlag Hüthig Jehle Rehm GmbH).
Damit dieses Wiedergaberecht einschlägig ist, muss ein Vortrag nach § 19 Abs. 1 UrhG, damit also ein Sprachwerk, durch Abspielen von einem Bild- oder Tonträger öffentlich wiedergegeben werden. Auch diese Vorschrift bezieht sich auf alle analogen oder digitalen Datenträger jeglicher Art, die geeignet sind, Texte und Musik wiederzugeben. Werden somit Texte mittels Powerpoint-Präsentation, Dia- oder Overheadprojektor durch einen Anderen als den Urheber ohne dessen Einwilligung wiedergegeben, liegt ein Verstoß gegen § 21 UrhG vor (vgl. Dustmann, a. a. O., § 21 Rn. 8; Dreyer/Kotthoff/Meckel, a. a. O., § 21 Rn. 14).
Die alleinige Möglichkeit der Wahrnehmung reicht wohl allerdings für den Tatbestand des § 21 UrhG nicht aus, da hierfür die tatsächlich unmittelbar wahrnehmbare (ggf. spätere) Wiedergabe erforderlich ist.
Schranken des Urheberrechts
Die §§ 44a ff. UrhG unterstellen diese ausschließlichen Verwertungs- und Wiedergaberechte des Urhebers aber einigen Schranken.
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist (§ 51 UrhG). Insbesondere ist dies zulässig, wenn nach Satz 2 Nr. 2 Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden. Hierbei ist jedoch stets die Vorschrift des § 63 UrhG über die Erfordernisse einer Quellenangabe zu beachten.
Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 UrhG ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werks beispielsweise zulässig, wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und im Falle des Vortrags oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden Künstler eine besondere Vergütung erhält.
Maßgeblich erscheint dem Verfasser für die hier behandelte Problematik vor allem die Einschränkung des § 53 UrhG zu sein.
Danach sind gemäß Absatz 1 grundsätzlich einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern zulässig, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen und soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird.
Unter Privatgebrauch wird der Gebrauch in der Privatsphäre zur Befriedigung rein persönlicher Bedürfnisse durch die eigene Person oder die mit ihr durch ein persönliches Band verbundenen Personen verstanden (vgl. Wilhelm Nordemann in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, § 53 UrhG Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, Rn. 6, 10. Auflage 2008, Verlag W. Kohlhammer). Der Privatgebrauch muss ausschließlich sein, d. h. er darf weder mittelbar noch unmittelbar daneben Erwerbszwecken dienen. Jeglicher Zusammenhang mit dem Beruf muss deshalb aus Sicht des Verfassers ausgeschlossen sein.
Eine weitere Einschränkung liegt darin, dass auch zum Privatgebrauch nur einzelne Kopien hergestellt werden dürfen. Bei der Anzahl der Kopien, bei denen das Merkmal „einzelne“ noch als erfüllt angesehen werden kann, wird nicht ganz einheitlich beurteilt. Die Rechtsprechung geht von maximal 7 Stück aus, während Stimmen in der Literatur maximal drei Stück als zulässig erachten (vgl. W. Nordemann, a. a. O., § 53 Rn. 13).
Gemäß § 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UrhG ist es beispielsweise auch zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken dient. Zum wissenschaftlichen Gebrauch meint eine wissenschaftliche Betätigung, wobei zur Wissenschaft nur das an einer Universität oder Hochschule Gelehrte zählt. Ein Arzt, der für eine medizinische Zeitschrift einen Aufsatz verfasst, ist danach wissenschaftlich tätig. Die Kopie ist zu diesem Zweck geboten, wenn der Erwerb oder die Ausleihe eines Werkexemplars unzumutbar sein würde (vgl. W. Nordemann, a. a. O., § 53 Rn. 19). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn hierdurch zu hohe Kosten entstehen oder ein zu hoher Beschaffungsaufwand verursacht werden würde.
Ferner ist nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a die Herstellung einzelner Vervielfältigungsstücke erlaubt zum sonstigen eigenen Gebrauch, wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes handelt. Unter einem kleinen Teil versteht die Rechtsprechung den Fall, dass der Gesamtumfang im Verhältnis zum Gesamtwerk noch als klein erscheint. Abzustellen ist wohl stets auf den jeweiligen Einzelfall, wobei prozentual in der Regel zwischen 10% und 20% als Maßstab herangezogen werden (vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27.05.1987, AZ: 6 U 31/86; W. Nordemann, a. a. O., § 53 Rn. 28).
§ 53 Abs. 6 Satz 1 UrhG verbietet jedoch sowohl die Verbreitung, als auch die öffentliche Wiedergabe der Vervielfältigungsstücke für alle Fälle der Absätze 1-5.
Die wichtigste Vorschrift für den Referenten stellt in diesem Zusammenhang § 53 Abs. 7 UrhG dar, der von dem in § 53 UrhG festgelegten Vervielfältigungsrecht wiederum eine Ausnahme macht. Denn hiernach ist die Aufnahme von öffentlichen Vorträgen, von Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die Rechte des Urhebers sind hier somit vorrangig. Dies bedeutet auch, dass die Einwilligung ausschließlich vom vortragenden Referenten erteilt werden kann.
Nach Ansicht des Verfassers gibt § 53 Abs. 7 UrhG den Referenten somit eine Rechtsgrundlage an die Hand, den Teilnehmern des Vortrags die Aufnahme oder den Mitschnitt des Vortrags zu verbieten, wenn dies nicht gewollt ist.
Sonstige Rechte/Rechtsfolgen
Bei Verstoß gegen das Urheberrecht oder ein sonstiges durch das Urhebergesetz geschütztes Recht kann der Berechtigte die Beseitigung der Beeinträchtigung sowie bei Wiederholungsgefahr Unterlassung verlangen. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht (§ 97 Abs. 1 UrhG). Zudem kann ein Schadensersatzanspruch des Berechtigten entstehen, wenn die verletzende Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vorgenommen wird (§ 97 Abs. 2 UrhG).
Gemäß § 22 Satz 1 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Wird also ein Foto des Referenten ohne dessen Einwilligung gemacht und dieses verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt, so kann hierin grundsätzlich ein Verstoß gegen diese Vorschrift gegeben sein. Satz 2 bestimmt aber, dass die Einwilligung im Zweifel als erteilt gilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Ob der Erhalt eines Referentenhonorars grundsätzlich ausreicht, damit diese Vermutungswirkung eintritt, wird nach Auffassung des Verfassers jedoch stark bezweifelt. Maßgeblich sind aber immer die Umstände des konkreten Einzelfalls.
Des Weiteren legt § 23 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 KunstUrhG fest, dass eine Einwilligung zur Verbreitung und zur Schaustellung nicht erforderlich ist bei Bildern, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen oder bei Bildern von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Allerdings gilt dies gemäß Absatz 2 nur soweit, solange durch die Verbreitung oder Schaustellung kein berechtigtes Interesse des Abgebildeten verletzt wird. § 33 KunstUrhG sieht bei einem Verstoß gegen §§ 22, 23 KunstUrhG eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor, wobei die Tat nur auf Antrag verfolgt wird.
Auch zivilrechtlich kämen grundsätzlich ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch bei Verletzung bzw. Beeinträchtigung des Rechts am eigenen Bild analog § 1004 Abs. 1 BGB in Betracht.
Anspruchsgegner, also derjenige gegen den der Urheber seine berechtigten Ansprüche geltend machen kann, ist aus Sicht des Verfassers stets derjenige, der die Urheberrechtsverletzung unmittelbar begangen hat.
Fraglich ist, ob zudem der Veranstalter als Störer in Anspruch genommen werden kann, wenn dieser die Teilnehmer ungehindert während des Vortrags fotografieren oder aufnehmen lässt. Die Störerhaftung beruht auf dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass jeder, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahrenquelle schafft oder andauern lässt, die ihm zumutbaren Maßnahmen und Vorkehrungen treffen muss, die zur Abwendung der daraus Dritten drohenden Gefahr notwendig sind (vgl. BGH, Urteil vom 12.07.2007, Az.: I ZR 18/04). Als Störer kann dabei grundsätzlich jeder haften, der – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Art und Weise willentlich und adäquat kausal an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat. Dabei kann als Mitwirkung auch die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern der in Anspruch Genommene die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte (vgl. BGH, Urteil vom 10.10.1996 – I ZR 129/94). Folglich käme auch der Veranstalter als Störer in vorgenannter Fallkonstellation grundsätzlich in Betracht. Da nach ständiger Rechtsprechung die Störerhaftung aber nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von Prüfungspflichten (speziell im Urheberrecht) voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen eine Prüfung auf mögliche Rechtsverletzungen zuzumuten ist (vgl. BGH, Urteil vom 11.03.2004 – I ZR 304/01). Auch müssen sich die sonstigen Vorkehrungen zur Verhinderung von Rechtsverletzungen im Rahmen des Zumutbaren halten (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 16.05.2012 – 23 S 296/11). Sofern also der Veranstalter besondere Vorkehrungen zur Verhinderung einer Urheberrechtsverletzung im Vorfeld getroffen hat, beispielsweise durch spezielle Hinweise auf das Verbot der Aufnahme bzw. des Fotografierens, muss nach Auffassung des Verfassers anhand der Gesamtumstände im konkreten Einzelfall geprüft werden, ob es diesem zumutbar ist, weitere Schutzvorkehrungen zu treffen bzw. ob dieser ihm alles Zumutbare unternommen hat, um Urheberrechtsverletzungen im Rahmen seiner Veranstaltung zu verhindern. Nach Meinung des Verfassers ist es deshalb auch dem Veranstalter, sofern dieser beim Vortrag selbst anwesend ist, zumutbar, die gegen das Urheberrecht verstoßenden Teilnehmer zur Unterlassung aufzufordern und anzuhalten. Ob es ihm auch zumutbar ist, einzelne Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen, wird im jeweiligen Einzelfall zu prüfen sein und wohl nur bei schwerwiegenden oder beharrlichen Verstößen vertretbar sein. Ist der Veranstalter hingegen nicht vor Ort, so endet aus Sicht des Verfassers dessen Verantwortungsbereich und es beginnt hier die eigenständige Verantwortlichkeit des Referenten, sodass dieser selbst die Teilnehmer zur Beseitigung bzw. Unterlassung auffordern muss.
Zusammenfassung
Die Video- oder Audioaufnahme bzw. der Mitschnitt eines öffentlichen Vortrages auf Bild- oder Tonträger ist nach Meinung des Verfassers in jedem Falle nur mit Einwilligung des Urhebers (hier des Referenten) zulässig. Das Abfotografieren vom Referenten erstellter Folien etc. ist in der Regel nur für einzelne (also wenige) Vervielfältigungen und nur in bestimmten Fällen, wie beispielsweise zum ausschließlichen Privatgebrauch, auch ohne Einwilligung zulässig. Ein Bildnis des Referenten darf zudem grundsätzlich nur mit dessen Einwilligung verbreitet oder zur Schau gestellt werden.
Folglich können unberechtigte Foto-/Video-/Audioaufnahmen von Vorträgen zu diversen urheberrechtlichen Verletzungen mit entsprechenden negativen Konsequenzen, wie Beseitigungs-, Unterlassungs- oder auch Schadensersatzansprüchen des in seinem Urheberrecht Verletzten, führen.
Heberer J. Das Urheberrecht bei Vorträgen. Passion Chirurgie. 2014 April; 4(04): Artikel 06_01.