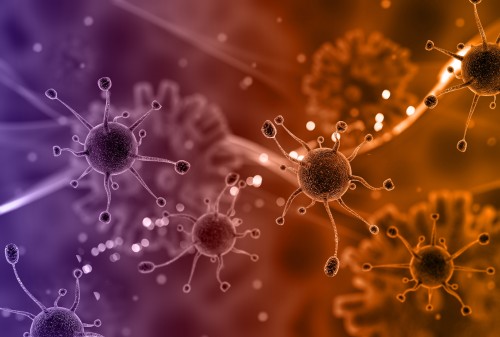Aktuelle und relevante Informationen zur Corona-Krise für BDC-Mitglieder
Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen werden die Menschen weltweit noch lange in Atem halten. Der Informationsbedarf insbesondere auch für Chirurgen in der Klinik wie in der Niederlassung ist immens. Der BDC hat darauf rasch reagiert und für seine Mitglieder ein Informationsangebot auf der BDC-Website eingerichtet, das fortlaufend aktualisiert wird. BDC-Fachartikel, Verlinkungen zu vertiefenden Inhalten, E-Learning-Tools, Musterverträge und vieles mehr finden sich zu medizinischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Themenfeldern und sollen helfen, Überblick zu behalten in Zeiten, die unübersichtlich sind wie selten zuvor.

Medizinstudierende protestieren gegen sogenanntes Hammerexamen
Prüfungstermine der Medizinstudierenden kräftig durcheinander. Aufgrund der festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite hat das Bundesgesundheitsministerium nun eine Verordnung erlassen, wonach der zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) verschoben wird. De facto werden die Bundesländer in die Lage versetzt, die Durchführung der M2 festzusetzen – und diese haben höchst unterschiedliche Vorstellungen davon, wann die Prüfungstermine stattfinden sollen.
Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) protestiert jetzt gegen die Empfehlung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) und des Medizinischen Fakultätentags (MFT), das für April geplante große schriftliche Staatsexamen (M2) auf das Jahr 2021 zu verschieben. Damit sich die Studienzeit für die Medizinstudierenden nicht unnötig verlängert, sollen für das M2 bereits zugelassene Studierende direkt ins PJ entlassen werden. Für die Studierenden heißt das, nach dem PJ zwei große Prüfungen ablegen zu müssen: das M2 und die praktische M3-Prüfung. Darüber hinaus kritisiert der bvmd den entstandenen föderalen Flickenteppich: „Den aktuellen Aussagen vieler Landesprüfungsämter sowie Fakultäten zufolge, können PJ-Tertiale lediglich in Bundesländern absolviert werden, die die gleiche Entscheidung bezüglich Verschiebung oder Durchführung des M2 getroffen haben,
wie das Bundesland der Heimatuniversität. Dies bedeutet, dass unzählige Studierende bereits geplante PJ-Tertiale an ihrem potenziellen Wunscharbeitsort absagen und teilweise hohe Kosten von bereits gemieteten oder sogar gekauften Wohnungen tragen müssen.“

EU-Kommission verschiebt umstrittene Medizinprodukte-Verordnung
Die Medizintechnikbranche hat lange gegen die Medical Device Regulation (MDR) gekämpft. Zum 26. Mai dieses Jahres sollte die umstrittene Verordnung in Kraft treten: Sie sieht insbesondere deutlich strengere Zulassungsanforderungen für Medizinprodukte innerhalb der EU vor. Jetzt wurde sie wieder außer Kraft
gesetzt – für ein Jahr wird der Start der novellierten EU-Medizinprodukteverordnung aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben.
Branchenverbände haben sich insbesondere im Hinblick auf kleine und mittlere Unternehmen immer wieder für einen späteren Start der MDR eingesetzt, damit diese mehr Zeit gewännen, sich auf die strengeren Auflagen wie beispielsweise Dokumentationspflichten und Studienanforderungen einzustellen. Auch die Anzahl der sogenannten Benannten Stellen, die die Zulassung der Produkte, durchführen war bislang zu gering, um zügig die Verfahrensabwicklung zu gewährleisten. In der Corona-Krise befürchtet die EU-Kommission bei einem gleichzeitigen Geltungsbeginn der MDR weitere Versorgungs- und Lieferengpässe von Medizinprodukten.
Anzahl der Linkshänder geklärt
Linkshänder gibt es weniger als Rechtshänder – nach dem Grundschulbesuch weiß das ein jeder. Ein Forscherteam an der Fakultät Psychologie der Ruhr-Universität Bochum kann jetzt genau die Anzahl der Linkshänder beziffern: Die Linkshänder-Quote beträgt 10,6 Prozent.
Als Linkshänder werden oft die Menschen bezeichnet, die mit der linken Hand schreiben. Die Studie um Privatdozent Dr. Sebastian Ocklenburg berücksichtigte aber die Tatsache, dass etwa neun Prozent der Menschen verschiedene Hände für verschiedene Arbeiten nutzen. Das sorgte für genauere Ergebnisse. In die Studie wurden Daten von fünf Meta-Analysen von insgesamt 2.396.170 Personen einbezogen.