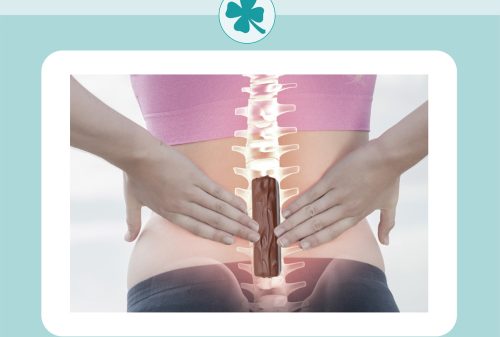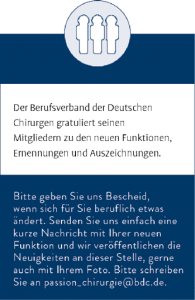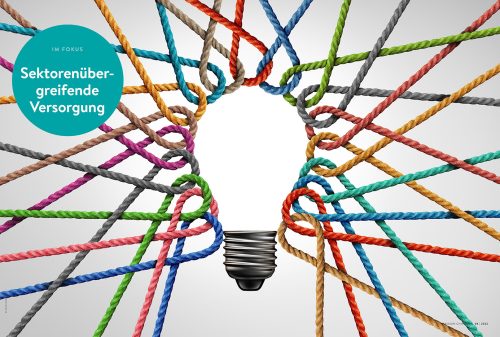In ihrem Koalitionsvertrag von Anfang Dezember 2021 haben SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP einen Abschnitt auch der Thematik „Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung“ gewidmet. Darin geht es um die sogenannte sektorenübergreifende Patientenversorgung. Dort ist unter anderem von der „Ambulantisierung bislang unnötig stationär erbrachter Leistungen“ die Rede, die zügig über eine sektorengleiche Vergütung durch „Hybrid-DRGs“ gefördert werden soll. Außerdem sind integrierte Gesundheits- und Notfallzentren erwähnt. Und auch, dass man die ambulante Bedarfs- und stationäre Krankenhausplanung mit den Ländern zu einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung weiterentwickeln möchte.
Wir haben dazu den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, acht Fragen gestellt. So haben sie geantwortet:
Passion Chirurgie: Was verstehen Sie unter Hybrid-DRGs und wie stehen Sie zu ihrer geplanten Einführung zur sektorengleichen Vergütung?
Gerald Gaß: Hybrid-DRGs sind pauschale, fallbezogene Vergütungen für originäre Krankenhausleistungen, die einheitlich zur Anwendung kommen, unabhängig davon, ob die Behandlung des Patienten mehr oder weniger als 24 Stunden bzw. einen Kalendertag benötigt („ambulante Leistungen“ und „stationäre Leistungen“ = sektorenübergreifend).
Die für eine Hybrid-DRG geeigneten ambulant-klinischen Leistungen sind in Abhängigkeit von der patientenindividuellen Situation grundsätzlich ambulant durchführbar. Sie benötigen aber die Ausstattung und den multiprofessionellen Hintergrund eines Krankenhauses. Das kann durch die Komplexität des Eingriffs, durch risikoerhöhende Begleitumstände und/oder erhöhten prä- oder postoperativen Versorgungs- bzw. Überwachungsbedarf bedingt sein. Die für diese Vergütungsform geeigneten Leistungen sind zudem möglichst überschneidungsfrei festzulegen. Die Vergütung orientiert sich wie bei den bisherigen DRGs an Merkmalen, die den ökonomischen Schweregrad abbilden. Wegen der Aufhebung der spezifischen Vergütung für Kurzlieger für diese Leistungen resultiert für die entsprechenden Hybrid-DRGs grundsätzlich eine Mischfinanzierung.
Zur Einführung dieses neuen Vergütungssystems ist ein stufenweises Vorgehen vorzusehen, damit den Krankenhäusern die Gelegenheit gegeben wird, sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen. In der ersten Umsetzungsphase sollten auch finanzielle Anreize gesetzt werden. Die Hybrid-DRGs sollten sich daher zu Beginn eng an den Vergütungen für stationäre DRGs orientieren. Außerdem müssen und können dann die Prüfungen des MD für diesen neu geregelten Leistungsbereich vollständig entfallen. Damit ließe sich der extrem hohe Bürokratie-Aufwand im DRG-System verringern.
Andreas Gassen: Die sogenannten Hybrid-DRGs sind bislang ein eher politischer Begriff, der nicht genau definiert ist. Es gibt verschiedene Projekte und Modelle, die versucht haben, ambulante und stationäre Vergütungssysteme miteinander zu vereinbaren. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass es sinnvoller ist, sich zunächst auf bestimmte Leistungen zu konzentrieren und diese für die ambulante Leistungserbringung über neue Preismodelle attraktiv zu machen. Dass dieser Weg auch hierzulande funktioniert, zeigt sich im ophthalmochirurgischen Bereich am Beispiel der Kataraktoperation. Hier haben wir eine bundeseinheitliche Vergütungssystematik; das Ambulantisierungspotenzial bei Kataraktoperationen von 80 Prozent der Fälle wird seit Jahren ausgeschöpft.
Grundvoraussetzung solcher Preismodelle ist, dass die Vergütung den Aufwand widerspiegelt und den instrumentellen und personellen Erfordernissen entspricht. Ziel kann nicht sein, Versorgung nur einfach billiger zu machen, nach dem Motto „halber Aufwand, halbe Kosten“ – beides trifft nicht zu. Den Hybrid-DRGs ist eine Kostenkalkulation auf der Basis ambulanter Strukturen entgegenzusetzen, die zu einer angemessenen Vergütung für die Ambulantisierung führt. Leistungskatalog und -bewertungen müssen gemeinsam definiert und vertraglich vereinbart werden.
DRG-Elemente wie die Schweregradeinteilung und auch der Einbezug konservativer Leistungen werden durch die derzeitige Reform des §115b SGB V (ambulantes Operieren) adressiert, deren Umsetzung von der Entwicklung von Hybrid-DRGs differenziert zu betrachten ist. Daher sollte der Prozess der Umsetzung durch KBV, DKG und GKV-Spitzenverband abgewartet werden.
PC: Können Vertragsarztpraxen unter den aktuell geltenden Rahmenbedingungen an der sektorenübergreifenden Versorgung gleichermaßen wie Krankenhäuser partizipieren? Welche Schwierigkeiten sehen Sie?
GG: Es ist grundsätzlich nicht sinnvoll, Doppelvorhaltungen zu fördern und neue Strukturen aufzubauen. Für ambulante Operationen und Interventionen mit geringem Komplexitätsgrad und Risikoprofil eignet sich das Konzept des AOP-Katalogs. Sowohl Krankenhäuser als auch Vertragsärzte können diese Leistungen erbringen, indem sie auf bestehende Ressourcen zurückgreifen. Für diese Leistungen eignet sich auch eine grundsätzlich gleiche Vergütung, auch wenn diese einen erlösrelevanten Differenzierungsgrad aufweisen muss, wenn beide Sektoren gleichermaßen als Leistungserbringer in Frage kommen.
Bei ambulant-klinischen Leistungen hingegen ist es aus versorgungspolitischen und -ökonomischen Gründen sinnvoll, diese in den Krankenhäusern zu versorgen. Hier sind die notwendigen Ressourcen vorhanden und können für diese Leistungen genutzt werden, ohne zusätzliche Kosten im Gesundheitssystem zu verursachen. Doppelvorhaltungen werden sowohl im personellen als auch im investiven Bereich vermieden. Da die personellen Ressourcen aktuell und zukünftig noch stärker im Gesundheitsbereich äußerst limitiert sind, ist es aber sinnvoll, dass die Vertragsärzte in die Versorgung der ambulant-klinischen Leistungen auf kooperativer Basis eingebunden werden. Auf diese Weise können knappe ärztliche Ressourcen intelligent genutzt werden. Für die Vertragsärzte besteht dadurch ein grundsätzlicher Zugang zur ambulant-klinischen Versorgung.
AG: Tatsächlich führen die aktuell geltenden Rahmenbedingungen dazu, dass Vertragsärzte und -ärztinnen sowie Krankenhäuser unterschiedlich an der sektorenübergreifenden Versorgung partizipieren. Hierzu gehören der Erlaubnis- versus Verbotsvorbehalt, die lückenhafte bzw. unterschiedliche Kostenerstattung – etwa bei ambulanten Operationen – sowie die Budgetierung.
Im Bereich des ambulanten Operierens ist eine „Hybrid-Zone“ schon etabliert. Die meisten ambulanten Operationen werden durch Vertragsärzte erbracht. Durch die Erweiterung des Katalogs um konservative Leistungen können mehr Vertragsärzte und -ärztinnen an einer sektorenübergreifenden Versorgung teilnehmen. Hinsichtlich der Qualität der Leistungserbringung sind Vertragsärzte und -ärztinnen vollauf konkurrenzfähig und könnten noch mehr machen. Generell werden zu viele Fälle noch kurzstationär und nicht ambulant versorgt, da die Vergütungsanreize für eine Verlagerung in die ambulante Versorgung nicht ausreichend sind. Sektorenübergreifend kann auch bedeuten, längere Nachbeobachtungszeiten zuzulassen. Hierfür braucht es keine vollstationären Einheiten, sondern es reichen auch sog. Low-care oder Observation-care-Einheiten aus – Leistungen, die auch von Vertragsärzten erbracht werden können.
PC: Welche Herausforderungen kommen speziell auf die Kliniken zu? Sind die Hybrid-DRGs am Ende ein Mittel zur Strukturbereinigung?
GG: Die Hybrid-DRGs sollen dazu beitragen, die Behandlungsformen am Krankenhaus weiterzuentwickeln. Sie sollten daher einen Anreiz setzen, die Anzahl vollstationärer Behandlungen entsprechend der medizinischen Möglichkeiten sukzessive zu reduzieren, ohne Brüche in den zur Verfügung stehenden Budgets zu verursachen und ohne eine ungezielte bzw. ungesteuerte Veränderung der Krankhausstrukturen bzw. eine Gefährdung der Versorgungsicherheit nach sich zu ziehen. Die Krankenhäuser können bei geeigneten Rahmenbedingungen sukzessiv Prozesse und Strukturen aufbauen, sodass im ambulant-klinischen Bereich zunehmend Patientinnen und Patienten versorgt werden können. Grundsätzlich führt aber die Reduktion vollstationärer Behandlungen tendenziell auch zu einem Abbau entsprechender Kapazitäten.
AG: Ich würde nicht das Wort Bereinigung, sondern Anpassung verwenden. Sektorenübergreifende Versorgung ist als politisches Vorhaben ein Dauerbrenner, jetzt aber haben wir eine echte Chance, etwas zu bewegen. Grundsätzlich ist allen Beteiligten klar, dass der Prozess der Ambulantisierung nicht aufzuhalten und sowohl im Hinblick auf Ressourcenallokation als auch auf die Patientenversorgung sinnvoll ist. Ziel des Gesetzgebers sollte sein, stationäre Behandlungen zugunsten ambulanter Leistungen zu reduzieren, zum Beispiel Kurzlieger-Eingriffe.
PC: Welches Leistungsspektrum sollte ein künftiger Katalog sektorengleich anzuwendender Hybrid-DRGs nach Ihrer Auffassung beinhalten und was bedeutet dies mit Blick auf mögliche Budgetplanungen?
GG: Die entsprechenden Leistungen müssten noch nach den dargestellten Prinzipien definiert werden. Wichtig wäre, mit einem kleinem Leistungsspektrum zu beginnen und diesen dann im weiteren Verlauf zu erweitern. Das gibt den Krankenhäusern die Möglichkeit, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Da auch niedergelassene Ärzte an dem neuen Versorgungsmodell teilnehmen können, sind hier Kooperationen mit Rahmenbedingungen und Abläufen zu klären und zu vereinbaren.
AG: Wie gesagt: Das Potenzial ambulant zu erbringender Leistungen ist in Deutschland noch nicht annähernd ausgeschöpft. Wenn man das täte, wäre die logische Folge die Bereinigung ambulanter Leistungen aus den Krankenhausbudgets. Wir sind gerade dabei, uns mit der DKG auf einen entsprechenden Katalog zu verständigen, den wir als KBV auch eher breit definieren würden. Wenn die Klinikkollegen dann aber mit gleicher Qualifikation und Qualität ambulante Leistungen erbringen, dann müssen sie das natürlich auch abrechnen können. Dafür brauchen wir keinen dritten Sektor. Es müssen nur die gleichen Spielregeln gelten. Das erkennen die Kliniken mittlerweile an.
PC: Was halten Sie von dem Ansatz einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung?
GG: Das befürworten wir ausdrücklich. Das Land benötigt dazu zusätzliche Kompetenzen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgungsplanung, die über die Ansätze des Koalitionsvertrags, wie der Bestätigung der Beschlüsse des Zulassungsausschusses, hinausgehen sollten.
AG: Der Vorschlag als solcher ist nicht neu. Das Problem ist die fehlende Transparenz der vorhandenen nicht vertragsärztlichen Versorgungsstrukturen. Wir bräuchten zunächst einen bundesweiten Rahmen für die Meldung planungsrelevanter Daten. Der Gemeinsame Bundesausschuss könnte sektorenübergreifende Planungsgrundsätze etablieren. Was wir als KBV jedoch ablehnen, ist eine Verschiebung der Planungsebene auf die Länder und die damit einhergehende Schwächung der Selbstverwaltung.
PC: Wie interpretieren Sie die Aussage im Koalitionsvertrag, dass Versorgung an der Sektorengrenze zukünftig in integrierten Gesundheitszentren stattfinden soll?
GG: Wir interpretieren das so, dass Krankenhäusern in Kooperation mit vertragsärztlichen Leistungserbringern die Möglichkeit eingeräumt wird, Gesundheitszentren im Sinne angedockter „Satelliten“ aufzubauen. Diese sind eigenständig oder in Zusammenarbeit mit vertragsärztlichen Leistungserbringern in Regionen vorzusehen, in denen keine wohnortnahe Krankenhausversorgung mit ambulantem Leistungsspektrum gewährleistet ist. Sie würden dadurch bestehende Versorgungslücken auffangen oder vermeiden. Dazu bedarf es der Vorhaltung verschiedener Fachbereiche und entsprechender Nachbetreuungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass die Länder nach Rahmenkriterien mögliche Standorte für Gesundheitszentren ausweisen.
AG: Es ist grundsätzlich erfreulich, dass der Koalitionsvertrag das Konzept der Integrierten Gesundheitszentren (IGZ) der KBV aufgreift. Dieses sollte allerdings vom ambulanten System und nicht vom Krankenhaus aus gedacht werden und nicht als reiner „Rettungsanker“ für kleinere Häuser, indem diese weiter für die ambulante Versorgung geöffnet werden. Das Ansinnen, auch kurzstationäre Versorgung hier zu integrieren, ist sinnvoll.
PC: Was bedeutet der Aufbau integrierter Gesundheitszentren für die aktuellen Versorgungsstrukturen der Praxen und Krankenhäuser? Wird es zu einer verstärkten Umwandlung aktuell vorherrschender Strukturen kommen?
GG: Integrierte Gesundheitszentren könnten ein Weg sein, um eine flächendeckende Versorgung mit medizinischen Leistungen zu unterstützen. Allerdings ist noch zu klären, wie die Integrierten Gesundheitszentren konkret auszugestalten sind. Außerdem sollten diese nicht für mehr oder weniger zufällig entstehende Lücken in der stationären Versorgung vorgesehen werden, sondern die sektorenübergreifende Krankenhausplanung als zusätzliches Instrument ergänzen.
AG: Eine Umwandlung flächendeckend im großen Stil sehe ich bislang nicht, aber das Potenzial ist vorhanden. Ziel ist nicht, jemandem etwas wegzunehmen und z. B. Krankenhäuser „auf Teufel komm raus“ zu schließen. Vielmehr sollte es darum gehen, Synergien zu schaffen, Personal und Ausstattung sinnvoll einzusetzen und Standorte als solche zu erhalten – und damit auch die Versorgung vor Ort.
PC: Sehen Sie die neuen Pläne der Ampelkoalitionäre als Bedrohung? Wo liegen die Chancen?
GG: Als Chancen sehen wir die Absicht der Koalitionsparteien, moderne und zukunftsweisende Versorgungsformen zu entwickeln und zu implementieren. Risiken sehen wir, falls die Umsetzung keine ausreichenden Spielräume für die Krankenhäuser vorsieht, sich auf die neuen Bedingungen inhaltlich und strukturell einzustellen, oder finanzielle Anreize vermissen lässt, damit die neuen Möglichkeiten auch in der ersten Umsetzungsphase wirtschaftlich tragfähig sind. Die Innovationsbereitschaft der Krankenhäuser darf keine finanziellen Risiken nach sich ziehen, die bedarfsnotwendige Standorte wirtschaftlich gefährdet. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin sehr belastenden Situation der Corona-Pandemie und der äußerst angespannten finanziellen Lage vieler Krankenhäuser.
AG: Die Ambulantisierung schreitet voran, allein schon durch den medizinisch-technischen Fortschritt. Bisher war diese Entwicklung häufig eine Einbahnstraße im Sinne einer Öffnung der Krankenhäuser. Mit der Reform des Paragrafen 115b SGB V haben wir derzeit die erste Chance auf tatsächlich „gleich lange Spieße“. Wünschenswert wäre – und die Zeichen hierfür sind positiv –, dass die Gestaltung der sektorenübergreifenden Versorgung mit- und nicht in Konkurrenz zueinander geschieht. Das gilt es bei der Entwicklung von Hybrid-DRGs aufzunehmen. Auch deshalb verwahren wir uns gegen Tendenzen im Koalitionsvertrag, die Selbstverwaltung bei der Umsetzung an die Kandare zu legen.
Gaß G, Gassen A: Wie sehen KBV und DKG die geplante Neuordnung an der Sektorengrenze ambulant/stationär? Passion Chirurgie. 2022 April; 12(04): Artikel 03_01.