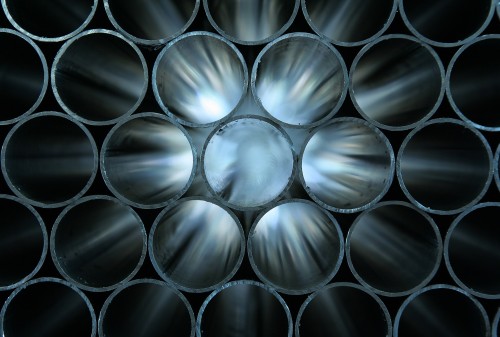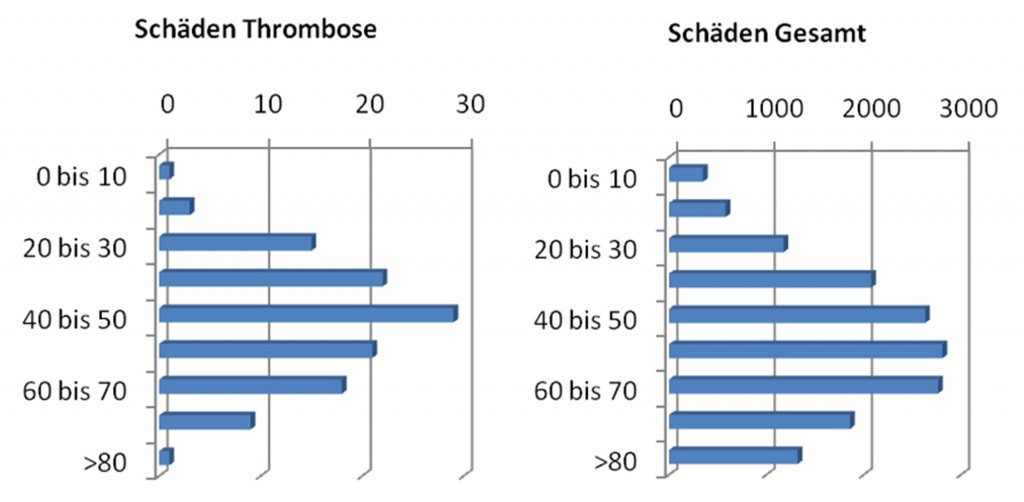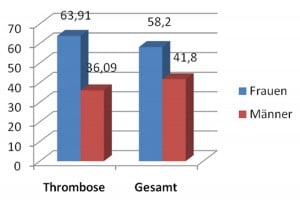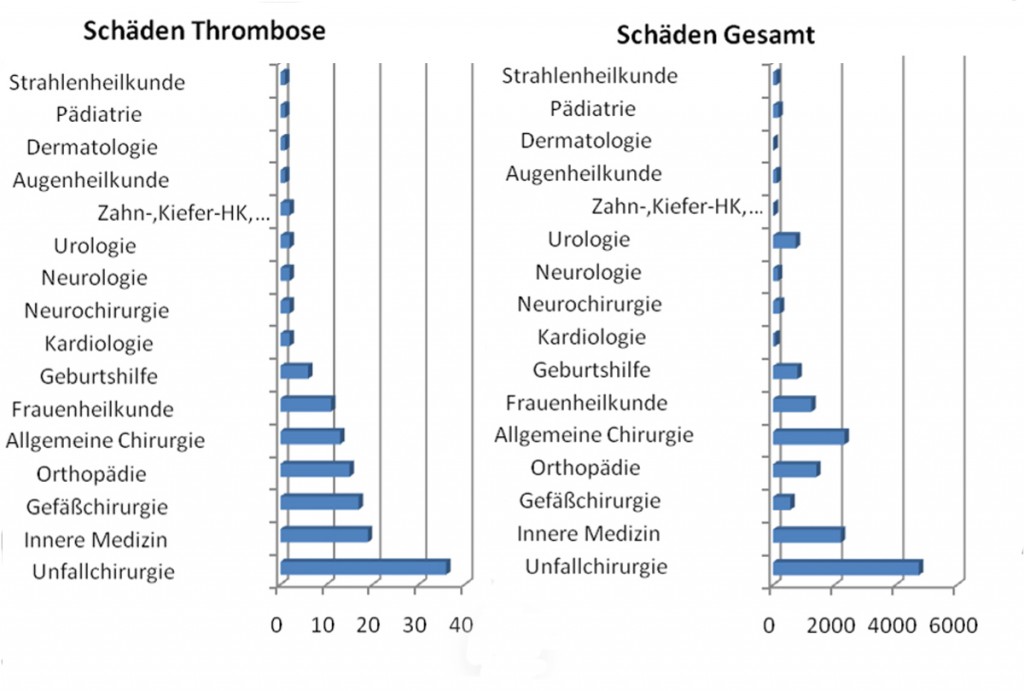Die Verunsicherung in der Ärzteschaft ist groß. Hat die Behandlung nicht den gewünschten Erfolg gebracht, hat sich eine Komplikation verwirklicht oder ist es gar zu einem ernsten Zwischenfall mit einem Schaden für den Patienten gekommen, stellt sich für den Arzt die Frage: Was ist jetzt das richtige Verhalten, ohne für mich persönlich, die Praxis oder das Krankenhaus Nachteile zu schaffen? Was muss nun in jedem Fall erfolgen? Darf ich in das Gespräch mit dem Patienten bzw. den Angehörigen gehen und wenn ja, wie offen darf ich die Kommunikation führen?
Sehr fest verankert ist in der Ärzteschaft die Meinung, ein offenes Gespräch führe zu einem Anerkenntnis, was wiederum den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge habe. Dies führt nicht selten dazu, dass das Gespräch mit dem Patienten unterbleibt. Es mag Berufsträger geben, denen der Verweis auf den Versicherungsschutz zur Umgehung eines Gespräches willkommen sein mag. Vielen Ärzten ist es jedoch gerade in einer solchen Situation ein großes Bedürfnis, mit dem Patienten ein aufrichtiges Gespräch zu führen, um das Vertrauensverhältnis mit dem Patienten zu schützen und eine rasche Klärung und Aufarbeitung in die Wege leiten zu können.
Ein Szenario eines Schadenfalles könnte etwa wie folgt aussehen:
Der in einem künstlichen Tiefschlaf befindliche beatmete Patient muss einer MRT-Untersuchung unterzogen werden. Danach zeigen sich Verbrennungen am dritten und vierten Finger. In der Folge muss der dritte Finger amputiert und der vierte Finger mit einem Hauttransplantat versehen werden. Die Untersuchung der Ursachen des Falles ergibt, dass das zur Überwachung angelegte Pulsoximeter bei der Untersuchung am Finger belassen werden musste. Durch eine Lageveränderung kann es zu einem Kontakt des Kabels mit den Fingern gekommen sein, was wahrscheinlich die Verbrennung verursacht hat. In der Folge dieses Ereignisses wird ein Gespräch mit den Angehörigen nicht geführt. In der späteren ärztlichen Stellungnahme findet sich das Zitat des Arztes: „Bisher wurden uns gegenüber keine Fragen gestellt“. Im Ergebnis kommt es zu einer Anzeige der Angehörigen bei der Staatsanwaltschaft, die ein Ermittlungsverfahren einleitet mit der Folge, dass die Krankenunterlagen beschlagnahmt werden. Der unterdessen eingeschaltete Rechtsanwalt erhebt Klage auf Schmerzensgeld und Schadensersatz.
Die Frage ist, was sollen die Ärzte, die Pflegekräfte oder das Management in einer solchen Situation tun?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sollte man die Ziele definieren, die mit einem richtigen Verhalten erreicht werden sollten:
- Vermeidung einer streitigen oder konträren Auseinandersetzung. Es darf keineswegs als ein Automatismus angesehen werden, dass es bei dem Misslingen einer Behandlung stets zu einer streitigen Auseinandersetzung bis hin zu einem Gerichtsverfahren kommen muss. Selbst für den Fall, dass der Patient Schadensersatz begehrt, kann dies konstruktiv und für beide Seiten zufriedenstellend gelöst werden.
- Vermeidung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. In einem solchen Verfahren wird stets die persönliche Schuld des Einzelnen geprüft mit der Gefahr, dass die Sanktionen auch den Einzelnen treffen. Allein die Durchführung eines solchen Verfahrens – unabhängig von dessen Ausgang – kann für den Arzt zu empfindlichen Konsequenzen führen.
- Es sollte alles dafür getan werden, Medienaufmerksamkeit zu verhindern. Eine Berichterstattung zu diesem Thema zielt in der Regel nicht auf eine Sachaufklärung, sondern eine Schlagzeile ab. Die Gefahr eines Imageschadens mit entsprechenden wirtschaftlichen Folgen ist groß.
- Es geht auch um die Frage, wann verliere ich meinen Versicherungsschutz und was kann ich gegen einen Verlust tun.
- Vermeidung von Handlungen, die einem im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung möglicherweise zum Nachteil gereichen würden.
- Zu denken ist aber auch daran, das verlorene Vertrauen des Patienten wiederzugewinnen. Bei einem Schadenfall geht meist – in unterschiedlichem Ausmaß – das Vertrauen des Patienten in den Arzt verloren. Dies muss nicht als etwas Unumstößliches hingenommen werden. Es besteht die Chance, das Vertrauen wiederzugewinnen. Diese Chance sollte genutzt werden.
Um herauszubekommen, wie man diese Ziele erreichen kann, macht es Sinn, sich in die Perspektive des Patienten zu versetzen. Wie nimmt ein Patient einen Fehler oder das Auftreten einer Komplikation wahr? Untersuchungen [1] zeigen, dass der Patient insbesondere mit der Art und dem Ausmaß der Informationen unzufrieden ist, die er im Zusammenhang mit einem Zwischenfall erhält. Er ist frustriert darüber, keine überzeugende Erklärung für das Geschehene zu erhalten und – so die Ergebnisse – entsteht bei dem Patienten aus der Art und Weise der Informationsvermittlung der Eindruck, dass der Arzt letztlich kein wirklich großes Interesse oder Mitgefühl an die Situation des Patienten aufbringe. Andere Studien [2] sind der Frage nachgegangen, was das Ziel des Patienten von einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist. So gibt etwa die Hälfte an, dass dies eine Möglichkeit sei, das genaue Geschehen detailliert ermitteln zu können. Zu in etwa gleichem Anteil steht der Wunsch des Patienten nach dem Ausdruck des Bedauerns für das Geschehene. Weiter wird als Zielrichtung eines Gerichtsverfahrens genannt, dass der Patient eine Erläuterung erhält, was genau bei der Behandlung geschehen ist. Bei nur etwa einem Drittel steht das Bedürfnis nach finanzieller Entschädigung im Vordergrund.
Initiale Reaktion [3]
Bei einem Schadenfall gilt die erste Aufmerksamkeit stets dem betroffenen Patienten. Es ist alles zu tun, um den aufgetretenen Schaden zu begrenzen und – wenn möglich – dessen Folgen zu reduzieren. Hat der Auslöser des Schadens das Potenzial, auch andere Patienten zu schädigen (z. B. möglicherweise im Falle einer Infektion), ist das Notwendige zu tun, um eine Ausweitung des Schadens auf andere abzuwehren.
Bereits danach geht es darum, die notwendige interne und externe Kommunikation in Gang zu setzen und deren Wege zu steuern. Der Chefarzt ist – sollte er nicht bereits involviert sein – zu informieren. Dieser wird die Rechtsabteilung in Kenntnis setzen, damit etwa die Frage der Einschaltung des Versicherers oder eines Rechtsanwaltes geklärt werden und auch eine Abstimmung zu rechtlichen Fragen erfolgen kann. Abhängig vom Ausmaß des Schadens und des Potenzials, dass der Schaden Auswirkung auf das Krankenhaus als Unternehmen hat, wird er auch die Geschäftsführung unterrichten. Zu guter Letzt sollten – zumindest die an der Behandlung des Patienten betroffenen – Mitarbeiter über den Vorfall und die bis dahin vorliegenden Erkenntnisse unterrichtet werden. Dies ist notwendig für die weitere Behandlung des und den Umgang mit dem Patienten, um möglichst Gerüchte im Haus zu vermeiden und um damit gleichzeitig die Mitarbeiter darauf hinzuweisen, nicht selber und eigenständig Informationen an Dritte herauszugeben.
Es ist sehr wichtig, dass eine Kommunikationsbasis gefunden und gepflegt wird.
Hiermit korrespondiert die Entscheidung und Festlegung darüber, wer in der Folge die federführende Kommunikation übernimmt. Dies gilt für die Gespräche mit dem Patienten, mit den Angehörigen oder auch bei Anfragen von außen, beispielsweise durch die Presse. Nur so kann verhindert werden, dass unkontrolliert Informationen weitergegeben werden, die nicht abgestimmt und damit gegebenenfalls nicht im Sinne des Arztes bzw. des Krankenhauses sind. Wichtig ist, dass das Krankenhaus in einer solchen Situation „aus einem Munde“ spricht.
Die unmittelbar an dem Geschehen beteiligten Mitarbeiter sollten bei schwerwiegenden Ereignissen ein Gedächtnisprotokoll fertigen. Der Prozess des Vergessens tritt sehr schnell ein, sodass das Gedächtnisprotokoll in erster Linie als Gedankenstütze dient. Mithilfe eines Gedächtnisprotokolls kann – auch zu einem späteren Zeitpunkt – sehr viel besser das tatsächliche Geschehen aufgeklärt werden. Es gilt nicht als Teil der Behandlungsunterlagen und ist deshalb gesondert aufzubewahren.
Bei dem nächsten Kontakt mit dem Patienten beziehungsweise seinen Angehörigen sollte unbedingt Gesprächsbereitschaft signalisiert werden. Es ist sehr wichtig, dass eine Kommunikationsbasis gefunden und gepflegt wird. Hierin liegt eine wesentliche Weichenstellung dafür, ob die weitere Aufarbeitung des Schadenfalles als Konflikt oder in einem konstruktiven Miteinander gelingt.
Die Dokumentation ist zu überprüfen. Wurde alles vollständig und richtig festgehalten? In einer solchen Situation ist die Dokumentation besonders wichtig, da die spätere medizinische und juristische Bewertung wahrscheinlich ist. Zudem besteht jetzt die Verpflichtung zu einer besonders sorgfältigen Dokumentation. Sollte sich bei der Überprüfung herausstellen, dass Ergänzungen zu erfolgen haben, sind diese gemäß den Vorgaben des Patientenrechtegesetzes vorzunehmen. Gem. § 630g Abs. 1 Satz 2 BGB sind Berichtigungen und Änderungen zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind.
Sind die Erstmaßnahmen erfolgt, ist zu erwägen, sich auf mögliche Presseanfragen vorzubereiten. Bei schwerwiegenden Ereignissen muss damit durchaus gerechnet werden. In einer solchen Situation ist es wichtig, nicht der Getriebene zu sein, sondern Herr des Geschehens zu bleiben. Zu diesem frühen Zeitpunkt besteht diese Chance, die man nicht verstreichen lassen sollte. Vor diesem Hintergrund kann es hilfreich sein, bereits jetzt eine schriftliche Presseerklärung vorzubereiten, um diese bei entsprechenden Anfragen parat zu haben. Unabhängig von einer möglichen Presseanfrage ist es in jedem Fall wichtig, frühzeitig mit der Klärung zu beginnen, was genau und warum geschehen ist. Je eher man hierüber Klarheit hat, desto eher kann man klare Angaben machen.
Kommunikation mit der Patientenseite
Die Art und Weise, wie die weitere Kommunikation, entweder die Gespräche mit dem Patienten oder den Angehörigen geführt werden, ist für den weiteren Verlauf von großer Bedeutung.
Das Gespräch sollte aktiv gesucht werden. Anders als in dem geschilderten Beispiel ist das Gespräch des Arztes mit dem Patienten keine Holschuld des Patienten, sondern eine Bringschuld des Arztes. In Anbetracht dessen, dass gerade jetzt das Bedürfnis nach Informationen, aber auch nach Zuspruch und Einfühlungsvermögen sehr groß ist, sollte der Arzt die Initiative ergreifen. So eröffnet sich ihm die Chance, eine Eskalation zu unterbinden, indem die eingangs dargestellten Bedürfnisse des Patienten befriedigt werden. Kommt ein Gespräch nicht zustande, besteht die Gefahr, dass bei dem Patienten Unklarheit bestehen bleiben und sich verfestigen, was dem Vertrauensverhältnis weiter abträglich ist.
Das Gespräch ist grundsätzlich Chefsache, nicht nur, weil er immer dann besonders gefragt ist, wenn es schwierig wird. Es ist zudem für den betroffenen Patienten eine Frage der Anerkennung und der Wertschätzung. Er erhält damit das Signal, dass er mit seiner Situation und seinem Anliegen ernst genommen wird.
Es hört sich so simpel an, entpuppt sich in der Umsetzung jedoch immer wieder als schwierig: Der Inhalt eines Gespräches konzentriert sich zunächst darauf, was passiert ist. Das eingangs dargestellte Informationsbedürfnis des Patienten gilt es zu stillen. Können Fragen zu Befundverlauf, Diagnosen, dem Geschehensablauf oder Zusammenhängen schon als sicher und klar feststehend angesehen werden, sind das genau die Informationen, die der Patient jetzt benötigt. Sollten gewisse Fragen noch unklar sein, ist dies als solches deutlich zu machen. Nur wo schon Klarheit über das tatsächliche Geschehen besteht, kann dies auch als Fakt dargestellt werden. Es ist kontraproduktiv, Spekulationen vorzunehmen. Bei all dem geht es darum, von Fakten zu berichten und keine Bewertungen vorzunehmen. Fragen wie falsch oder richtig, Behandlungsfehler oder nicht und Schadensersatz oder nicht, sind Bewertungen, die spontan häufig noch gar nicht fundiert abgegeben werden können und deshalb im ersten Gespräch auch unterbleiben sollten. Wird von der Patientenseite die Frage einer Entschädigung angesprochen, so sollte man darauf verweisen, dass diese Frage durch den Versicherer geklärt wird, man die Klärung aber so gut es geht unterstützen wird.
Im weiteren Verlauf werden anfangs sicherlich noch offene Fragen geklärt werden. Für den Fall sollten verlässliche Informationen zeitnah weitergegeben werden. Das beinhaltet auch, dass man ein Folgegespräch am besten sofort vereinbart. In dem Gespräch sollte unbedingt das Bedauern zum Ausdruck gebracht werden. Die Erfahrung zeigt, dass die betroffenen Mitarbeiter emotional betroffen sind und mitleiden. Somit ist ein Mitgefühl tatsächlich vorhanden. Dieses kann und soll dem Patienten gegenüber zum Ausdruck gebracht werden. Es gibt keinen Grund, dieses Empfinden zu unterdrücken. Interessante Hilfestellungen finden sich auch in der Broschüre des Aktionsbündnisses Patientensicherheit „Reden ist Gold“ [4].
Rechtlicher Rahmen
Bei dem Plädoyer zu offener Gesprächsführung stellt sich die Frage, ob die Ärzte überhaupt berechtigt sind, eine solch offene Kommunikation zu führen. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Angst deutlich, durch diese Offenheit den Versicherungsschutz zu verlieren.
Die reine wahrheitsgemäße Mitteilung von Tatsachen stellt nie ein Anerkenntnis dar!
Gab es früher tatsächlich die gesetzliche Regelung, wonach der Versicherungsnehmer bei einem Anerkenntnis seinen Versicherungsschutz verliert, so hat der Gesetzgeber diese Norm mit Hilfe des § 105 Versicherungsvertragsgesetz mittlerweile gestrichen. Es sollte dennoch die Abgabe eines Anerkenntnisses vermieden werden, so ist zur Sicherheit der Ärzte zu sagen, dass ein rechtlich verbindliches Anerkenntnis nur sehr schwer abgegeben werden kann. Ein solches liegt etwa bei Formulierungen vor, wie „ich erkenne meine Schuld an und verpflichte mich, den Schaden zu ersetzen“ oder die Vornahme einer Zahlung selber.
Aussagen in einem Gespräch, die sich rein auf die Erläuterung des medizinischen Sachverhalts beziehen, stellen kein Anerkenntnis da. Auch Äußerungen des Mitgefühls und des Bedauerns, wie beispielsweise „Es tut uns sehr leid, dass bei der Gebärmutterentfernung der Harnleiter verletzt wurde“ oder „Wir haben sie mit einem anderen Patienten verwechselt, weshalb anstatt der Durchführung einer Gastroskopie das Einlegen einer Magensonde erfolgte“ stellen kein Anerkenntnis dar. Weder der Versicherer noch das Gesetz stehen einem derartigen offenen Gespräch entgegen. Es gilt deshalb: Fakten berichten, Empathie ausdrücken, aber Wertungen bzw. rechtliche Würdigung unterlassen.
Versicherer
Für den Arzt stellt sich auch die Frage, ob und wann der Versicherer von einem Schadenfall in Kenntnis zu setzen ist. Versicherungsschutz wird gerade für den Fall abgeschlossen, dass eine Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz aufgrund eines fehlerhaft verursachten Gesundheitsschadens gegeben ist. Die Aufgabe des Versicherers besteht darin, die Frage einer Schadensersatzverpflichtung zu prüfen und – je nach Ergebnis der Einschätzung – zu regulieren bzw. den Anspruch abzuwehren. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss der Versicherer rechtzeitig über einen Schadenfall in Kenntnis gesetzt werden (Schadenmeldung). Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist jeder Versicherungsfall innerhalb einer Woche zu melden. Als Versicherungsfall wird das Schadenereignis angesehen.
Zur Frage, wann eine Meldung zu erfolgen hat, kann man sich an folgender Abgrenzung orientieren: Nicht jeder Eintritt einer Komplikation oder die bloße Anforderung von Behandlungsunterlagen etwa durch eine Krankenkasse lösen die Meldeobliegenheit aus. Auf jeden Fall immer dann, wenn in einem Schreiben des Patienten oder des Rechtsanwaltes Schadensersatz gefordert wird, besteht eine Verpflichtung zur Meldung. Auch förmliche Verfahren wie eine Klage, staatsanwaltliche Ermittlung oder vor einer Schlichtungsstelle bzw. Gutachterkommission sind dem Versicherer zu melden. Erst mit der Meldung wird der Versicherer in die Lage versetzt, die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruches zu prüfen und das Ergebnis dem Patienten mitzuteilen. Eine Entscheidung wird von der Patientenseite – unabhängig davon, wie sie lautet – eher akzeptiert, wenn sie zeitnah erfolgt. Vor diesem Hintergrund stellt die rasche Einbindung des Versicherers nicht lediglich eine Pflicht des Arztes dar, sondern sie ist auch sinnvoll.
Fazit
Schneller als man denkt, kann der Arzt in die Situation eines Schadenfalles kommen. Häufig bleibt dann nicht mehr die Zeit, sich vertiefte Gedanken über die nun notwendigen Maßnahmen zu machen. Es macht deshalb Sinn, sich bereits vorher mit diesen Fragen zu befassen und idealerweise hierzu für die Mitarbeiter eine Anweisung zu erstellen und Schulungen durchzuführen. Zentrales Thema wird dabei der Umgang und die Kommunikation mit dem Patienten/Angehörigen nach einem Schadenereignis sein. Hierbei steht dem offenen, empathischen Gespräch, das aktiv gesucht wird, nicht nur nichts im Wege. Es bietet vielmehr die Chance, dass verlorene Vertrauen wiederzugewinnen und eine konträre Auseinandersetzung zu vermeiden oder zumindest nicht unnötig eskalieren zu lassen. Der Versicherungsschutz wird durch ein offenes Gespräch, das die Darstellung der Tatsachen und nicht deren Bewertung zum Inhalt hat, nicht gefährdet. Ebenso wenig durch ein Ausdruck des Bedauerns über das Geschehene.
Literatur
[1] Vincent CA, Pincus T, Scurr JH. Patient´s Experience of surgical accidents. Quality in Healthcare 1993; 2: 77ff.
[2] Mulcahy L. Mediating Medical Negligence Claims. Amicus Curiae 2000; 30: 8.
[3] Stiftung Patientensicherheit, Schweiz. Kommunikation mit Patienten und Angehörigen nach einem Zwischenfall. 2. Aufl. 2007
[4] Aktionsbündnisses Patientensicherheit. „Reden ist Gold“ – Kommunikation nach einem Zwischenfall. 3. Aufl. Berlin: 2017
Jaklin J: Kein Maulkorb für den Arzt! Kommunikation und Verhalten nach einem Schadenfall. Passion Chirurgie. 2018 Juli, 8(07): Artikel 04_02.