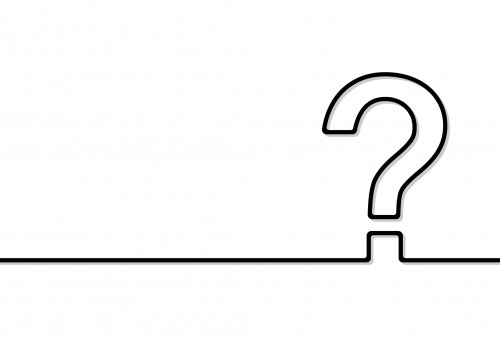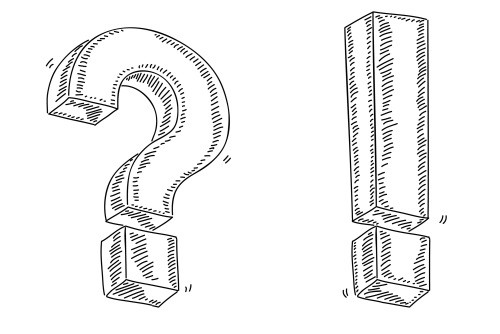Ständige ärztliche Vertretung privatliquidationsberechtigter Chefärzte im Lichte der Rechtsprechung
Die privaten Krankenversicherer stellen die Wahlleistungsvereinbarungen privatliquidationsberechtigter Chefärzte immer wieder auf den Prüfstand – dies gilt insbesondere in Fällen, in denen die ärztliche Leistung nicht durch den Chefarzt als Vertragspartner persönlich erbracht worden ist, sondern durch dessen ständigen ärztlichen Vertreter. Die Wirksamkeit von Wahlleistungsvereinbarungen, die eine sog. Vertreterregelung für den Fall der Verhinderung des liquidationsberechtigten Chefarztes an der Leistungserbringung vorsehen, sind dabei immer wieder Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen, und zwar mit überraschenden, teilweise auch widersprüchlichen Ergebnissen.
Bisher gültige Grundsatzentscheidung des BGH
Der Bundesgerichtshof hatte in einer Grundsatzentscheidung festgestellt, dass Klauseln in einer formularmäßigen Wahlleistungsvereinbarung, durch welche die einem Wahlarzt obliegende Leistung im Falle seiner Verhinderung durch einen Vertreter erbracht werden darf, nur dann wirksam sind, wenn sie auf die Fälle beschränkt sind, in denen die Verhinderung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Wahlleistungsvereinbarung nicht bereits feststeht und wenn als Vertreter der namentlich benannte ständige ärztliche Vertreter i.S.d. § 4 Abs. 2 Satz 3 und 4, § 5 Abs. 5 GOÄ bestimmt ist.
Wird eine Stellvertretervereinbarung im Wege der Individualabrede geschlossen, bestehen gegenüber dem Patienten besondere Aufklärungspflichten, bei deren Verletzung dem Honoraranspruch des Wahlarztes der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegensteht.
Danach ist der Patient so früh wie möglich über die Verhinderung des Wahlarztes zu unterrichten und ihm das Angebot zu unterbreiten, dass an dessen Stelle ein bestimmter Vertreter zu den vereinbarten Bedingungen die wahlärztlichen Leistungen erbringt. Weiter ist der Patient über die alternative Option zu unterrichten, auf die Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen zu verzichten und sich ohne Zuzahlung von dem jeweils diensthabenden Arzt behandeln zu lassen. Ist die jeweilige Maßnahme bis zum Ende der Verhinderung des Wahlarztes verschiebbar, ist dem Patienten auch dies zur Wahl zu stellen. Eine solche Vertretervereinbarung unterliegt grundsätzlich der Schriftform (BGH, Az. III ZR 144/07, Urteil vom 20.12.2007).
In der Folgezeit war durch die Instanzgerichte wiederholt festgestellt worden, dass eine Wahlleistungsvereinbarung wegen Verstoßes gegen das sogenannte Verbot des Änderungsvorbehalts (§ 308 Nr. 4 BGB) unwirksam sein kann, wenn sie für den Wahlarzt mehrere ständige ärztliche Vertreter bestimmt. Dies wurde damit begründet, dass die Vertreterregelung in Wahlleistungsvereinbarungen eng am Wortlaut des § 4 Abs. 2 GOÄ auszulegen sei, wonach der Vergütungsanspruch nur bei Einsatz „des ständigen ärztlichen Vertreters“ (Singular) erhalten bleibe.
Die Problematik hat sogar strafrechtliche Dimensionen erreicht:
In einem vor dem Landgericht (LG) Aschaffenburg geführten Strafverfahren (unveröffentlicht – Beschluss vom 29.10.2013 – Az. 104 Js 13948/07) war ein Chefarzt einer gynäkologischen Klinik wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetruges angeklagt worden, da in seinen Wahlleistungsvereinbarungen sechs Oberärzte als ständige Vertreter angegeben worden waren. Dies verstieß nach Auffassung des LG Aschaffenburg gegen § 4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ (welcher, wie ausgeführt, vom „ständigen ärztlichen Vertreter“ im Singular spricht), weshalb die abgeschlossenen Wahlleistungsvereinbarungen als unwirksam angesehen wurden. Nur durch sein Einverständnis mit einer Zahlung eines Betrages von EUR 150.000,00 zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung konnte der gynäkologische Chefarzt eine Einstellung des Verfahrens und damit eine Durchführung des Strafverfahrens mit absehbar gravierenden Folgen verhindern.
Neuerung durch Entscheidung des OLG Celle
In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung hat das OLG Celle (Az. 1 U 97/14, Urteil vom 15.06.2015) nunmehr jedoch erfreulicherweise klargestellt, dass die GOÄ nicht voraussetzt, dass jeder Chefarzt nur einen einzigen ständigen Vertreter haben dürfe:
Zwar sei nur eine Klausel zulässig, in der der Eintritt des Vertreters des Wahlarztes auf die Fälle beschränkt sei, in denen dessen Verhinderung im Zeitpunkt des Abschlusses der Wahlleistungsvereinbarung nicht bereits feststehe, etwa weil die Verhinderung (Krankheit, andere Notfälle etc.) selbst noch nicht absehbar war. Auch sei es weiterhin erforderlich, dass als Vertreter der namentlich benannte ständige ärztliche Vertreter i.S.v. §§ 4 Abs. 2, 5 Abs. 5 GOÄ bestimmt sei. Dass in dem am OLG Celle zur Beurteilung stehenden Fall zwei Oberärzte als ständige ärztliche Vertreter des Chefarztes benannt worden waren, stehe jedoch der Wirksamkeit der Vereinbarung nicht entgegen, denn die GOÄ setze nicht voraus, dass jeder Chefarzt nur einen einzigen ständigen ärztlichen Vertreter haben dürfe. Nach der Entscheidung des OLG Celle ist es vielmehr zulässig, dass die Klinik für verschiedene Arbeitsbereiche eines Chefarztes jeweils einen ständigen ärztlichen Vertreter bestimmt. Die dem Gericht vorliegende Wahlleistungsvereinbarung war demnach so auszulegen, dass die beiden Oberärzte zwei verschiedene Zuständigkeitsbereiche des Chefarztes vertreten. Jeder der beiden Oberärzte vertritt den Chefarzt in der Leitung der Station, für die er zuständig sei.
Zusammenfassung
Das Urteil des OLG Celle beendet damit die bisherige Rechtsprechung, wonach die Benennung mehrerer ärztlicher Vertreter nicht zulässig war und zur Unwirksamkeit der Wahlarztvereinbarung geführt hatte. Entscheidendes Kriterium ist aber, dass die jeweils benannten ständigen ärztlichen Vertreter aus unterschiedlichen Funktions- und Zuständigkeitsbereichen der Klinik des wahlleistungsberechtigten Chefarztes stammen, jeder, der als ständiger ärztlicher Vertreter benannten Oberärzte muss also jeweils für einen eigenen fachlich und organisatorisch abgegrenzten Bereich der Klinik zuständig sein (z. B. in einer chirurgischen Klinik: im Bereich plastisch-rekonstruktive Chirurgie und Handchirurgie etc.). Ist diese Voraussetzung erfüllt, muss die ständige ärztliche Vertretung nicht auf eine Person beschränkt bleiben.
Die verwendeten Wahlleistungsvereinbarungen sollten daraufhin überprüft werden, insbesondere nachdem eine rückwirkende Vereinbarung der Wahlleistungen nicht möglich ist. Grundsätzlich bleibt es auch bei der wie bisher vorgesehenen Unterscheidung zwischen vorhersehbarer und unvorhersehbarer Abwesenheit:
Der in der Wahlleistungsvereinbarung benannte Vertreter darf weiterhin nur bei unvorhergesehener Abwesenheit des Chefarztes tätig werden.
Soll eine individuelle Vertretervereinbarung für Fälle vorhersehbarer Abwesenheit geschlossen werden, muss hierin mindestens Grund und Dauer der Abwesenheit genannt und dem Patienten konkret die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten eingeräumt werden:
• Behandlung durch einen sonstigen Arzt ohne Abrechnung der Wahlleistung,
• Vertretung durch einen individuell benannten Arzt oder
• Behandlung durch den Chefarzt nach seiner Rückkehr, sofern es sich aus medizinischer Sicht um einen elektiven Eingriff handelt.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der sog. Konsiliararzt aus einer abgeschlossenen Wahlarztleistung keine Ansprüche ableiten kann. Er ist somit nicht in die sog. Wahlarztkette einbezogen, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung wäre unwirksam (LG München, Az. 9 S 9168/13, Urteil vom 24.02.2014).
Heberer J. / M. Eicher. Aktuelle Probleme der Wahlleistungsvereinbarung. Passion Chirurgie. 2015 November; 5(11): Artikel 06_01.