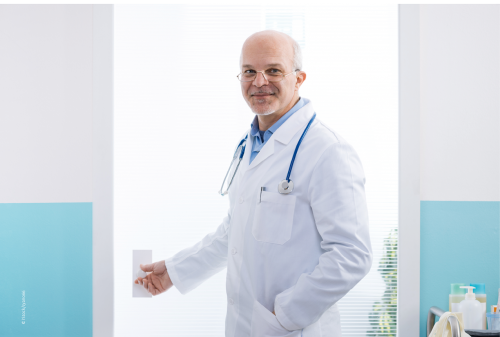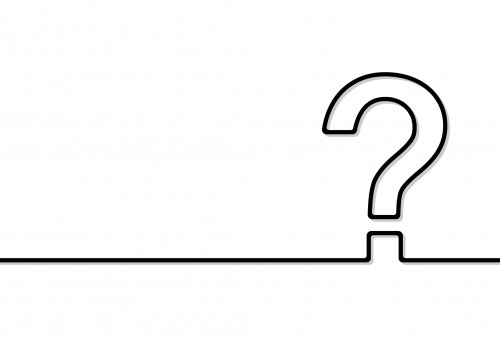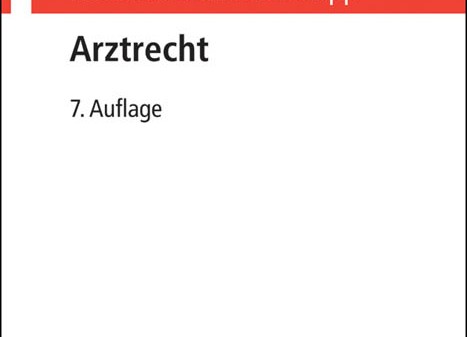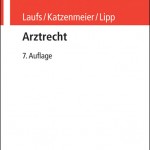Was bedeuten die Regelungen des § 135 c SGB V und 23 MBO?
Problemstellung
Im SGB V und in der Musterberufsordnung für Ärzte (MBO) finden sich mit dem § 135 c SGB V und dem § 23 MBO Regelungen, die dazu verleiten könnten, die variable Beteiligung der Chefärzte bzw. Krankenhausärzte auf dasjenige zu beschränken, was in keiner Weise auch nur im Ansatz einen wirtschaftlichen Anreiz für die Erbringung ärztlicher Leistungen darstellt.
§ 135 c SGB heißt im Wortlaut wie folgt:
„(1) Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die Qualität der Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen ausgeschlossen sind, die auf finanzielle Anreize insbesondere für einzelne Leistungen, Leistungsmengen, Leistungskomplexe oder Messgrößen hierfür abstellen. Die Empfehlungen sollen insbesondere die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen sichern.
(2) Der Qualitätsbericht des Krankenhauses nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 hat eine Erklärung zu enthalten, die unbeschadet der Rechte Dritter Auskunft darüber gibt, ob sich das Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärzten an die Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 2 hält. Hält sich das Krankenhaus nicht an die Empfehlungen, hat es unbeschadet der Rechte Dritter anzugeben, welche Leistungen oder Leistungsbereiche von solchen Zielvereinbarungen betroffen sind.“
§ 23 MBO lautet wie folgt:
„(1) Die Regeln dieser Berufsordnung gelten auch für Ärztinnen und Ärzte, welche ihre ärztliche Tätigkeit im Rahmen eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ausüben.
(2) Auch in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis darf eine Ärztin oder ein Arzt eine Vergütung für ihre oder seine ärztliche Tätigkeit nicht dahingehend vereinbaren, dass die Vergütung die Ärztin oder den Arzt in der Unabhängigkeit ihrer oder seiner medizinischen Entscheidungen beeinträchtigt.“
Insbesondere diese Regelungen lassen den Eindruck entstehen, dass keinerlei wirtschaftlicher Anreiz mehr gestattet ist, der im Zusammenhang mit der Erbringung ärztlicher Leistungen steht. Dass dem aber nicht so ist, wird eigentlich einheitlich so gesehen. So darf verwiesen werden auf einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt vom 08.11.2013, in dem beispielsweise es durchaus als angemessen angesehen wird, wenn ein Chefarzt nach wie vor Bonuszahlungen für Erlöse aus ambulanten und stationären Wahlleistungen erhält.
Hier ist folgendes zu lesen:
Bonuszahlung für Erlöse aus ambulanten und stationären Wahlleistungen:
Bewertung: Akzeptabel, wenn die den Erlösen aus ambulanten und stationären Wahlleistungen zugrundeliegenden medizinischen Indikationsstellungen nicht durch ökonomisches Denken in Bezug auf Erlössteigerung beeinflusst werden (Faustregel, 3. Kriterium) [1]
Wie aus dieser Veröffentlichung deutlich wird, ist also nicht jeder wirtschaftliche Anreiz von vornherein verboten. An dieser Stelle schließt sich die Stellungnahme der Koordinierungsstelle der Bundesärztekammer und des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte an, die beispielsweise das Erreichen eines bestimmten Unternehmensziels als akzeptabel erachten, wenn die medizinische Indikationsstellung für die erbrachten Leistungen nicht durch Erlössteigerungsdenken beeinflusst wird (Faustregel). [2]
Insofern besteht also ein durchaus von den Autoren geteilter Konsens, dass nicht jedweder ökonomischer Anreiz bei der Erbringung von medizinischen Leistungen zu verurteilen ist.
Intransparenz der Darstellung
Problematisch wird die gesamte Angelegenheit eigentlich nur deshalb, dass offensichtlich bei der Beurteilung des Zulässigen bzw. des Unzulässigen kein roter Faden zu verzeichnen ist, was insbesondere in der Praxis dazu führt, dass beispielsweise Krankenhausträger an ihre Chefärzte mit dem Wunsch herantreten, eine Beteiligung an den DRGs aufzukündigen, weil diese angeblich gegen § 135 c SGB V bzw. gegen die Musterberufsordnung verstößt und sich dies auch aus den entsprechenden Stellungnahmen der vorbenannten Stellen ergibt.
In der Tat ist beispielsweise im Deutschen Ärzteblatt in einer Stellungnahme zu lesen, dass der Umstand, dass ein Chefarzt eine Prämie von 10 % des jeweiligen DRG-Betrages der von ihm vorgenommenen operativen Eingriffe erhält, abzulehnen ist, da diese Zielvereinbarung dem Wortlaut des ehem. § 136 a SGB V, jetzt § 135 c SGB V, widerspricht. [3]
Nun ist dem § 135 c SGB V mitnichten explizit zu entnehmen, dass eine Beteiligung an den DRG-Erlösen untersagt wäre. § 135 c SGB V stellt lediglich einen abstrakten Rahmen dar, der ausgekleidet werden muss. Und an dieser Stelle darf einmal kritisch von den Autoren gefragt werden, wo denn der qualitative Unterschied zu sehen ist, ob ein Chefarzt an den ambulanten und stationären Wahlleistungen beteiligt wird oder an den jeweiligen DRG-Beträgen. Beides ist nach Auffassung der Autoren akzeptabel, wenn man die Ärzteschaft nicht unter einen Generalverdacht stellt, dass eine Indikationserweiterung allein aus ökonomischen Interessen des handelnden Arztes erfolgt.
Genau diese Unterscheidung unternimmt ja auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer, wenn sie beispielsweise Bonuszahlungen für Erlöse aus ambulanten und stationären Wahlleistungen als zulässig erachten, wenn dieser ökonomische Anreiz nicht zur Ausweitung der zugrundeliegenden Indikationen führt. Nun sei den Autoren die etwas pointierte Anmerkung gestattet, dass man sich doch seitens der handelnden Institutionen entscheiden möge, ob man die deutsche Ärzteschaft unter den Generalverdacht stellt, dass ökonomisches Handeln das ärztliche Tun bestimmt, wie sicherlich nicht, oder aber man grundsätzlich den Ärzten insofern ein gewisses Vertrauen entgegenbringt, dass für sie nach wie vor das Wohl des Patienten entscheidend ist und nicht die Schwere des eigenen Geldbeutels. Wenn man sich aber bei der Betrachtung der einzelnen Ziele davon leiten lässt, dass man den Ärzten zu Recht vertraut, so ist in der Tat nicht einzusehen, weshalb eine DRG-Beteiligung unzulässig sein sollte, aber eine Beteiligung an den stationären Wahlleistungen zulässig.
Noch abstruser wird es insbesondere im Hinblick auf das Wohl des Patienten, wenn man sich vor Augen führt, dass beispielsweise ein Ziel zulässig sein soll, das einen Bonus auslobt, wenn man die Verweildauer auf 90 % bzw. auf 85 % des Katalogwertes unterschreitet. Dieses Zielvereinbarungselement ist nach Auffassung der handelnden Gremien nur dann akzeptabel, wenn die Verweildauerreduktion medizinisch begründet ist und unter Beachtung der Faustregel (keine ökonomischen Interessen!) erreicht wird.
Auch an diesem Ziel wird sehr schön deutlich, dass man ja dem Arzt auch hier durchaus vertraut und begründet, dass dieses Ziel dann zulässig ist, wenn der Arzt aus rein medizinischen Überlegungen handelt. Dieses Postulat des Wohles des Patienten wird auch hier also durchaus als wichtig erachtet. Es wird aber auch an dieser Stelle dem Arzt durchaus zugetraut, dass er seine eigenen ökonomischen Interessen hinten anstellt, wenn das Wohl des Patienten betroffen ist.
Wollte man diese Darstellungen und Stellungnahmen als Doppelmoral brandmarken, würde man sicherlich zu weit gehen. Die Forderung der Autoren geht vielmehr dahin, dass man der deutschen Ärzteschaft durchaus zutraut und auch vertraut, dass sie das Wohl der Patienten nicht aus den Augen verliert. Wollte man die Ärzte unter Generalverdacht stellen, so möge man dann doch bitte konsequent sein und sämtliche variablen Boni, die in irgendeiner Art und Weise mit der Leistungserbringung am Patienten in Zusammenhang stehen, abschaffen. Wenn man aber hier punktuelle Schwerpunkte setzt und dies damit rechtfertigt, dass der Arzt im konkreten Handeln nicht durch ökonomische Interessen geleitet wird, so muss dies eigentlich für das gesamte ärztliche Handeln gelten. Insofern verbietet es sich nach Auffassung der Autoren eine Art rote Linie festzustellen, die sich nach Auffassung der Autoren willkürlich darstellt. Denn die einzelne Gewichtung der Ziele als zulässig und unzulässig ist zumindest mit juristischem Augenmaß nicht mehr begründbar.
Gerade das Recht zur Erbringung wahlärztlicher Leistungen bzw. die Beteiligung der Chefärzte daran ist ein Aspekt, der seit Jahrzehnten in der Deutschen Krankenhauslandschaft Fuß gefasst hat und geradezu die variable Vergütung Nr. 1 darstellt. Auch zu Zeiten, als Chefärzte an großen Häusern durchaus erheblich mehr Einnahmen aus der Abrechnung wahlärztlicher Leistungen erzielt haben, als dies heute üblich ist, ging kein Aufschrei durch die Republik, dass die Indikation bei der Behandlung von Privatpatienten allein aufgrund ökonomischer Interessen erfolgt ist. Der Gesetzgeber mag sich daher von den Verfassern dieses Artikels eine gewisse Augenwischerei unterstellen lassen.
Dass dies tatsächlich ein berechtigter Vorwurf ist, macht beispielsweise auch die Regelung des § 136 b SGB V deutlich. Dieser lautet wie folgt:
„(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für zugelassene Krankenhäuser grundsätzlich einheitlich für alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse über
- die im Abstand von fünf Jahren zu erbringenden Nachweise über die Erfüllung der Fortbildungspflichten der Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
- einen Katalog planbarer Leistungen, bei denen die Qualität des Behandlungsergebnisses von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist, sowie Mindestmengen für die jeweiligen Leistungen je Arzt oder Standort eines Krankenhauses oder je Arzt und Standort eines Krankenhauses und Ausnahmetatbestände,
- Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser,
- vier Leistungen oder Leistungsbereiche, zu denen Verträge nach § 110a mit Anreizen für die Einhaltung besonderer Qualitätsanforderungen erprobt werden sollen,
- einen Katalog von Leistungen oder Leistungsbereichen, die sich für eine qualitätsabhängige Vergütung mit Zu- und Abschlägen eignen, sowie Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren.
§ 136 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Verband der Privaten Krankenversicherung, die Bundesärztekammer sowie die Berufsorganisationen der Pflegeberufe sind bei den Beschlüssen nach den Nummern 1 bis 5 zu beteiligen; bei den Beschlüssen nach den Nummern 1 und 3 ist zusätzlich die Bundespsychotherapeutenkammer zu beteiligen.“
Führt man sich die Regelungen des § 136 b Abs. 1 1 Nr. 2 SGB V vor Augen, so wird nunmehr vom Gesetzgeber vorgeschlagen, dass der gemeinsame Bundesausschuss gewisse Mindestmengen vorschreibt, die für die Erbringung gewisser ärztlicher Leistungen notwendig sind. Mit anderen Worten schafft der Gesetzgeber hier von sich aus bereits einen Anreiz, wollte man den Ärzten böswilliges Handeln unterstellen, dass gewisse Mindestmengen erreicht werden, um die Leistung zukünftig erbringen zu können. Davon hängen dann auch der wirtschaftliche Erfolg der jeweiligen Abteilung und des Krankenhauses ab und damit realiter auch die Existenz des Chefarztes. Denn aus der anwaltlichen Praxis ist es gerade der Trennungsgrund Nr. 1, insbesondere in der privaten Krankenhausträgerlandschaft, wenn der Chefarzt neu deutsch nicht so „performt“, wie sich dies der Krankenhausträger wünscht. Insofern hängt nicht nur ein gewisser Anteil der Vergütungskomponente des Chefarztes am wirtschaftlichen Erfolg seiner Abteilung und des ganzen Krankenhauses, sondern seine gesamte Existenz in diesem Krankenhaus. Denn nicht selten wird der Trennungswunsch des Krankenhausträgers manifest, wenn die Umsatzzahlen der Abteilung sinken. Auch dies macht wiederum deutlich, wie vollkommen an der Realität vorbei die gesetzliche Regelung des § 135 c SGB V ist. Denn wenn man dem Arzt unterstellt, dass das Postulat seines Handelns nicht das Wohl des Patienten, sondern das Wohl der eigenen Person in wirtschaftlicher Hinsicht ist, dann müsste man in der Konsequenz die Uhren auf „Null“ stellen und das Gesundheitswesen vollständig verstaatlichen, sich von der Idee der wirtschaftlichen Krankenversorgung verabschieden und letztlich diese als dasjenige sehen, was sie nämlich tatsächlich ist, ein Grundbedürfnis im Zusammenhang mit der Versorgung der Bevölkerung.
FazitInsgesamt wollen die Autoren nicht missverstanden werden. Selbstverständlich hat in der Vergangenheit der ein oder andere Skandal dazu geführt, dass man hier argwöhnisch werden kann. Was die Gesetzgebung aber nunmehr mit § 135 c SGB V verabschiedet hat, ist in sich nicht kongruent. Insbesondere aber auch die Ausgestaltung durch die entsprechenden Vorschläge der Deutschen Krankenhausgesellschaft und des Gemeinsamen Bundesausschusses sind in sich nicht nachvollziehbar und schlüssig. Hier wird punktuell gewichtet. Es wird vereinzelt den Ärzten unterstellt, dass hier der wirtschaftliche Anreiz im Vordergrund steht, wenngleich man bei letztlich fast gleichartigen Vergütungsbestandteilen andererseits dem Arzt durchaus zutraut, das eigene Handeln nicht unter das Postulat des eigenen wirtschaftlichen Erfolges zu stellen. Der Gesetzgeber selbst hat beispielsweise mit der Vorgabe von gewissen Mindestmengen dazu Anlass gegeben, dass hier möglicherweise schräge Anreize bei der Leistungserbringung von vornherein vorgesehen sind. Ganz klar muss aber betont werden, dass ein Verstoß gegen die Regelung des § 135 c SGB V letztlich mehr oder weniger unbeachtlich ist. Denn die Regelung des § 135 c Abs. 2 SGB V macht ja deutlich, dass man eine Nichteinhaltung der entsprechenden Empfehlungen nur im Qualitätsbericht veröffentlichen muss. Die Regelung des § 23 MBO führt auch nicht dazu, dass hier etwas anderes gilt. Denn entweder ist § 23 MBO der Tod jeglicher variabler finanzieller Beteiligung im direkten Zusammenhang mit der Leistungserbringung am Patienten oder aber nicht. Insofern verbietet sich eine qualitative Abstufung beispielsweise im Zusammenhang mit der Erbringung wahlärztlicher Leistungen und einer Beteiligung an den DRGs. Ein direktes striktes Verbot der in Rede stehenden Chefarzt-Boni ist daraus nicht zu entnehmen und dürfte im Übrigen auch verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt sein. Alles in allem appellieren daher die Verfasser dieses Artikels dafür, mit einem gewissen Augenmaß zu agieren, insbesondere was die Gestaltung von Chefarztdienstverträgen angeht. Sie verwahren sich insbesondere dagegen, dass man einen punktuellen Generalverdacht gegen die deutsche Ärzteschaft durch Empfehlungen manifestiert, die bei näherer Betrachtung in sich alles andere als kongruent sind. |
Literatur
[1] vgl. Flintrop, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 110, Heft 45, 08.11.2013, A2108 ff.
[2] Deutsches Ärzteblatt 13. November 2015, DOI: 10.3238/aerztebl.2015.zielvereinbarung2015_01
[3] vgl. Flintrop, a.a.O.
Heberer J. / Hüttl P. Das Ende der variablen Beteiligung für Chefärzte. Passion Chirurgie. 2017 Juli, 7(07): Artikel 04_09.