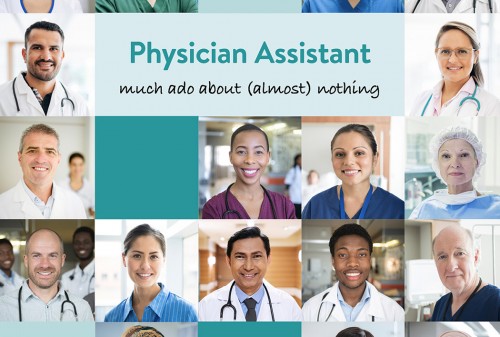Vorwort
Generation Z in der Chirurgie
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in deutschen Krankenhäusern ist in den letzten Jahren ein zunehmender Fachkräftemangel spürbar. Dies stellt die Kliniken vor immer größere Herausforderungen hinsichtlich Mitarbeiterakquise und -führung. Denn unabhängig von z. B. „Laumanns Krankenhausplan“ oder „Mindestmengenvorgaben durch den G-BA“, nur diejenigen Krankenhäuser werden eine Zukunft haben, die ausreichend kompetente Mitarbeiter für ihre Institution gewinnen können.
Und jetzt steht die Generation Z vor der Tür!
Aber was können wir von dieser Generation erwarten? Wie müssen wir uns aufstellen, um die jungen Menschen dieser Generation in Zukunft für unsere Bereiche als wertvolle Mitarbeitende zu gewinnen?
Die Generation Z, die „Digital Natives 2.0“, beschreibt die Geburtsjahrgänge ab 1994 und wird als realistisch, sicherheitsorientiert und anspruchsvoll bezeichnet. Die Vertreter dieser Generation möchten unabhängig sein und steigen mit großer Neugier, unter Nutzung aller digitalen Möglichkeiten, in das Arbeitsleben ein und erwarten ein optimales Verhältnis aus Arbeitsleben, Freizeit und Familie. Parallel hierzu verliert der Arbeitgeber an Stellenwert, was aber nicht bedeutet, dass die Generation Z weniger Leistungswillen zeigt.
Erhellende Lektüre wünscht

Prof. Dr. med. Daniel Vallböhmer
„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn Sie die Zukunft betreffen“. Dieses Zitat, das je nach Quelle wechselnd Mark Twain, Niels Bohr oder Karl Valentin zugeschrieben wird, könnte diesen Beitrag einleiten und auch gleich wieder beenden. Denn es ist allgemein bekannt, dass Vorhersagen nur so treffsicher sein können, wie es die Breite Ihrer Beurteilungsgrundlage zulässt. Und es gehört zu einer besonderen Form der Dummheit, wenn Professionalisten ihre Weissagungen auf schwachen Erkenntnissen oder vagen Informationen basieren lassen. Die aktuellen Corona-Diskussionen in der Öffentlichkeit, aber auch die vielfältigen Publikationen zur robotischen Chirurgie in unserer eigenen Gemeinschaft stellen hier ganz aktuelle, geradezu tägliche Lehrbeispiele.
Denn von besonderem Anspruch sind Prognosen in volatilen, in einem Prozess befindlichen Betrachtungsfeldern. Gerade adoleszente Gesellschaftsschichten besitzen mit den vielfältigen externen aber auch internen psychischen und physischen Einflüssen diesen unbeständigen, labilen und manchmal gar sprunghaften Charakter. Und so lehnt diese Abhandlung auch jeden Anspruch auf wissenschaftliche Validität ausdrücklich ab.
Warum sollte man sich dann überhaupt mit den nachwachsenden Generationen und ihren Präferenzen, Rezeptionen, Zielsetzungen und Handlungsoptionen beschäftigen? Nun, dafür gibt es drei gute Gründe. Erstens handelt es sich bei der Generation Z um unsere Mitarbeitenden von morgen. Es gehört also zum personalpolitischen Pragmatismus jeder Team- oder Klinikleitung, hier gut orientiert zu sein. Zweitens sind zahlreiche Kinder vielen aktuell leitenden Ärzt:innen dieser Generation zugehörig. Wir begegnen ihr also nicht nur im Vorlesungs- oder Operationssaal, sondern selbst am eigenen Küchentisch. Es schadet auch nach persönlicher Erfahrung des Autors nicht, wenn Erziehungsbeauftragte in den systemimmanenten Diskussionen des engen Miteinanders nicht zu früh scheitern. Und schließlich laden Generationsdiskussionen doch immer zu amüsanten, illustrativen und manchmal auch herrlich spöttischen Exkursen ein.
Betrachtungen zu nachwachsenden Generationen sind wahrscheinlich so alt wie die denkende Menschheit. Der Aufstand der Jugend gegen das Establishment und die Empörung der Alten über den Verfall des Nachwuchses gehört wohl schon naturgemäß zum Generationswechsel. Das Netz strotzt geradezu vor antiken Zitaten berühmter Philosophen und Politikern wie Aristoteles oder Demosthenes, die sich in beißender Kritik an der Jugend abarbeiten. Nun stammen diese Zitate nach genauerer Recherche häufig nicht aus namhafter antiker Quelle, sondern dem reaktionären 18. und 19. Jahrhundert, und entlarven bei Gebrauch deshalb eher die schlechte Recherche des Nutzers als irgendeinen konstruktiven Beitrag zu leisten. Deshalb sollten wir uns zum Abschluss der Einleitung dringend der eigenen Phase juveniler Orientierung erinnern, bevor grobes Unverständnis jede partizipative Kommunikation blockiert. Wir waren in den frühen Jahren doch selbst von unserer ausschließenden Allwissenheit überzeugt, nur um im Alter mit steigender Erfahrung aber immer noch ohne absolutes Wissen haargenau das Gleiche zu behaupten.
Die Generation Z
Die Generation Z bezeichnet in der Regel die Jahrgänge zwischen 1995 und 2010. Die Grenzen schwanken dabei aber durchaus und je nach Autor vielleicht auch etwas willkürlich. Sie folgt damit der berüchtigten Generation Y (Millenials), zu der sich allein unter Google in 0,5 sec mittlerweile 1,14 Milliarden Einträge aufrufen lassen. Was nach Z kommt, firmiert aktuell unter dem Codewort Alpha.
Aber natürlich bieten die Mitglieder der Generation Z als Post-Millenials mehr als nur gemeinsame Geburtsjahrgänge. Sozialisationstheroretisch findet in der Jugend des Lebens die erste, intensive Auseinandersetzung mit Physis und Psyche sowie sozialer und physischer Umgebung statt. Die Angehörigen der verschiedenen Generationen treffen also in der prägenden Adoleszenz auf abweichende wirtschaftliche, politische, kulturelle oder – wie im Fall von Z besonders ausgeprägt – kommunikative Bedingungen. Diese veränderten äußeren Umstände gestalten im volatilen und vulnerablen Umbruch von Körper und Seele dann die generationstypischen Wünsche, Zielsetzungen und Bedürfnisse, die zusätzlich vor allem von der Generation der Eltern weiter moduliert werden.
Generationswechsel benötigen also als Auslöser immer eine Form des Umbruchs, der aber mit Ausnahme eruptiver Einzelereignisse wie z. B. der beiden Weltkriege zumeist schleichender Natur und multifaktoriell bedingt ist. Als wichtigste externe Einflüsse auf die Generation Z werden vielfach vor allem die frühkindliche Digitalisierung, der materielle Wohlstand, der günstige Arbeitsmarkt, die lebensstilfreudige Hyperindividualisierung und die Klima- und Umweltkrise aufgeführt.
Um sich in diesem weiten und vagen Feld aber nicht vollständig zu verlieren, wird sich dieser Beitrag auf fünf übergreifende Topics konzentrieren, die für chirurgisches Führungspersonal von Bedeutung sind.
Generation Z – Sozialisation und Erziehung
Die Kindheitsphase der Post-Millenials atmet durchgehend den Odem einer Einzelkind-Atmosphäre. „Du bist besonders“ steht als beherrschender Leitsatz selbst dann über allem, wenn sich die Schützlinge in der Weihnachtsaufführung 60 Minuten hinter dem Vorhang verstecken, im Sport jegliche Grundlagen der Gruppendisziplin vermissen lassen oder das Klassenzimmer der Grundschule als Solo-Bühne missinterpretieren. Man ist halt wie man ist. Elterliche und andere, erwachsene Autoritäten werden durch eine gleichberechtigte Partnerschaft ersetzt, wenn Fünfjährige familiäre Urlaubsziele bestimmen oder Teenager eisern ihre wundersamen Ernährungspläne durchsetzen. Grenzen verlieren hier ihre normative Realität und werden stattdessen zu einer verhandelbaren Fiktion. Daran sind die Erziehungsberechtigten aber nicht unbeteiligt, stellen die Kinder der Generation Z doch einen wesentlichen Teil der elterlichen Selbstinszenierung. Das alte Mantra von „Dir soll es einmal besser gehen“ hat dabei allgemein ausgedient. Unbeschränkte Selbstverwirklichung steht dagegen im Fokus und wahllose Freiheit ersetzt im elterlichen Sozialwettbewerb das frühere Streben nach Leistung. Skurrile Auslandsaufenthalte in der Schulzeit, die ihren Sinn allein aus touristischen Erwägungen ziehen, oder talentfreie, zum Teil sogar widersprüchliche, aber auf jeden Fall multiple Freizeitaktivitäten, die sich ohne Ziel allenfalls noch selbst genügen, stellen häufige Bestandteile des Projekts „mein Kind“. Spaß am Leben ist die übergeordnete Intention, der sich alles unterordnet. Und während sich ehemals kindliche Berufswünsche bis zur Quarta dann doch verliefen, verblüffen heute junge Studierende manchmal noch mit Lebensplänen, die an Alice im Wunderland erinnern. Das färbt übrigens auch nach oben ab, wie der Lebens- und Freizeitstil mancher Mittfünfziger blumig illustriert. Die Basis dieses Projekts stellt der hohe materielle Wohlstand der Industriegesellschaft. Darum sorgt man sich nicht mehr. Und doch ziehen auch dunkle Wolken über durch das Traumland der Generation Z, die sich wechselnd mit der Immobilien-, Banken-, Euro-, Öko-, Demokratie-, Fifa-, und Corona-Krise befassen musste. Doch dazu später.
Generation Z – Kommunikation und Lernen
Post-Millenials bilden die „real digital natives“. Seit allerfrühester Jugend kennen und nutzen sie den unbegrenzten, schnellen und ständigen Zugang zu digitalen Medien. Wer schon im Kinderwagen statt eines abwaschbaren Bilderbuchs einen elektronischen Empfänger sein eigen nennt, bleibt älteren Generationen auf diesem Gebiet auch später intuitiv überlegen. Die schon frühkindlich einsetzende, sehr starke, visuelle Prägung, setzt sich beim Heranwachsenden im breiten Angebot von Hard- und Software ungebremst fort. Doch auch wenn das ganz exzellent auf die Traumberufe des Influencers, Bloggers oder E-Sportlers vorbereitet, verkürzen die ständig wechselbaren Angebote die Aufmerksamkeitsspanne deutlich, was zumindest in traditionalistisch ausgerichteten Beschäftigungen von Nachteil sein kann. Zudem verlieren die konservativen Werte von Wissen und Verbindlichkeit an Macht. Man muss es gar nicht wissen, sondern nur die richtige App kennen. Konnektivität ersetzt in diesem Szenario das tradierte Expertentum, was durchaus Konflikte vorprogrammiert, wenn der jugendliche Glaube an digitale Kompetenzen von Älteren zu schnell als Respektlosigkeit gedeutet wird. Das in hohem Tempo wechselnde digitale Angebot erzeugt aber auch für die jungen Generationen schnell ein klassisches Dilemma, wenn es in Konkurrenz mit unumgänglichen, langen Ausbildungszeiten z. B. als Assistenzarzt steht. Warum breite, stabile Pyramiden bauen, wenn dünne Türmchen schneller zu erstellen sind und genauso hochragen. Dazu wirkt sich das zeitlich und räumlich variable digitale Lernen ganz erheblich auf das soziale Miteinander aus. Vorlesungen in der Zoom-Konferenz lassen sich wohl ganz bequem in Joggers und Socken auf dem Sofa besuchen, die klassische Gruppendynamik eines vollen Hörsaals geht dabei aber gänzlich den Bach runter. Diese soziale Vereinzelung konterkariert in der Medizin nicht nur einen wesentlichen Teil des „sprechenden Berufs“, sondern bedeutet auch den Verzicht auf ein soziales Korrektiv und den Verlust an realen Vorbildern. Studienanfänger der Jahre 2020 und 2021 haben das in extenso erlebt, als in den Lockdown-Phasen von 2020 und 2021 zum Teil semesterlang kein Universitätsgebäude betreten werden durfte.
Leben und Beruf
Ein typisches Phänomen der Generation Z ist der Wunsch nach einer scharfen Trennung von Lebensart und Arbeitswelt. Neben dem Beruf muss alles andere auch möglich sein, aber bitte separiert voneinander. Work-Life-Blending – ehemals Schlagwort moderner Arbeitsformen in der Generation Y – wird von den Neuen eher als Ausbeutung interpretiert. So tendiert man wieder zu einem traditionellen Gesellschaftsbild, in dem man nach pünktlichen Arbeitsschluss in die ungestörte Oase individualisierter Selbstverwirklichung oder die idyllische Mikrowelt von Vater-Mutter-Kind eintaucht. Eine Melange von Öffentlichem und Privaten wird nicht gewünscht. Diese Erwartung erfordert aber sehr konservativ einen sicheren Job. Ganz konsequent wird deshalb in den beruflichen Zukunftszielen der Generation Z das klassische Streben nach Verdienst und Aufstieg im Vergleich zur Berechenbarkeit des Arbeitsalltags nachrangig bewertet. Das hohe Maß an beruflicher Verlässlichkeit wird dabei aber vorwiegend als Bringschuld des Arbeitgebers definiert. Arbeitsbeziehungen werden geschlossen und gekündigt wie Handy-Verträge. Der für Arbeitnehmer günstige Personalmarkt und die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten der Globalisierung suggerieren, dass die ideale Karriere in der Bewegung statt in der Bindung stattfindet. Die Fahrt im Kreisverkehr statt in der Einbahnstraße – ehemals ein Synonym für fehlenden Fortschritt – lässt immer wieder neue, attraktive Abzweigungen vermuten. Vertrag ist Vertrag, aber vielleicht … Und doch reicht es mit der Liebe zur Freiheit wieder nicht ganz so weit. Denn man sucht doch am Ende wie im digitalen Algorithmus eigentlich die absolute eigene Wahrheit. Und so stehen Unverbindlichkeit und Wechselfreude im klaren Widerspruch zum extrem starken Beratungsbedarf der Generation Z, der sich schon wie ein roter Faden durch die gesamte Schulzeit zieht und strukturell manchmal an die staatliche Sportförderung der DDR erinnert. Man kann sich selbst nicht entscheiden, wie denn auch, man weiß ja nicht alles, so vieles ist möglich und vielleicht wird alles nochmal anders? Nicht selten steht am Ende „Wer bin ich?“. Dass andere Pastoren auch schöne Töchter oder Söhne haben, galt schon immer so, wie der Zufall die Welt regiert. Diese Binsenweisheiten zu akzeptieren, fällt der Generation Z genauso schwer, wie Entscheidungen zu treffen. Das Mögliche überwiegt oftmals die Resilienz. „Soll ich’s wirklich machen, oder lass ich’s lieber sein“ lautet die wohlbekannte Hymne.
Wahl des Arbeitsplatzes
Die Hyperindividualisierung der juvenilen Gesellschaftsteile erklärt den Spaß zur höchsten Motivationsstufe. Gamification durchzieht deshalb viele Arbeitsplätze und Projekte von jungen Start-up-Unternehmen als hohes Prinzip. „Spaß for fun“ lautet satirisch nur gering überzeichnet das plakative Motto privater Aktivitäten in den sozialen Medien und der Gaming-Industrie. Grundlage dafür ist eine entspannte Arbeitsatmosphäre, die sich mehr durch Verständnis als Disziplin auszeichnet. Das Individuum wird wieder höher gewichtet als die Gruppe. Bindungen werden weniger persönlich oder institutionell als in der Aufgabenstellung gefunden. Lichtgestalt und Institution treten dahinter deutlich zurück. Man interessiert sich für Bewegung statt Stase, will immer mal etwas Neues machen. Der volatile Einsatz verschiedener Arbeitstechniken ist deshalb besonders attraktiv. Und trotz dieses scheinbar unsteten Arbeitsprozesses sucht die Generation „Beratung“ und wieder auch Sicherheit. Bitte keine weiteren Krisen. Man will schon steil klettern, aber am Sicherheitsseil der ständigen und direkten Rückversicherung. Instant Feedback ist die Leine der Bestätigung, an der die Generation Z seit frühester Jugend hängt und hängen will. Arbeitgeber befriedigen diesen Wunsch erfolgreich durch institutionalisierte Beratung oder Mentoring- und Coaching-Programme. Genau diese Punkte zeichnen für die Generation Z dann echte Arbeitgeber-Attraktivität aus. Durchaus berechtigt erinnert das an die Sozialstruktur einer Schulklasse. Langfristige Personalpläne der Arbeitgeber werden dadurch deutlich anspruchsvoller, denn über allem schwebt wegen des volatilen Arbeitsmarkts das Damoklesschwert der Kündigung. Wenn man nicht bei Laune gehalten wird, dann geht man eben woanders hin.
Akquise und Bindung
Die grundsätzliche Bindungsferne der Generation Z im Öffentlichen hat gravierenden Einfluss auf die Treue zur Arbeitsstelle. Lebensziele werden übergeordnet verfolgt, und behalten vor allem in den späten Studier- und frühen Arbeitsphasen einen metaphorischen Charakter, der zwar vage formuliert, aber doch streng dominierend bleibt. Die vielfach naiv entworfenen, mit der Realität noch nicht abgestimmten, manchmal sogar kindlich imponierenden Vorstellungen der eigenen Lebensform und -entwicklung fordern beharrlich den unbedrängten Transfer in den Beruf, der Älteren dann oft eher an einen Job als an eine Berufung erinnert. Zwangsläufig entsteht so eine belastbare Beziehung zum Arbeitgeber nicht von allein, sondern muss von diesem bewusst hergestellt und sorgfältig gepflegt werden. Im Konfliktfall gewinnt das Private. Die ständige Suche nach Erfüllung im Privaten transferiert sich im Kombipaket direkt mit. Alle Tätigkeiten besitzen im Idealfall einen erkennbaren Sinn. Das gilt insbesondere für Lernprozesse, die die zudem mit einer Selbstwirksamkeit unterlegt sein müssen. Man arbeitet und lernt weniger „on the long term“, sondern kurz und direkt. Auch das ist ein Effekt der Digitalisierung. Die Bestimmung findet sich deshalb – wie schon beschrieben – viel eher in kurzen, wechselnden Projekten, als in übergeordneten Langzeitzielen. Diese Orientierung konveniert mit der schon beschriebenen grundsätzlichen Offenheit, den Arbeitsplatz leichter zu wechseln. Die stärkste Motivation entwickelt sich also projektgebunden – Langeweile ist der Killer. Umschlossen werden muss diese Struktur durchaus anspruchsvoll von einem Wohlfühl-Arbeitsklima. Das angenehme Miteinander und ein kurzer Draht zur verständnisvollen Leitung finden sich regelmäßig unter den Top-Zielen der Arbeitsplatzwahl und hängen dabei herkömmliche Werte wie Renommee und Leistungsstärke des Arbeitgebers deutlich ab. Wie in Kindertagen will man respektiert werden und mitreden, und zwar als Person und unabhängig von Funktion und Leistung, „we are family“. Interesse, Bindung und Atmosphäre erreicht der Arbeitgeber aber nicht durch Anbiedern. Man sieht sich bewusst in anderen Sphären, und das betrifft z. B. auch den Umgang mit und in den sogenannten sozialen Medien. Zu dieser Welt wird man als Oldie vereinzelt zugelassen, aber man darf sie nicht kapern. Auf Bobby-Cars fahren die Jungen, während die Alten wohlwollend Durchlass gewähren. Radikal analoge Einstellungen kommen aber auch nicht gut an. Digitale Hürden in Bewerbungsverfahren werden im ehernen Glauben an den Segensreichtum der Computerisierung durchgehend negativ konnotiert.
Generation Z – „here we come!“
In einer Kolportage bestünde die Generation Z aus krisengeschüttelten Hyperindividualisten, die sich im einem Dauerdilemma zwischen Ohnmacht und Anspruch auf der ständigen Suche nach Andockung ohne Endbindung befinden. In Wahrheit sind es aber vor allem liebenswerte junge Menschen, die die Dinge einfach ein bisschen anders sehen als das alte Establishment. Wie alle vorherigen Generationen verdienen sie neben ehrlichem Respekt auch zugeneigte Empathie und versierte Unterstützung. Das Wohlfühl-Arbeitsklima, ein angenehmes Miteinander und ein kurzer Draht nach oben erscheinen da mehr als legitime Wünsche. In vielen Kliniken werden optimale Arbeitsergebnisse auch deswegen verfehlt, weil eben keine vertrauensvolle Beziehung zur Leitung besteht. Herkömmliche Werte wie Renommee und Leistungsstärke bleiben bedeutsam, offenbaren im absoluten Anspruch auch ihre hässliche Kehrseite. Sicher müssen wir zukünftig manches Mal auf Holz beißen – aber erlitten unsere Vorgänger nicht das Gleiche? And don’t worry: Es gibt ihn nicht, den unausweichlichen Determinismus der Jugend. Wir haben Einfluss, wir können Z formen. Und immerhin sind sie uns näher als Y.
Krones CJ: BDC-Praxistest: Forget about Y – here comes generation Z. Passion Chirurgie. 2022 Dezember; 12(12): Artikel 05_01.