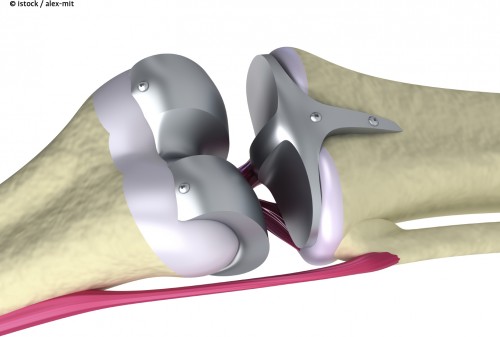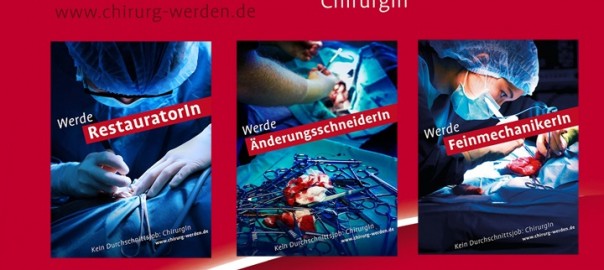Mit Blick auf die Bundestagswahl wird die Entwicklung der Versorgungslandschaft in Deutschland viel diskutiert. Kooperationen zwischen den ambulanten und stationären Sektoren stehen dabei oft im Vordergrund. Das Belegarztsystem überwindet wie kein anderes Versorgungssystem ohne Verluste die Hürden der Sektorengrenzen. Daher spricht sich der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) für eine Stärkung der Belegärztinnen und -ärzte aus und unterstützt die Vorschläge des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi) in dessen aktuellem Gutachten [1].
Laut Zi bedürfe es neuer Lösungen, um künftig eine flächendeckende ärztliche Versorgung besonders in ländlichen Regionen gewährleisten zu können. Mögliche Lösungsansätze seien zum Beispiel belegärztliche Einrichtungen zu fördern. „Das Belegarztsystem ist essenzieller Bestandteil sektorenüberwindender Strukturen und muss durch entsprechende Rahmenbedingungen wieder attraktiver gemacht werden“, fordert Dirk Farghal, Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Beleg- und Kooperationsärzte im BDC (AG BeKo).
Insbesondere für den ländlichen Bereich würden Belegarztkrankenhäuser zusammen mit neuen Versorgungsstrukturen Möglichkeiten bieten, eine hochprofessionelle und vielfältige medizinische Versorgung in einem zunehmend dünner besiedelten Gebiet zu erhalten. Hierzu müsse laut AG BeKo das Belegarztwesen für den ärztlichen Nachwuchs interessanter gestalten werden. Zudem sollten viel mehr Fachrichtungen eingeschlossen werden – auch Allgemeinmediziner.
Die Arbeitsgemeinschaft schlägt vor, Haupt- und Belegabteilungen parallel auf der gleichen Station zu betreiben und so die gegenseitigen Vorteile und Organisationsstrukturen zu nutzen. Für Patientinnen und Patienten würde der Weg zwischen Krankenhaus und Arztpraxis dadurch sehr kurz. Informationsverluste fiele deutlich geringer aus, ebenfalls ein Vorteil für Patienten.
Bisher seien für Belegärztinnen und -ärzte interdisziplinäre Abteilungen nicht vorgesehen. „Chirurgen, Unfallchirurgen und Orthopäden könnten aber gemeinsam mit Internisten, Geriatern oder Hausärzten eine Abteilung betreiben“, schlägt Farghal als mögliches Modell für Belegärzte vor. Patienten als Ganzes und damit die medizinische Versorgung als Ganzes zu betrachten sei die Idee hinter diesem neuen Konzept.
Trotz der Vorteile des Belegarztwesens führt es in Deutschland ein Nischendasein, hierfür gibt es viele Ursachen. Zum einen ein geringeres Honorar. So sind Leistungen im Kapitel 36 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) bis zu 50 Prozent niedriger bewertet als Leistungen im Kapitel 31 EBM. Zwar sind Leistungen aus den Kapiteln 31 und auch 36 extrabudgetär und damit nicht mehr gedeckelt, aber die Begleitleistungen sind es immer noch. „Hier könnten Kassenärztliche Bundesvereinigung und Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) schnell eine Lösung zur Förderung finden und auch die Begleitleistungen extrabudgetär vergüten“, schlägt Farghal vor und fordert, dass in weiteren Verhandlungen dringend die Bewertungen im Kapitel 36 angehoben werden müssten.
Zum anderen sieht die AG BeKo den Erlaubnisvorbehalt als weiteres Hemmnis für Belegärzte. Der Erlaubnisvorbehalt gilt für neue Behandlungsformen in Belegkrankenhäusern – anders sei dies in regulären Krankenhäusern. Dort gelte ein Verbotsvorbehalt. Das bedeutet, neue Methoden dürfen zu Lasten der GKV erbracht werden, solange diese nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschlossen sind. Hier schließt sich die Arbeitsgemeinschaft der Beleg- und Honorarärzte im BDC der Forderung des Berufsverbandes Deutscher Internisten ausdrücklich an [2]. Der BDC fordert ebenso eine deutliche Erweiterung des EBM auf OPS-Ziffern, denen bisher kein GOP des EBM zugeordnet ist. Um auch hier Therapien und Operationen, die weder unter einem Erlaubnis- noch unter einem Verbotsvorbehalt stehen, abrechnen und damit erbringen zu können.
[1] Nagel, Eckhard / Neukirch, Benno / Schmid, Andreas / Schulte, Gerhard: Wege zu einer effektiven und effizienten Zusammenarbeit in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland – Gutachten. http://www.zi.de/cms/fileadmin/images/content/Zi-Forum/2017-05-31/Gutachten_ambulant_vor_station%C3%A4r_final.pdf (21.06.2017).
[2] Belegarztwesen: Internisten sprechen sich für Reform aus. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/74573/Belegarztwesen-Internisten-sprechen-sich-fuer-Reform-aus (21.06.2017).