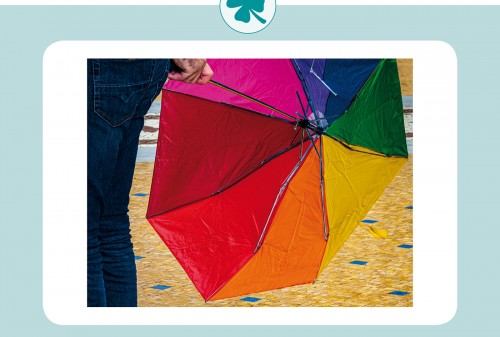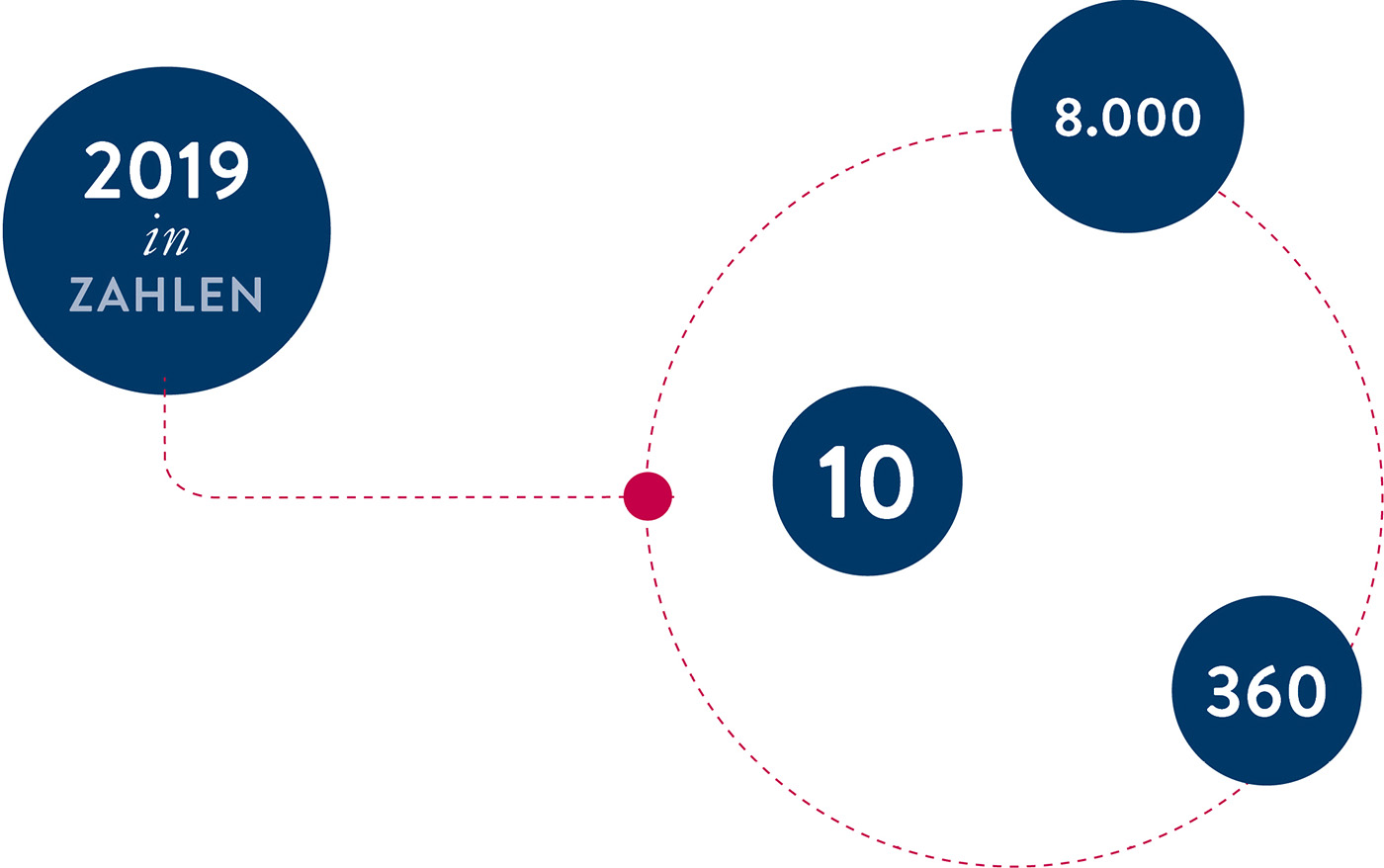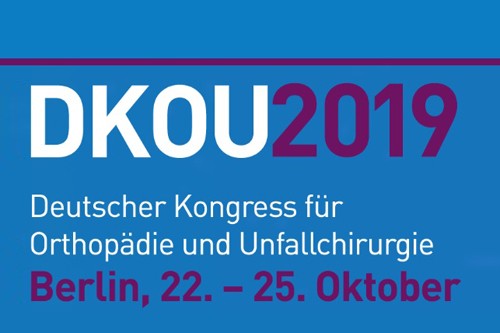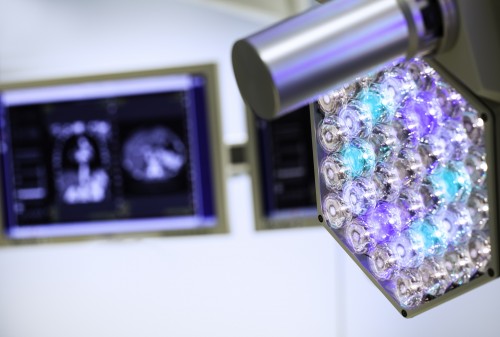Orientierungswert für 2020 steht fest
Die Honorarverhandlungen für das kommende Jahr sind beendet. Die KBV und der GKV-Spitzenverband einigten sich auf eine Erhöhung des Orientierungswertes für alle ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungen in Höhe von 1,52 Prozent.
Ab dem kommenden Jahr beträgt der Orientierungswert 10,9871 Cent (aktuell: 10,8226 Cent). Die Anhebung entspricht einer Honorarsteigerung von rund 565 Millionen Euro. Der Orientierungswert bestimmt maßgeblich die Preise der ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungen und wird jedes Jahr neu verhandelt.
„Es ist gut, dass wir eine Einigung mit unserem Vertragspartner erzielen konnten, zumal die Forderungen anfangs weit auseinanderlagen“, sagte Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV.
Auch die Kassen zeigten sich erfreut über die Einigung, der schwierige Verhandlungen vorausgegangen waren. „Die Selbstverwaltung zwischen Krankenkassen und Ärzten ist der Ort, an dem solche Entscheidungen partnerschaftlich getroffen werden“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des GKV-Spitzenverbandes.
Förderung der Videosprechstunde
GKV-Spitzenverband und KBV haben außerdem vereinbart, die Videosprechstunde finanziell zu fördern. Ab 1. Oktober 2019 zahlen die gesetzlichen Krankenkassen eine Anschubfinanzierung für Ärzte, die Videosprechstunden durchführen. Diese kann bis zu 500 Euro pro Arzt und Quartal betragen.
Die Fördermöglichkeit gilt für zwei Jahre und erfolgt als Zuschlag über die Gebührenordnungsposition (GOP) 01451 (Bewertung: 92 Punkte / 9,95 Euro).
Weitere Anpassungen zur Förderung der Videosprechstunde will der Bewertungsausschuss bis Ende September vereinbaren (die PraxisNachrichten werden berichten).
Ausbudgetierung humangenetischer Beurteilungen
Im Bereich Humangenetik werden die ärztlichen Beurteilungs- und Beratungsleistungen (GOP 01841, 11230, 11233 bis 11236) ab dem kommenden Jahr aus der morbiditätsbedingen Gesamtvergütung (MGV) genommen und extrabudgetär vergütet – zunächst für drei Jahre. Hintergrund ist die Mengenausweitung in diesem Bereich.
GKV-Spitzenverband und KBV verständigten sich außerdem darauf, die bereits bestehende extrabudgetäre Vergütung von Leistungen der In-vitro-Diagnostik tumorgenetischer Veränderungen (EBM-Abschnitt 19.4.2) außerhalb der MGV zu vergüten, um drei Jahre bis zum 1. Juli 2023 zu verlängern.
„Damit berücksichtigt der Bewertungsausschuss die wachsende Bedeutung genetischer Diagnostik und Beratung. Davon profitieren insbesondere Patienten mit seltenen Erkrankungen und Krebserkrankungen in der Familie. Angesichts des rasanten Fortschritts der Medizin kann diese Vereinbarung allerdings nur ein erster Schritt sein“, kommentierte Gassen das Ergebnis.
Veränderungsraten für regionale Verhandlungen
Die regionalen Veränderungsraten der Morbidität und Demografie hatten KBV und GKV-Spitzenverband bereits in der ersten Runde der Honorarverhandlungen am 14. August beschlossen. Sie bilden neben dem Orientierungswert die Grundlage für die regionalen Vergütungsverhandlungen, die im Herbst beginnen.
Die Kassenärztlichen Vereinigungen verhandeln dann mit den Krankenkassen vor Ort, wie viel Geld diese im neuen Jahr für die ambulante Versorgung ihrer Versicherten bereitstellen.
Auf einen Blick: Die Ergebnisse
Orientierungswert: Der Orientierungswert für das Jahr 2020 wird um 1,52 Prozent auf 10,9871 Cent (aktuell: 10,8226 Cent) angehoben. Die Gesamtvergütung wächst damit um rund 565 Millionen Euro.
Behandlungsbedarf: Am 14. August wurden bereits die regionalen Veränderungsraten der Morbidität und Demografie beschlossen. Sie bilden die Grundlage für die regionalen Vergütungsverhandlungen, die im Herbst beginnen.
Videosprechstunde: Als Anschubfinanzierung für die Videosprechstunde wird vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2021 die GOP 01451 als Zuschlag auf die Grund- oder Versichertenpauschale in den EBM aufgenommen. Sie ist mit 92 Punkten (9,95 Euro) bewertet und wird extrabudgetär vergütet – für bis zu 50 Videosprechstunden. Pro Arzt und Quartal sind damit bis zu 500 Euro Förderung möglich. Weitere Anpassungen zur Vergütung der Videosprechstunde werden bis Ende September vereinbart.
Humangenetik: Humangenetische Beurteilungsleistungen (GOP 01841, 11230, 11233 bis 11236) vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2023 und Leistungen der In-vitro-Diagnostik tumorgenetischer Veränderungen (EBM-Abschnitt 19.4.2) werden bis zum 1. Juli 2023 außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet.
Gesetzlicher Auftrag zu jährlichen Verhandlungen
KBV und GKV-Spitzenverband haben den gesetzlichen Auftrag, jährlich über die Morbiditätsentwicklung und über die Anpassung des Orientierungswertes zu verhandeln. Eine Vorgabe des Gesetzgebers ist, dass die Krankenkassen das volle Morbiditätsrisiko ihrer Versicherten tragen müssen. Das bedeutet: Nimmt die Zahl der Erkrankungen und damit der Behandlungsbedarf in der Bevölkerung zu, müssen die Kassen entsprechend mehr Geld bereitstellen.
Außerdem sieht das Gesetz vor, dass der Orientierungswert jedes Jahr überprüft und angepasst werden soll. Dabei sind die für Arztpraxen relevanten Investitions- und Praxiskosten zu berücksichtigen. Ferner sollen die Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven sowie die allgemeine Kostendegression bei Fallzahlsteigerungen in die Berechnungen eingezogen werden.
Die Beschlüsse auf Bundesebene bilden die Grundlage für weitere Verhandlungen auf Landesebene. Dort beginnen im Herbst die Verhandlungen zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen. Dabei wird es darum gehen, wie viel Geld die Krankenkassen für die ambulante Versorgung der Menschen in der jeweiligen Region im nächsten Jahr bereitstellen. Basis bildet die auf Bundesebene vereinbarte morbiditätsbedingte Veränderungsrate und die vereinbarte Anpassung des Orientierungswertes.
Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin, www.kbv.de, Praxisnachrichten 23.08.2019