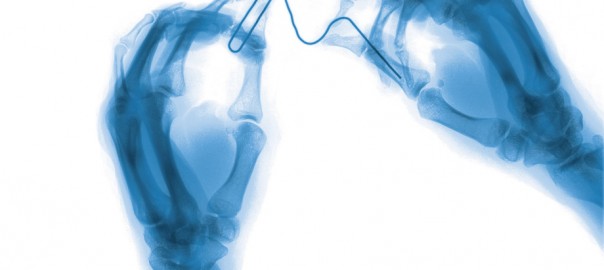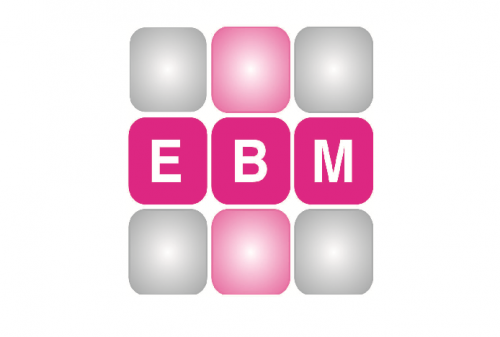Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: “Der Masterplan Medizinstudium 2020 ist ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen Medizinstudium, das unsere Ärztinnen und Ärzte auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet und eine gute Patientenversorgung überall in Deutschland auch in Zukunft sicherstellt. Mehr Praxisbezug im Studium und eine Stärkung der Allgemeinmedizin sind gerade mit Blick auf die gute Versorgung im ländlichen Raum von großer Bedeutung. Zugleich wird die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten gestärkt – dies entspricht den Empfehlungen des Wissenschaftsrats und dem Wunsch vieler angehender Ärztinnen und Ärzte.”
Bundesforschungsministerin Professorin Johanna Wanka: “Mit dem Masterplan werden die Herausforderungen an die nächste Medizinergeneration definiert und Weichen für deren Ausbildung gestellt. Das Studium erhält mehr Praxisbezug, kommunikative und soziale Fähigkeiten mehr Gewicht, um die Arzt-Patienten-Beziehung zu stärken, die für den Behandlungserfolg besonders wichtig ist. Außerdem wird die Allgemeinmedizin ausgebaut. Der sichere Umgang mit wissenschaftlichen Konzepten und Methoden soll bereits während der Ausbildung systematisch vermittelt werden. Nur so können Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen und Patienten stets nach dem neuesten Stand der medizinischen Forschung versorgen.”
Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen: “Mit dem Masterplan Medizin werden die positiven Weichen für die Ausbildung der nächsten Medizinergeneration gestellt. Denn das Studium wird deutlich praxisnäher und an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten kompetenzorientiert ausgerichtet. Die Einrichtung einer Expertenkommission ist zu begrüßen, denn sie begleitet die Reform der Medizinerausbildung und beschäftigt sich mit den Kosten.”
Für die Kultusministerkonferenz, Ministerialdirektor und Amtschef im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Ulrich Steinbach: “Wir haben gemeinsam gute und tragfähige Eckpunkte vereinbart, um die Ziele der Reform – mehr Praxisnähe im Studium und die Stärkung der Allgemeinmedizin – zu erreichen. Mit der Zustimmung leistet die Kultusministerkonferenz ihren Beitrag für weitere Schritte zur Sicherstellung und Verbesserung der medizinischen Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen. Die vollständige Umsetzung des Masterplans ist aus unserer Sicht aber nur möglich, wenn zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Hier stehen auch der Bund und die für die ärztliche Versorgung zuständigen Träger in der Pflicht.”
Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Maria Michalk: “Heute ist ein entscheidender Schritt zur Reform des Medizinstudiums gelungen. Davon werden die angehenden Ärzte und die Patienten spürbar profitieren. Wir verbessern mit dem Masterplan die Qualität der medizinischen Ausbildung und stärken die Versorgung der Menschen, vor allem in der Allgemeinmedizin. Diese Reform war dringend notwendig, um das Medizinstudium auf die Erfordernisse der Zukunft auszurichten.”
Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis: “Mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 schaffen wir eine konsequent praxisorientierte Mediziner*innenausbildung der Zukunft, die neben der Modernisierung des Studiums auch den Herausforderungen zur Sicherung der kurativen Versorgung der Bevölkerung gerecht werden wird. Hierzu setzen wir auf eine stärker an sozialen Kompetenzen der Studierenden ausgerichtete Auswahl der Bewerber*innen sowie die Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium vom ersten Tag an. Das Maßnahmenpaket wird abgerundet durch die Möglichkeit einer Landarztquote in der Verantwortung der Länder, die den Studierenden gemeinsam mit bereits existierenden Fördermöglichkeiten eine verlässliche Perspektive bieten kann, ihren Weg zum Traumberuf am und für Patienten anzutreten.”
Der „Masterplan Medizinstudium 2020“ sieht Veränderungen bei der Studienstruktur und den Ausbildungsinhalten vor. Die Lehre wird an der Vermittlung arztbezogener Fähigkeiten ausgerichtet. Dabei gilt das besondere Augenmerk dem Arzt-Patienten-Gespräch, das maßgeblich die Arzt-Patienten-Beziehung, den Behandlungserfolg und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten beeinflusst. Die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten wird weiter gestärkt. So erhalten Studierende das Rüstzeug für lebenslanges Lernen, um die Fülle immer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse über ihr Berufsleben hinweg in der Praxis einsetzen zu können.
Mit dem „Masterplan Medizinstudium 2020“ wird angestrebt, dass die angehenden Ärztinnen und Ärzte neben den bisher im Mittelpunkt der Ausbildung stehenden hochspezialisierten Fällen an den Universitätskliniken auch ganz alltägliche Erkrankungen in der ambulanten und stationären Praxis kennenlernen. Dazu wird z.B.festgeschrieben, dass Studierende während des Praktischen Jahrs ein Quartal in der ambulanten Versorgung verbringen. Die Allgemeinmedizin wird in der Ausbildung weiter gestärkt. Beispielsweise werden allgemeinmedizinische Inhalte künftig in der Lehre möglichst ab dem ersten Semester über das gesamte Studium hinweg vermittelt und im Staatsexamen wird auch Allgemeinmedizin geprüft.
Auch die Zulassung wird zeitgemäß weiterentwickelt. Diese soll verstärkt auf die heutigen und zukünftigen Anforderungen an ärztliche Tätigkeiten ausgerichtet werden. Soziale, kommunikative Kompetenzen und eine besondere Motivation für das Medizinstudium werden stärker gewichtet.
Als weiterer Anreiz für eine Niederlassung im ländlichen Raum wird den Ländern die Einführung einer so genannten Landarztquote ermöglicht. Die Länder können danach bis zu 10 Prozent der Medizinstudienplätze vorab an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums und der fachärztlichen Weiterbildung in der Allgemeinmedizin für bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten bzw. durch Unterversorgung bedrohten ländlichen Regionen tätig zu sein. Zudem sollen Studierende besser über die Möglichkeiten informiert werden, ganze Ausbildungsabschnitte im ländlichen Raum abzuleisten und über die finanzielle Förderung dafür. Dies ergänzt die Maßnahmen, die mit dem Versorgungsstärkungsgesetz bereits auf den Weg gebracht wurden, wie z.B. gezielte finanzielle Anreize, die Kassenärztliche Vereinigungen über Strukturfonds zur Niederlassung im ländlichen Raum setzen können.
Mit der Verabschiedung des Masterplans wird eine Expertenkommission unter der Leitung von Frau Prof. Monika Harms, Generalbundesanwältin a.D., eingesetzt, die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen auf die Studienplatzsituation und die Kosten untersucht und innerhalb eines Jahres einen Vorschlag zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte erarbeiten wird.
Die Aktivitäten einzelner Länder, zusätzlich zu den Maßnahmen des Masterplans an ausgewählten Hochschulen neue oder zusätzliche Studienplätze für Studienanfängerinnen und -anfänger der Humanmedizin zu schaffen, werden ausdrücklich begrüßt.
 Ein weiterer Schwerpunkt ist das Management von Notfällen auf Station und im Bereitschaftsdienst. Die verschiedenen Seminare und Workshops lassen sich inhaltlich und organisatorisch gut in die ersten zwei Weiterbildungsjahre des Common Trunk begleitend einbauen. Nach Teilnahme an einem der Basisseminare „Common Trunk“ und einem weiteren der angebotenen Workshops wird durch die BDC|Akademie das BDC-Zertifikat „Common Trunk“ verliehen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Management von Notfällen auf Station und im Bereitschaftsdienst. Die verschiedenen Seminare und Workshops lassen sich inhaltlich und organisatorisch gut in die ersten zwei Weiterbildungsjahre des Common Trunk begleitend einbauen. Nach Teilnahme an einem der Basisseminare „Common Trunk“ und einem weiteren der angebotenen Workshops wird durch die BDC|Akademie das BDC-Zertifikat „Common Trunk“ verliehen.