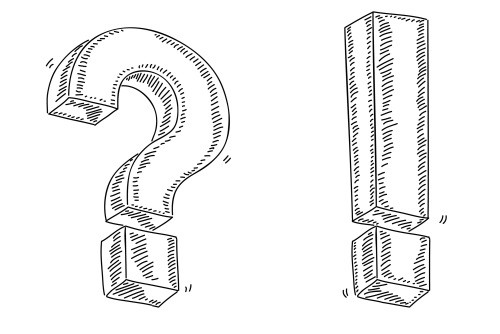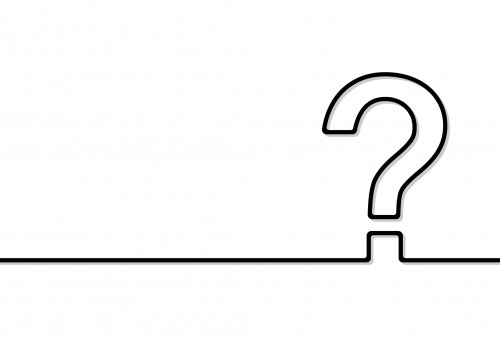Es wurde bereits dargestellt, dass es eigentlich nicht zwingend notwendig ist, zur oftmals gewünschten Gehaltsanpassung eines Oberarztes ein komplett neues Vertragswerk auszuarbeiten und zu unterzeichnen (vgl. Heberer/Hüttl, Der Chirurg, BDC, 05/2010, S. 249).
Gleichwohl ist ein allgemeiner Trend zu verzeichnen, wonach Oberärzten ein außertariflicher Vertrag vorgelegt wird. So halten ca. 30 Prozent aller Oberärzte zwischenzeitlich einen solchen außertariflichen Vertrag in Händen. Zudem ist nach einer repräsentativen Umfrage festzustellen, dass ein allgemeiner Trend hin zu außertariflichen Oberarztverträgen besteht (vgl. in diesem Heft Hennes/Seifert/Ansorg, BDC-Umfrage unter Oberärzten zur Situation mit außertariflichen Verträgen).
Umso erstaunlicher ist es, dass nur 11 Prozent der befragten Oberärzte ihren außertariflichen Vertrag haben juristisch überprüfen lassen. Gerade der Umstand, dass mit einem außertariflichen Vertrag der Unterzeichner das gesamte Tarifgefüge verlässt, macht eine solche Prüfung aus juristischer Sicht unausweichlich. Denn oftmals fehlt es bereits an der Vereinbarung absoluter Grundlagen, wie beispielsweise einer Dynamisierung des Gehaltes und einem hinreichenden Versicherungsschutz. Eine allgemein gültige Haftungsfreistellung kennt das Arbeitsrecht nicht. Ein Arbeitnehmer haftet somit für jeden Grad der Fahrlässigkeit anteilig [1]. Nur der Umstand, dass eine Tarifgebundenheit besteht, sorgt dafür, dass die Haftung auf Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit beschränkt ist. Wie dieses Beispiel deutlich macht, ist es notwendig, dass aufgrund des Wechsels heraus aus dem Tarifgefüge hinein in einen außertariflichen Vertrag vielschichtige Dinge bedacht werden sollten.
Unterstützung des BDC
Aus diesem Grund bietet der BDC einen Service an, der die kostengünstige Überprüfung von Oberarztdienstverträgen vorsieht. Es steht jedem BDC-Mitglied, der einen Oberarztvertrag angeboten erhält, frei, diesen durch vom BDC empfohlene Rechtsanwaltskanzleien überprüfen zu lassen.
Hierfür entsteht ein Unkostenbetrag in Höhe von 380,80 EUR inkl. Mehrwertsteuer und den notwendigen Auslagen. 50 Prozent dieser Kosten trägt der BDC und 50 Prozent trägt das Mitglied. Es ist also möglich, für nicht einmal 200,00 EUR den Arbeitsvertrag auf seine juristischen Fallstricke hin kontrollieren zu lassen.
Berücksichtigt man, dass eine nicht ausreichend geregelte Haftpflicht und beispielsweise der fehlende Ausschluss des Arbeitgeberregresses zu erheblichen finanziellen Risiken führen, ist dieser Betrag sicherlich gut investiert.
Hinzu kommt, dass dann zeitgerecht, meist innerhalb weniger Werktage, das Vertragswerk überprüft wird.
Ähnlich wie bei Chefarztdienstverträgen – auch hier gibt es diesen Service, wenn auch zu etwas veränderten Konditionen – ist es auch bei Oberarztverträgen, die einen überwiegend außertariflichen Inhalt haben, zwingend anzuraten, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen. Denn für den juristischen Laien sind viele Fallstricke gar nicht erkennbar. Im Idealfall kann man diese umgehen, sollte aber als Minimalziel zumindest erkennen, wo die Gefahren im zukünftigen Miteinander aus juristischer Sicht liegen.
Für den Fall, dass sich ein Mitglied für die Beratung entscheidet, kann es per E-Mail oder sonstigen Kommunikationsmitteln den Vertrag mit der Bitte um Begutachtung an den BDC senden. Sofern damit bereits ein Hinweis verbunden ist, dass man die anteilige Kostenübernahme erklärt, wird dann das Mitglied nur noch um Auswahl einer der beiden Kanzleien gebeten und dann der Vertrag im Auftrage des Mitgliedes an die jeweilig zu beauftragende Kanzlei weitergeleitet.
Das dann erstellte ausführliche Gutachten geht oftmals vorab per E-Mail dem Mitglied zu und wird ihm in jedem Fall in Papierform auf dem Postwege übersandt.
FAZIT
Auch wenn es juristisch nicht zwingend notwendig ist, einen vollständig außertariflichen Vertrag abzuschließen, nur um über attraktivere außertarifliche Gehaltsstrukturen Ärzte zu binden, so kann man sich vor dieser Tendenz naturgemäß nicht verschließen.
Sofern man mit scharfem Auge darauf achtet, dass der Rechtsverlust, der mit diesen außertariflichen Verträgen oftmals einhergeht, sich in tolerablen Grenzen hält, spricht hiergegen zunächst einmal nichts.
Wenn man einen solchen angebotenen AT-Vertrag aber ohne juristische Prüfung unter Berücksichtigung allein der auf den ersten Blick möglicherweise finanziell attraktiven Rahmenbedingungen unterzeichnet, so kann dies in letzter Konsequenz unangenehme Folgen haben. Diese reichen von einer unzureichenden Haftpflichtversicherung bis hin zur Aufgabe von beispielsweise kündigungsrechtlichen Besitzständen.
So ist es im Ergebnis sicherlich die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er eine Vertragsberatung, wie sie der BDC anbietet, in Anspruch nimmt. Gleichwohl sollte aus Interesse des Eigenschutzes diese Vertragsberatung eine feste Größe bei den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber einnehmen.
Literatur:
[1] Hüttl P. Arbeitsrecht in Krankenhaus und Arztpraxis. MWV-Verlag 2011, S. 229 ff.
Heberer J. BDC-Service: Vertragsberatung für Ober- und Chefärzte . Passion Chirurgie. 2011 März; 1 (3): Artikel 02_05.