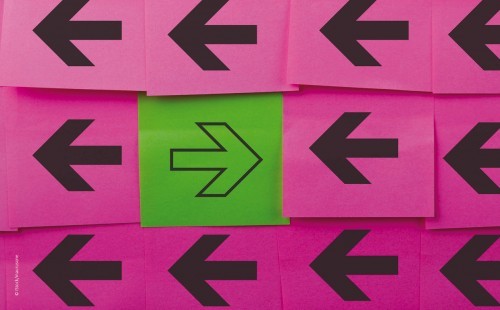Interview mit Prof. Dr. H-J. Meyer, BDC-Präsident und Generalsekretär der DGCH
Kongresszeitung: Eine jüngst publizierte Umfrage des Hartmannbundes unter 1.300 Assistenzärzten verschiedener Fachrichtungen hat eine erschreckend hohe Unzufriedenheit unter jungen Ärzten ergeben. Moniert wurden etwa nicht dokumentierte Überstunden, keine Pausen, eine wenig strukturierte Weiterbildung und vor allem die hohe Arbeitsbelastung und der ökonomische Druck in den Kliniken. Wie kann man in Anbetracht dieser komplexen Problemlage junge Menschen überhaupt noch für das Fach Chirurgie begeistern?
Prof. Meyer: Die in der Umfrage geäußerten Punkte zur Unzufriedenheit junger Ärzte im Berufsleben stellen nun sicherlich kein Novum dar und sind auch nicht erst seit gestern bekannt, was der Vorsitzende des Hartmannbundes bestätigt. Allerdings hat ihn die Deutlichkeit in dieser Analyse überrascht. Den Hilferuf der jungen Ärztegeneration versah eine große überregionale Tageszeitung mit der Titelzeile: „Studiert bloß nicht Medizin!“ Fast zeitgleich wurde dann noch eine Umfrage des Marburger Bunds Schleswig-Holstein zu den Arbeitsbedingungen im Klinikbereich veröffentlicht. Die befragten Ärzte klagten ebenfalls darüber, dass die Arbeitsbelastung zu hoch sei, wobei sich 93 Prozent der Ärzte in Weiterbildung überlastet fühlten. Als Gründe für die zunehmenden, über die gesetzlichen Vorgaben von wöchentlich 48 Stunden hinausgehende Arbeitszeiten werden vor allem Personalmangel, Arbeitsverdichtung bei ökonomischem Druck in den Kliniken, Organisationsmangel oder überbordende Bürokratie genannt. Diese Problematik betrifft dabei nicht nur die Chirurgie, sondern in gleicher Weise fast alle anderen Fächer. Eine gewisse Ernüchterung bei Eintritt in die normale Arbeitswelt ist sicherlich auch in anderen Berufsgruppen keine Besonderheit, aber gerade in der Medizin wird der Studierende bereits im praktischen Jahr, also noch während der Ausbildung, mit dem realen Klinikbetrieb konfrontiert, was dann in der Tat schnell zu einem Wechsel von der Entscheidung für die Chirurgie in ein anderes Fach führen kann.
„Veränderungen im klinischen Betriebsablauf sind längst überfällig“
Generell sind also Veränderungen im klinischen Betriebsablauf überfällig; diese werden allerdings seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich angestrebt, ebenso wie man versucht, eine weitere ökonomische Überformung der Medizin zu verhindern. Nicht erst seit den Empfehlungen des Deutschen Ethikrates ist klar, dass ökonomische Ziele nicht die medizinischen Indikationsstellungen beeinflussen dürfen: Ökonomie muss der Patientenversorgung dienen und nicht umgekehrt! Hinsichtlich des Personalmangels bei zahlreichen unbesetzten Arztstellen wird nun im Rahmen der gerade getroffenen Vereinbarungen von Personaluntergrenzen in der Pflege im Krankenhausbereich vom Marburger Bund und Hartmannbund auch die Festlegung von Personaluntergrenzen für Ärzte durch die Politik gefordert. Allerdings sieht die Politik für einen Personalmehrbedarf keine finanziellen Mittel vor. Eine Alternative könnte die Teilzeittätigkeit darstellen, die während der Weiterbildungszeit dann generell von den Landesärztekammern anerkannt werden müsste. Obwohl nach neuesten Angaben des statistischen Bundesamtes bereits ein Drittel der etwa 80.000 im Krankenhaus tätigen Ärztinnen nicht in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis stehen, wird gerade unter dem Aspekt der geforderten Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie wissenschaftlicher Karriere die berufliche Teilzeittätigkeit neben guter Kinderbetreuung und geregelten Arbeitszeiten als eine der wesentlichen Forderungen von Ärztinnen angesehen. Veränderungen von Arbeitsstrukturen mit frühzeitiger Erstellung von Dienstplänen lassen sich wohl realisieren, insbesondere aber muss die seit Jahren eingeforderte Reduktion der bürokratischen Tätigkeiten des Arztes endlich einmal in praxi umgesetzt werden. Ob alle diese bekannten Probleme für die Klinikärzte durch die vom Hartmannbund geplanten Gespräche mit Krankenhausträgern oder der deutschen Krankenhausgesellschaft wirklich entscheidend verändert oder gar verbessert werden können, halte ich persönlich für fraglich. Vielmehr sind gerade die Ärzte in leitender Funktion selbst aufgefordert, die nachrückende Generation von Ärztinnen und Ärzten individuell zu fördern und gerade im praktischen Jahr der Ausbildung von der begeisternden und besonderen Tätigkeit in der Chirurgie zu überzeugen. Bei aller Akzeptanz einer ausgewogenen Work-Life-Balance muss dabei allerdings auch die Frage erlaubt sein, in welchem Umfang die Nachwuchsgeneration selbst bereit ist, sich in ihr späteres Berufsleben einzubringen.
Kongresszeitung: Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen in der eingangs zitierten Umfrage war an den Universitätskliniken mit Abstand am geringsten: Immerhin 22 Prozent der Befragten bewerteten die Arbeitssituation mit der Note 4 – rund 14 Prozent gaben sogar eine 5. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Prof. Meyer: Diese Frage lässt sich nach meiner Meinung nicht eindeutig beantworten. Auffällig ist nämlich bei dieser Umfrage auch, dass im Vergleich zu früheren Erhebungen 31,4 Prozent der Befragten den Krankenhäusern in privatwirtschaftlicher Trägerschaft die Note 2 hinsichtlich Arbeitszufriedenheit ausstellt – häufiger als den kommunalen Kliniken mit nur 29,6 Prozent, die zuvor als beliebtester Arbeitgeber angesehen wurden. Die ausgesprochen schlechte Beurteilung der Universitätsklinika mag damit zusammenhängen, dass sich etwa 60 Prozent der befragten Ärzte in den ersten zwei Jahren der Weiterbildung befinden und für diesen Ausbildungsstand die Zahl der kleineren Eingriffe in der Chirurgie limitiert sein könnten. Ansonsten treffen die o. a. Probleme in gleicher Weise für nicht universitäre wie universitäre Kliniken zu, vor allem der personelle und ökonomische Druck findet auch in Universitätskliniken statt. Bei einer solchen Beurteilung ist zudem unklar, wie hoch der Anteil an berufstätigen Ärztinnen ist, denn gerade die Kolleginnen beklagen einen möglichen Karriereknick in der Weiterbildung durch Schwangerschaft oder notwendige Kinderbetreuung. Zudem sei auf die anlässlich des Weltfrauentags veröffentlichten Daten hingewiesen, dass Führungspositionen in der Klinik generell weiterhin eine Männerdomäne darstellen. In Universitätskliniken liegt der Anteil der Oberärztinnen bei ungefähr 30 Prozent, der in leitender Position weiterhin stabil bei nur zehn Prozent. All dies befördert möglicherweise eine negative Bewertung.
Kongresszeitung: Trotz der beklagten Arbeitsbedingungen ist ein Medizinstudium nach wie vor für viele junge Menschen ein Lebensziel, für das viele hochambitionierte Kandidaten jahrelange Wartezeiten in Kauf nehmen. Hat der restriktive Zugang zum Studium aus Ihrer Sicht auch Auswirkungen auf die Nachwuchssituation in der Chirurgie?
„Etwa 30 Prozent der Studienanfänger interessieren sich für die Chirurgie, am Ende des praktischen Jahres sind es noch fünf bis zehn Prozent“
Prof. Meyer: Es muss fast paradox erscheinen, dass trotz aller geklagten Missstände im Klinikbetrieb eine Vielzahl von jungen Menschen ein Medizinstudium anstrebt. Der Arztberuf generell ist also weiterhin außerordentlich beliebt. Derzeit gibt es mehr als 10.000 Erstsemester an den staatlichen Universitäten und Hochschulen, zudem existieren noch verschiedene nicht-staatliche Einrichtungen. Nach Aussagen der Stiftung für Hochschulzulassung kommen fast fünf Bewerber auf einen Studienplatz in der Humanmedizin und die Wartezeiten bis zum Studienzugang betragen etwa 14 Monate, sind also länger als die Regelstudienzeit von zwölf Semestern. Die Zulassung zum Medizinstudium ist derzeit in 20 Prozent durch den Notendurchschnitt beim Abitur, in weiteren 20 Prozent durch die Wartezeiten und in 60 Prozent durch verschiedene individuelle Vorgaben und Eignungstest der Fakultäten definiert. Letzteres Auswahlverfahren soll nun durch den Masterplan Medizinstudium 2020 – mit dem die Bundesregierung das Medizinstudium reformieren will – verändert werden. Neben der Abiturnote sollen mindestens zwei weitere Kriterien berücksichtigt werden, insbesondere die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten wie auch die Leistungsbereitschaft, die für die angestrebte ärztliche Tätigkeit mitentscheidende Bedeutung haben. Künftig sollen außerdem eine Ausbildung, Tätigkeit oder ehrenamtliches Engagement im Gesundheitswesen berücksichtigt werden. Eine generelle Landarztquote für die Zulassung bei Verpflichtung zur späteren Niederlassung in einer unterversorgten Region ist zwar vom Tisch, allerdings bleibt eine Option für die Länder bei dieser Regelung offen. Die Auswahlverfahren sollen unter den verschiedenen Fakultäten angeglichen werden. Ob die jetzigen Wartezeiten wirklich verkürzt werden können, bleibt abzuwarten, denn eine Erhöhung der Studienplatzzahlen, wie von der Bundesärztekammer oder dem Marburger Bund gefordert, ist nicht vorgesehen. Qualität steht also vor Quantität. Auswirkungen auf die Nachwuchssituation im Gebiet Chirurgie lassen sich durch die geplanten Vorgaben im Masterplan nicht eindeutig vorhersagen, denn man kann wohl weiterhin davon ausgehen, dass die Wahl für ein chirurgisches Fach erst im letzten Drittel des Studiums und dann besonders im praktischen Jahr getroffen wird. Frühere Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass sich etwa 30 Prozent der Studienanfänger für das Gebiet Chirurgie interessieren, am Ende des praktischen Jahres macht dieser Anteil dann nur noch etwa fünf bis zehn Prozent aus.
Kongresszeitung: Wie bewerten Sie die sonstigen bis dato bekannten Inhalte des Masterplans Medizinstudium 2020 im Hinblick auf die Chirurgie?
Prof. Meyer: Hier ist festzuhalten, dass es beim Masterplan Medizinstudium 2020 primär um die frühe Ausbildung geht, wo die Weiterbildung, etwa mit einer Entscheidung für das Gebiet Chirurgie, in der Regel noch in weiter Ferne steht. Zudem ist der Inhalt der wohl knapp 40 Einzelpunkte dieses Masterplans immer noch nicht genau bekannt. Klar ist lediglich eine Veränderung der Struktur im praktischen Jahr: statt zweier Pflichttertiale in Innerer Medizin und Chirurgie sowie einem Wahltertial, soll jetzt eine Quartalisierung erfolgen. Neben drei Monaten in einem Wahlfach ist ein Pflichtabschnitt ambulante Medizin vorgesehen. Zudem soll im Staatsexamen (M3-Prüfung) eine mündlich-praktische Pflichtprüfung im Fach Allgemeinmedizin eingeführt werden, obwohl diese Vorgaben absolut nicht den Vorstellungen der Studierenden entsprechen. Im Vordergrund der Gesundheitspolitik steht also eindeutig eine Stärkung der Allgemeinmedizin. Die Interessen der Chirurgie müssen nun durch die Universitätslehrer durch eine aktive und umfängliche Beteiligung an der frühzeitig im Studium geplanten Verknüpfung von Theorie und Praxis vertreten werden. Außerdem muss im verkürzen Chirurgie-Quartal intensiv versucht werden, bei den Studierenden die Begeisterung für das Gebiet Chirurgie zu wecken und gegebenenfalls weiter zu steigern. Dass der Masterplan Medizinstudium 2020 allerdings wirklich der geplante große Wurf wird, muss bei weiter bestehender „Black Box“ und nicht geklärter Finanzierung mehr als ernsthaft bezweifelt werden.
Quelle: Nachdruck aus der Kongresszeitung des 134. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Ausgabe vom 23. März 2017, Seite 1
Das Gespräch führte
Carola Marx
Ressortleitung Chirurgie
Dr. R. Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstr.32/1, 69123 Heidelberg
marx@kaden-verlag.de

Interviewpartner
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer
Generalsekretär DGCH
Präsident BDC
praesident@bdc.de
Marx C. „Begeisterung für die Chirurgie wecken und nachrückende Ärzte individuell fördern“ Passion Chirurgie. 2017 Mai, 7(05): Artikel 05_01.