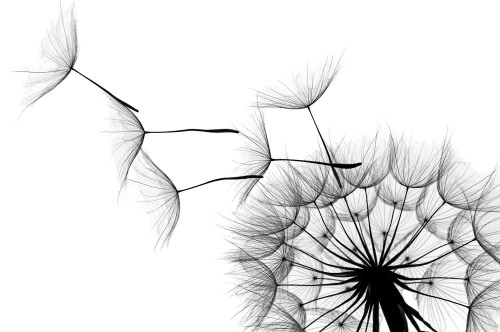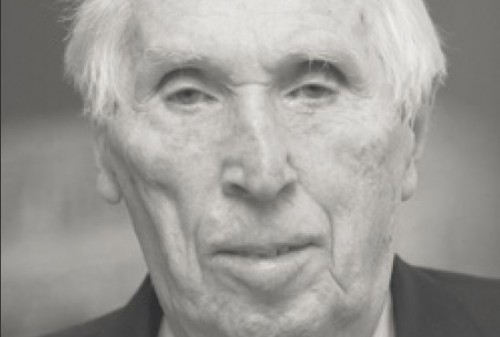Bei dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit denken die meisten in erster Linie an den Austausch mit der externen Öffentlichkeit. Im Berufsverband der Deutschen Chirurgen sind die Mitglieder – also sozusagen die interne Öffentlichkeit – mindestens genauso wichtig. Das Referat umfasst demnach neben der Erstellung von Pressemeldungen und der Beobachtung der Medien auch die Online-Kommunikation mit den Mitgliedern und vor allem die Mitgliederzeitschrift PASSION CHIRURGIE.
Die enge Zusammenarbeit der DGCH und des BDC spiegelt sich in diesem Referat besonders wider. Seit einiger Zeit wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam gestaltet, um insgesamt die Wahrnehmung des Verbandes zu stärken und mit einer Stimme gehört zu werden. Weitere Fachgesellschaften unter dem Dach der DGCH sollen künftig in die Pressearbeit mit dem BDC und der DGCH einbezogen werden – immer mit dem Ziel, gemeinsam gesteigerte Aufmerksamkeit zu bekommen.
Bei unserer Mitgliederzeitschrift des BDC und der DGCH, PASSION CHIRURGIE, funktioniert die Zusammenarbeit schon sehr gut. Beide Geschäftsstellen gestalten in Abstimmung mit uns die Inhalte der Zeitschrift.
Wie wir alle wissen, sind Social Media, gerade für die jüngere Generation der Chirurginnen und Chirurgen, eine sehr wichtige und nicht wegzudenkende Kommunikationsform. Wir sind schon lange aktiv in sozialen Netzwerken und werden diesen Bereich künftig ausweiten. Aktuell bauen wir beispielsweise das Instagram-Profil des BDC auf. Folgen Sie uns gern!
Kooperationen mit Studierendenverbänden, dem Perspektivforum Junge Chirurgie oder auch dem Bündnis Junge Ärzte werden im Social Web schon länger umgesetzt. Das soll in Zukunft Hand in Hand mit den Nachwuchsvertretern in weiteren Kampagnen intensiviert werden.
Neue Mitglieder für den BDC zu gewinnen ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, auch für unser Referat. Wir entwickeln vor allem mit den Nachwuchsvertretern und -koordinatorinnen Ansprachen an junge Kolleginnen und Kollegen, um zu zeigen, warum es sich lohnt, Teil unseres starken Netzwerkes zu sein. Unsere Mitgliederstrukturen verändern sich zunehmend in Richtung der jüngeren Generationen, denn die Babyboomer verabschieden sich langsam wohlverdient aus dem Arbeitsleben. Wir legen den Fokus in Zukunft vermehrt auf Studierende, PJler und Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, um sie in berufspolitischen Zielen zu unterstützen, aber auch, um in den eigenen Reihen Verbesserungen zu erreichen.
Zusammengefasst bleiben wir mit unseren Kommunikationskanälen, extern und intern, am Puls der Zeit und werden die „klassische“ Pressearbeit in enger Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften und den Themen- bzw. Fach-Referaten im BDC weiter ausweiten.
Noch ein Wort zum Abschluss: Seien Sie selber aktiv und schicken Sie uns gerne eigene Artikel, von denen Sie meinen, dass Ihre Kollegen, also unsere Leser, davon einen Gewinn haben könnten.
Meyer HJ, Rüggeberg JA: Das Referat für „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit „ stellt sich vor. Passion Chirurgie. 2019 April, 9(04): Artikel 07_02.