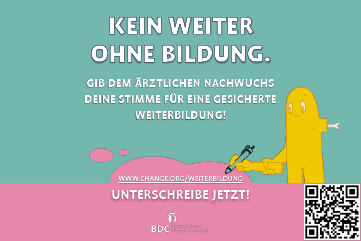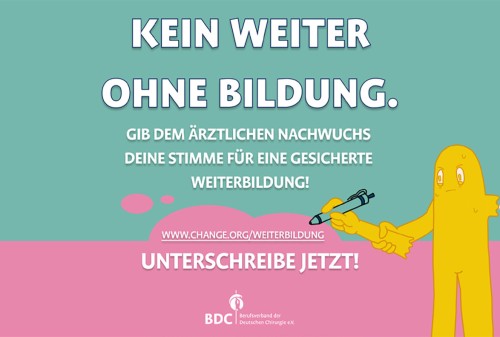Der BDC untermauert seine Forderung nach Bürokratieabbau an den Kliniken durch eine Mitgliederbefragung
Aus den Ergebnissen leitet der Verband konkrete Forderungen und Lösungsvorschläge ab
Bürokratieabbau im chirurgischen Alltag zielt darauf ab, Chirurginnen und Chirurgen wieder mehr Zeit für die Patientenversorgung zu geben und Gesundheitsversorgung insgesamt effizienter zu organisieren.
Die aktuelle Bundesregierung hat sich klar zu diesem Thema bekannt und kündigt in ihrem Koalitionsvertrag „Verantwortung für Deutschland“ ein Bürokratieentlastungsgesetz an. Bereits 2023, in der vergangenen Legislaturperiode, hatte das Bundesministerium für Gesundheit ein „Eckpunktepapier zum Bürokratieabbau im Gesundheitswesen“ veröffentlicht. Dies wurde 2024 durch die Stellungnahme „Abbau überbordender Bürokratie“ der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung ergänzt. Zu einer Gesetzgebung innerhalb der Legislaturperiode 2021-2025 ist es allerdings nicht gekommen, obwohl auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie zahlreiche weitere Verbände im Gesundheitswesen mögliche Vorschläge zur Eindämmung der Bürokratielast eingereicht hatten. Umso wichtiger ist es, das Thema in der laufenden Legislaturperiode prioritär anzugehen.
Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels einerseits und des wachsenden Versorgungsbedarfs einer älter werdenden Gesellschaft andererseits ist es mehr denn je notwendig, Chirurginnen und Chirurgen so weit wie möglich von administrativen Tätigkeiten zu entlasten. Damit soll zudem einer übermäßigen Abwanderung von (angehenden) Chirurginnen und Chirurgen in andere Fachgebiete oder fachfremde Tätigkeiten entgegengewirkt werden.
Um die aktuelle Situation in den Krankenhäusern transparent zu machen, hat der BDC von Ende November 2024 bis Mitte Februar 2025 alle stationär tätigen Mitglieder zur „Bürokratielast in Krankenhäusern“ befragt. Mit dieser Umfrage will der BDC den Handlungsbedarf ermitteln, auf die chirurgische Perspektive aufmerksam machen und das Thema Bürokratieabbau in der neuen Legislaturperiode öffentlichkeitswirksam voranbringen.
Methodik
Die Datenerhebung erfolgte als Umfrage anhand eines digitalen Fragebogens mit 29 Fragen. Alle 8.884 stationär tätigen Mitglieder des BDC erhielten die Einladung zur Teilnahme drei Mal per E-Mail. Mehrfachteilnahmen waren technisch nicht möglich.
Gute Teilnahmequote
Insgesamt 1.659 Chirurginnen und Chirurgen öffneten die Umfrage. Bezogen auf die angeschriebenen BDC-Mitglieder handelt es sich also um eine Rücklaufquote von 19 %. Der BDC dankt an dieser Stelle allen Mitgliedern, die mit ihrer Teilnahme den Verband unterstützen, seine politische Arbeit fundiert durchführen zu können.
Charakteristika der teilnehmenden Chirurginnen und Chirurgen
68 % der Befragten waren männlich, 32 % weiblich. 75 % der Vollzeittätigen waren männlich, 25 % weiblich. 18 % der Befragten waren unter 40 Jahre alt, 25 % waren 40 bis 49-, 39 % 50 bis 60- und 19 % über 60 Jahre alt.
95 % der Teilnehmenden gaben an, aktiv in der Chirurgie tätig zu sein. Entsprechend der Altersverteilung waren 52 % Oberärzte und stellten damit die größte Dienstgruppe im Befragungskollektiv dar, gefolgt von der Gruppe der Chefärzte mit 22 %, der weiteren Fachärzte mit 13 % und der Ärzte in Weiterbildung mit 11 %.
41 % (n=652) der Befragten waren in der Viszeralchirurgie und 29 % (n=459) in der Orthopädie und Unfallchirurgie tätig. Es folgten die Fachgruppen der Allgemeinchirurgie und der Gefäßchirurgie mit 11 % (n=168) und 10 % (n=152) der Befragten.
41 % waren an Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung tätig, 33 % an Krankenhäusern der Schwerpunktversorgung und nur 17 % waren an Krankenhäusern der Maximalversorgung bzw. 7 % an Universitätskliniken tätig.
81 % gaben an, in Vollzeit und 19 % in Teilzeit tätig zu sein.
Bürokratischer Aufwand in der Chirurgie
Die befragten vollzeittätigen Chirurginnen und Chirurgen gaben eine insgesamt sehr hohe Arbeitsbelastung an. 13 % der Befragten antworteten, durchschnittlich insgesamt 40 bis 48 Stunden pro Woche tätig zu sein. Fast die Hälfte (48 %) gab eine Arbeitszeit von 49 bis 59 Stunden pro Woche an und ein Drittel (34 %) von durchschnittlich 60 bis 79 Stunden. 5 % der Teilnehmenden kreuzte an, in der Regel über 80 Stunden pro Woche tätig zu sein.
Bei der Frage nach dem täglichen Zeitaufwand für Verwaltungstätigkeiten und Organisation (z. B. Datenerfassung, Dokumentation, OP-Voranmeldung, Arzt-Briefe, Besprechungen), die über rein ärztliche Tätigkeiten hinausgehen, kreuzten 20 % 1 bis 2 Stunden an, die Mehrheit mit 67 % 3 bis 4 Stunden und 13 % 5 Stunden und mehr.
Dabei waren 36 % der Meinung, dass davon eine Stunde täglich an Verwaltungstätigkeiten und Organisation an nicht medizinisches Personal delegiert werden sollte, die Mehrheit mit 41 % sprach sich für 2 Stunden aus und 20 % für 3 bis 4 Stunden. Lediglich 2 % der Befragten würden mehr als 5 Stunden an Verwaltungstätigkeiten und Organisation delegieren.
Mit 58 % gaben die meisten aller Befragten an, dass im klinischen Alltag häufig Mehrfachangaben identischer Daten erforderlich seien. Demgegenüber fanden nur 12 %, dass dies selten der Fall sei. Beklagt wurde in den Freitextangaben die mangelnde digitale Verknüpfung der unterschiedlichen Eingabemasken.
➜ Lediglich 40 % der Befragten gaben an, bürokratische Arbeit delegieren zu können.
Exkurs: Vergleich der Gruppe der Fachärzte und Ärzte in Weiterbildung mit der Gruppe der weiteren Befragten (i. W. Chefärzte und Oberärzte)
Die Gruppe der Fachärzte und Ärzte in Weiterbildung umfasste insgesamt 378 Teilnehmer. Davon waren 28 % in Teilzeit tätig, gegenüber 19 % in der Gruppe der Oberärzte und Chefärzte. Die Gruppe der Ärzte in Weiterbildung und weiteren Fachärzte gab eine geringfügig niedrigere Arbeitszeit an als die Gruppe der Ober- und Chefärzte. Dies ist auf die vermehrte Teilzeittätigkeit zurückzuführen. Dabei gab die Gruppe der Fachärzte und Ärzte in Weiterbildung, trotz eines höheren Anteils an Teilzeittätigkeit, einen höheren täglichen Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten an: 68 % gaben täglich 3 bis 4 Stunden für Administration an (vs. 66 %) und 21 % geben an, täglich über 5 Stunden mit Administration beschäftigt zu sein (vs. 12 % bei den Chef- und Oberärzten). Dazu passend können nur 23 % der Fachärzte und Ärzte in Weiterbildung administrative Tätigkeiten delegieren, gegenüber 40 % der Ober- und Chefärzte.
Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen war bei den Fachärzten und Ärzten in Weiterbildung niedriger ausgeprägt als bei Ober- und Chefärzten: 34 % beurteilten ihre Arbeitsbedingungen als gut und sehr gut gegenüber 39 % bei Ober- und Chefärzten.
Als Beispiele für redundante zu dokumentierende Daten wurden am häufigsten genannt:
- Patientenstammdaten
- Anamnese, Diagnosen, Prozeduren
- Angaben zu Medikamenten
Dieselben Daten sind für unterschiedliche Erfordernisse mehrfach zu dokumentieren:
- Stammblatt, Anamnesebögen, Patientenakte, Arztbrief
- Chirurgische und anästhesiologische Aufklärung
- Prä-, intra- und postoperative Dokumentation
- Anmeldung zur Diagnostik, zum Tumorboard, Anträge zur Rehabilitation
- Qualitätssicherungsbögen, Krebsregistermeldungen, Studienzwecke, Register
Zusammenfassung und Diskussion
Die Ergebnisse der Umfrage passen in den Kontext weiterer Umfragen zur Bürokratielast in Krankenhäusern (MB Monitor 2022, Deutsches Krankenhausinstitut (DKI) 2024).
Kernaussage der Umfrage ist, dass stationär tätige Chirurginnen und Chirurgen, sowohl in Voll- als auch in Teilzeit, nicht nur ein hohes Arbeitspensum bewältigen, sondern auch mit einem besonders hohen Anteil an administrativen Tätigkeiten konfrontiert sind. 67 % der Vollzeitbeschäftigten gaben in der vorliegenden Umfrage an, 3 bis 4 Stunden für administrative Tätigkeiten täglich gegenüber 57 % der Vollzeitbeschäftigten gemäß MB-Monitor. Der durchschnittliche Anteil für Dokumentationsaufgaben an der Regelarbeitszeit gemäß der Umfrage des DKI entsprach 36 % in Allgemeinkrankenhäusern und lag damit ebenfalls darunter.
Der hohe Anteil administrativer Tätigkeiten resultiert in besonderem Maß aus Mehrfachdokumentationen identischer Daten. 58 % der Befragten gaben an, dass diese häufig oder sehr häufig vorkommen versus 32 % beim MB-Monitor.
Besonders negativ konnotiert waren die Prüfungen des Medizinischen Dienstes, die ebenfalls einen erheblichen Anteil zur administrativen Tätigkeit beitragen (größte Gruppe mit 21 % der Vollzeitbeschäftigten = 5 Stunden pro Monat). Weitere regelmäßige administrative Aufwände ergaben sich aus der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung und dem internen Qualitätsmanagement.
Krankenhäuser in der Pflicht
Priorisiert werden muss aber auch der Bürokratieabbau in den Krankenhäusern vor Ort. Krankenhausträger müssen unbedingt Sorge dafür tragen, dass die Dokumentationserfordernisse in den eigenen Einrichtungen analysiert und die Dokumente bzw. Eingabemasken soweit wie möglich harmonisiert und vernetzt werden. Umständliche Anmeldeprozesse z. B. zur Bildgebung, Funktionsdiagnostik, Operation, Nachsorge und Rehabilitation sollten im Rahmen eines Prozessmanagements analysiert und verschlankt werden.
Um die Bürokratielast zu senken, empfiehlt der BDC dem Gesetzgeber die Umsetzung folgender Sofortmaßnahmen:
- Vorgaben für die Standardisierung der Dokumentation und die Interoperabilität der Datenverwaltungssysteme über einheitliche Schnittstellen als Voraussetzung für den umfassenden und validen Datenaustausch innerhalb der Kliniken und zwischen unterschiedlichen Einrichtungen
- Vorgaben zur Reduktion von Dokumentationserfordernissen im Sinne der Datensparsamkeit:
–Verpflichtung der Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung zur Überprüfung aller Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagementmaßnahmen auf ihren Nutzen und Möglichkeiten, Dokumentationsaufwand einzusparen (u. a. Umsetzung des G-BA-Beschlusses über Eckpunkte zur Weiterentwicklung der datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung), Überprüfung der Qualitätsberichte der Krankenhäuser)
–Verpflichtung der Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung zur Überprüfung aller in der Versorgung häufig verwendeten Formulare im Hinblick auf Vereinfachung und digitale Verwendung
–Verpflichtung des Medizinischen Dienstes zur Vereinheitlichung von OPS-Strukturprüfungen und Qualitätsprüfungen zu einem gemeinsamen Prüfregime, Einführung eines übersichtlichen Standarddokumentensatzes für die Abrechnungsprüfung, Überarbeitung der Richtlinie „Regelmäßige Begutachtungen zur Einhaltung von Strukturmerkmalen von OPS-Kodes“ (StrOPS-Richtlinie), u. a. durch Überprüfung der vorgeschriebenen Strukturmerkmale, die Verlängerung der Gültigkeit von Bescheinigungen sowie die Einführung einer zentralen Datenbank.
–Abschaffung der Doppeldokumentation beim Endoprothesenregister
–Abschaffung überflüssiger Dokumentation bei der Einleitung einer Anschluss-Rehabilitation
Delegation an nicht medizinisches Personal
Angesichts des hohen Arbeitspensums und der hohen Bürokratielast fordert der BDC Krankenhausträger zudem dringend dazu auf, verstärkt Möglichkeiten für die Delegation bürokratischer Tätigkeiten an nichtärztliches Personal zu schaffen. Es erscheint unverständlich, dass nur 40 % der Befragten angaben, bürokratische Tätigkeiten delegieren zu können, obwohl ein hoher Anteil an Verwaltungstätigkeiten als delegierbar an nicht medizinisches Personal eingeschätzt wurde (2 Stunden (41 %), 3-4 Stunden (20 %) täglich bei Vollzeitbeschäftigten). Dies steht in Einklang mit weiteren Erhebungen, die ein hohes Potential prinzipiell delegierbarer Tätigkeiten in der Chirurgie identifizieren konnten und gleichzeitig ein hohes Einsparpotential durch entsprechende Delegation aufzeigen.
Digitalisierung vorantreiben und digitale Instrumente und Programme einsetzen
Schließlich müssen die Chancen der Digitalisierung endlich genutzt werden. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen sind hier wiederum die Krankenhausträger in der Pflicht, intelligente IT-Strukturen vor Ort umzusetzen. Die Tatsache, dass 88 % der Befragten den tatsächlichen Nutzen der Informationstechnik zur Reduktion des Dokumentationsaufwands als eher gering oder gering einschätzten, macht deutlich, dass entscheidende Potenziale leider immer noch ungenutzt bleiben. Dieses frappierende Ergebnis sollte Entscheidungsträgern auf allen Ebenen unbedingt ein Ansporn zu mehr Investitionen in eine angemessene IT-Infrastruktur sein. Dabei sollten die Beteiligten zukünftig unbedingt einbezogen werden (65 % der Befragten gaben an, dass ärztliche Anforderungen bei der Anschaffung neuer Software nicht berücksichtigt würden).
Fazit
Chirurginnen und Chirurgen bewältigen ein hohes Arbeitspensum mit einem immensen Anteil administrativer Aufgaben. Die Möglichkeiten der Delegation administrativer Aufgaben an nicht ärztliches Personal sind bei Weitem nicht ausgeschöpft
Überflüssige Dokumentation entsteht durch überbordende bürokratische Vorgaben der Normgeber, die teilweise nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind, aber auch durch Doppeldokumentation im Rahmen ineffizienter Aufbau- und Ablauforganisation in den Krankenhäusern. Die Verantwortlichen vor Ort wie auch die Normgeber sind in der Pflicht, überflüssige Dokumentation abzubauen und die Voraussetzungen für den reibungslosen Datenaustausch zu schaffen.
Erforderlich sind gesetzliche Vorgaben, Infrastrukturförderung sowie Investitionen der lokalen Krankenhausträger. Ein Expertengremium von Akteuren aus der Selbstverwaltung sowie Berufsverbänden und Fachgesellschaften soll das Bundesgesundheitsministerium bei der Entbürokratisierung beraten. Die vorliegenden Konzepte u. a. von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind zu berücksichtigen. Schließlich brauchen wir einen Kulturwandel: Bürokratie und Überregulierung müssen abgebaut und das Vertrauen in die Leistungsträger vor Ort gestärkt werden.
Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bei einer älter werdenden Bevölkerung müssen angehende Chirurginnen und Chirurgen für ihr Fachgebiet begeistert, anstatt überproportional mit bürokratischen Pflichten belastet zu werden.
Burgdorf F, Kunze C, Braun B, Richardt D, Meyer HJ, Auhuber T: Ergebnisse der BDC-Umfrage „Bürokratielast in Kliniken“. Passion Chirurgie. 2025 September; 15(09/III): Artikel 05_03.