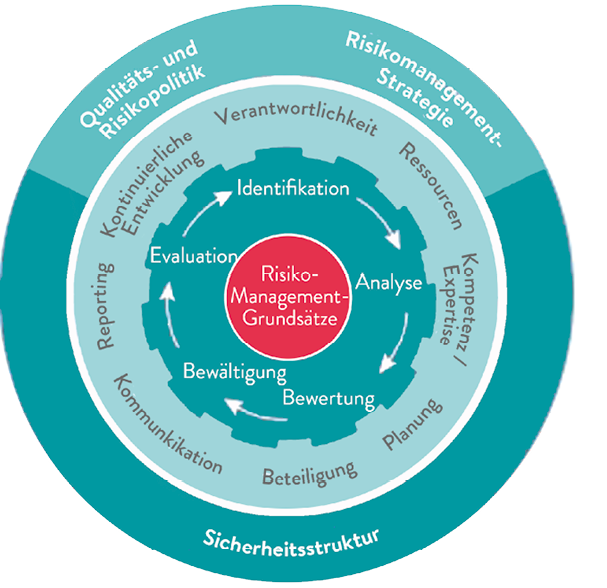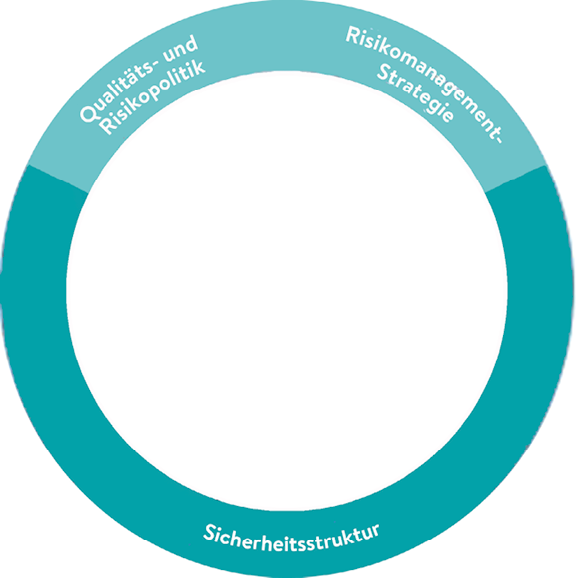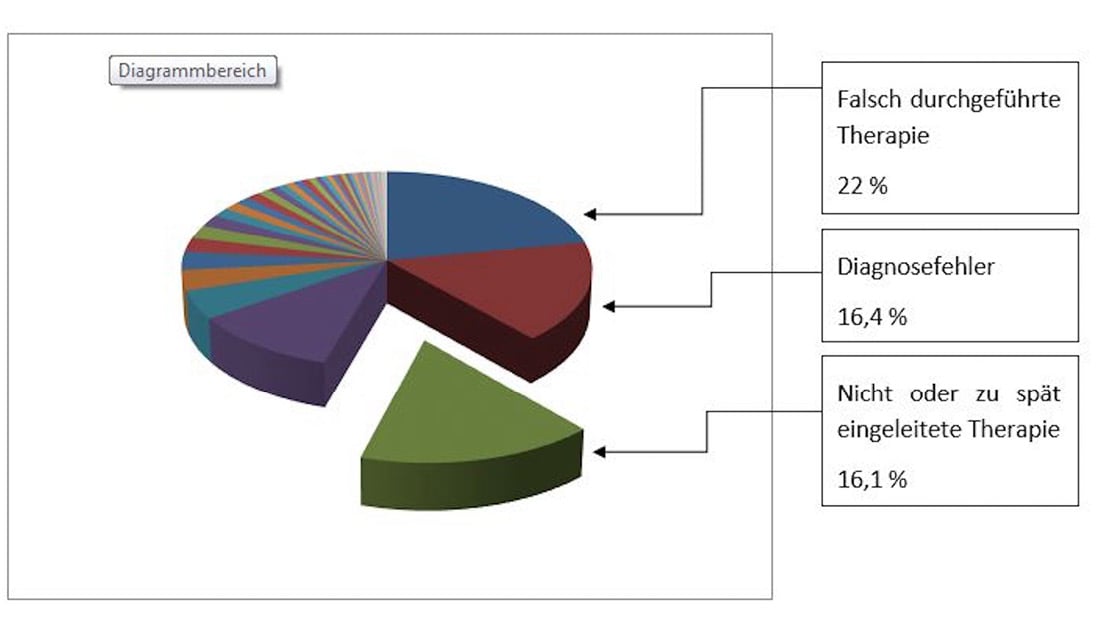In einer schnelllebigen Welt ist die Fähigkeit, sich kurzfristig und flexibel an Veränderungen anzupassen, existenziell. Globalisierung, Digitalisierung und Technologisierung führen zu einem ständigen Anpassungsdruck auf Unternehmen.
Diese primär aus der freien Wirtschaft stammende Entwicklung nimmt auch zunehmend Einfluss auf das Gesundheitssystem. Ein Krankenhaus muss heutzutage in den Wettbewerb mit anderen Einrichtungen treten und sich stets auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand der Medizin, der Pflege, der Technik und neuer gesetzlicher beziehungsweise untergesetzlicher Vorgaben halten. Aufgrund der stetig anspruchsvoller werdenden Behandlungs- und Versorgungsmethoden sowie der immer weiter reduzierten Verweildauer von Patienten verdichten sich die Arbeitsprozesse im Gesundheitssektor fortlaufend. Eine schnelle, qualitativ hochwertige und sichere Versorgung muss trotz zunehmendem Fachkräftemangel und Kostendruck gewährleistet sein.
All dies stellt eine deutliche Herausforderung für Einrichtungen im Gesundheitssystem dar und bedarf neuer Lösungsansätze.
Auch entsprechende Konzepte können Leistungserbringer des Gesundheitssystems in der freien Wirtschaft finden. Erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen befassen sich durchgängig mit der Prozessoptimierung und somit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Profitabilität. Neue Prozessgestaltungs- und Organisationsformen wie das „Lean Hospital“ oder das „agile Krankenhaus“ kommen aus dem anglo-amerikanischen Raum nach Europa und finden auch im deutschsprachigen Gebiet immer mehr Aufmerksamkeit. Derartige Konzepte können der Philosophie und den Arbeitsweisen der Agilität oder beispielsweise dem Design Thinking oder Scrum zugeordnet werden.
Eine Methode des Design Thinkings ist zum Beispiel das Design Thinking Team. Durch ein interprofessionelles Team sollen neue Ideen zur Lösung von Fragestellungen kreiert werden. Im Setting Krankenhaus kann dieses Team das „Case Team“ sein. Bei komplexen Krankheitsbildern wird es anhand bestimmter Kriterien hinzugezogen und übernimmt als interdisziplinäres und interprofessionelles Team die Versorgung des Patienten. Hierdurch wird der Patient noch deutlicher in den Fokus einer ganzheitlichen Betrachtung gesetzt und eine optimierte Versorgung eingeleitet.
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Agilität in diesem Zusammenhang: Prozesse und Strukturen beweglich gestalten und innerhalb dieses Rahmenwerks agieren.
Das Krankenhaus: an sich ein agiles System
Gerade das Ökosystem Krankenhaus ist davon geprägt, sich immer wieder an neue und zum Teil unvorhersehbare Situationen anpassen zu müssen. Ein Massenanfall von Verletzten, ein plötzlich neu auftretender Virus oder der nicht zur Verfügung stehende Platz auf der Intensivstation können die alltäglichen Routine-/Standard-Prozesse stören und erfordern ein flexibles Handeln, um ein Zusammenbrechen der Abläufe zu verhindern und den gewünschten Outcome zu gewährleisten.
Durch die Einführung von in der Wirtschaft bewährten Konzepten der Prozessgestaltung und -optimierung, werden ähnliche Ergebnisse im Unternehmen Krankenhaus angestrebt, wie sie auch in Wirtschaftsunternehmen erzielt werden. Solche neuen Konzepte müssen sich jedoch in die bestehenden Strukturen des Gesundheitssystems einfügen. Personalmangel, fehlende monetäre Ressourcen und ein starres, konservatives System mit zahlreichen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben erschweren die Nutzung von innovationsorientierten Mindsets.
Das Ökosystem Krankenhaus hat zusätzlich Besonderheiten. Auf der einen Seite wirken permanent unvorhersehbare Einflüsse ändernd auf das System ein, auf der anderen Seite besteht ein hoher Bedarf an Prozessstabilität und Standardisierung, um eine qualitativ hochwertige und sichere Patientenversorgung gewährleisten zu können. Das steht für viele Menschen zunächst in einem Widerspruch: Wie soll ein Prozess stabilisiert und standardisiert werden, wenn gleichzeitig im hohen Maße flexibel auf sich ändernde Gegebenheiten reagiert werden muss? Genau diesen Widerspruch aufzulösen, ist jedoch die Besonderheit und Stärke der Agilität.
Agilität bedeutet nicht, ohne Standards, Regeln und Vorgaben zu handeln. Es bedeutet vielmehr: Derjenige, der agil handelt, weiß, wann und in welcher Art und Weise er von diesen Standards und Vorgaben im begründeten Fall abweichen kann (und muss), um somit auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können und innovativ sowie erfolgreich zu sein.
Das Krankenhaus als solches, losgelöst von dem System, in dem es sich befindet, ist ein Paradebeispiel für die Sinnhaftigkeit einer agilen Arbeitsweise. Einer Mitarbeitendenschaft mit hohen Fachkompetenzen steht eine unbegrenzte Fülle von möglichen Arbeitsprozessen (aufgrund unterschiedlichster Symptom- und Krankheitsbilder) und unberechenbarer Situationsveränderungen aufgrund einer dynamischen Patientenbewegung gegenüber. Durch Fachkompetenz und Organisationsvermögen müssen die Mitarbeitenden in der Lage sein, auf externe Ereignisse, wie zum Beispiel eine Pandemie, zu reagieren und dabei einem höchsten Anspruch auf optimale Produktqualität (Patientenversorgung) gerecht zu werden.
Um diese Garantie einzulösen, müssen alle Bereiche miteinander effektiv interagieren. Gerade an den Schnittstellen eines Krankenhauses kann dies jedoch oftmals problematisch werden. Durch „Dorfdenken“ einzelner Fachabteilungen werden interdisziplinäre und interprofessionelle Strukturen ausgebremst. In der Notaufnahme bedarf es zum Beispiel einer optimalen Zusammenarbeit der verschiedensten Bereiche. Zahlreiche Studien belegen, dass im Vergleich zur früher üblichen Notfallversorgung unterteilt nach Fachabteilungen (der internistische oder der chirurgische Notfall) das Outcome eines Patienten besser ist, wenn dieser ganzheitlich in einer zentralen Notaufnahme versorgt wird, statt mit dem eingeschränkten Blick einer einzelnen Fachabteilung betrachtet zu werden. Die Mitarbeitenden befassen sich mit unterschiedlichen Versorgungsspektren und verfallen somit nicht in eine „Fachblindheit“.
Durch eine agile Prägung von Krankenhäusern wird eine Arbeitssituation ermöglicht, die langfristig zu einer Verbesserung des Arbeitsklimas führt, indem die interdisziplinären und interprofessionellen Mauern eingerissen werden. Die Einzelinteressen eines jeden werden hintangestellt. Die optimale Patientenversorgung steht im Fokus. Durch die im agilen System eingesetzten Werkzeuge entwickelt sich außerdem eine Kultur, die einen offenen und transparenten Umgang mit Fehlern und Beinahefehlern lebt und es so ermöglicht, aus diesen zu lernen und sie zukünftig zu vermeiden.
Aus unvorhersehbaren Ereignissen können durch agile Methoden und Instrumente Ereignisse werden, auf die mit einer gewissen Vorausplanung reagiert werden kann. Das hat sich zum Beispiel in den Herausforderungen der Corona-Pandemie gezeigt. Krankenhäuser mussten zusätzlich zu ihrem regulären Versorgungsauftrag auf die besonderen Anforderungen der pandemischen Lage reagieren. Weitere Intensivversorgungsplätze und Isolationsstationen mussten eingerichtet, Prozesse für die Versorgung von infektiösen und nicht infektiösen Patienten vorbereitet und die Mitarbeitenden auf eine solche Situation hin geschult werden.
Das Gesundheitssystem setzt Grenzen
Genau in solchen Extremsituationen werden neben den Stärken der Agilität aber auch die Grenzen der Umsetzung im Krankenhaussystem sichtbar. Ein Krankenhaus kann eben (leider) nicht losgelöst von dem System gesehen werden, in dem es sich befindet. Agilität ist nur dann sinnvoll, wenn sie angewandt wird, um Prozesse beziehungsweise Arbeitsweisen zu optimieren und nicht um kompensatorisch auf anderweitige Missstände zu reagieren. Agilität ist ursprünglich zur innovativen Fortentwicklung eines Unternehmens und nicht als „Lückenfüller“ gedacht worden.
Deutsche Krankenhäuser leiden seit Jahren unter Personalmangel und Unterfinanzierungen. Einer Veröffentlichung der deutschen Krankenhausgesellschaft von 2019 ist zu entnehmen, dass zu diesem Zeitpunkt ein Investitionsstau von mindestens 30 Milliarden Euro im deutschen Krankenhaussystem vorlag. Hinzu kommt der Fachkräftemangel: Bis 2035 werden rund 307.000 Pflegekräfte in der stationären Versorgung fehlen (Radtke R. (2020) „Prognostizierter Bedarf an stationären und ambulanten Pflegekräften* in Deutschland bis zum Jahr 2035“). Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel reichen oftmals nicht aus, die gesetzlich vorgegebene Struktur der Krankenhausfinanzierung kann aber von den Kliniken auch nicht oder nur kaum durchbrochen werden. Diese Situation setzt die Krankenhäuser unter einen enormen wirtschaftlichen Druck – wobei das dualistische Finanzierungssystem durch klare Kostenzuweisungen die Gesundheitseinrichtungen auch im wirtschaftlichen Handeln zum Teil wieder beschränkt.
Fazit
Das deutsche Gesundheitssystem stellt mit seinem Finanzierungssystem und seinen Strukturen ein konservatives Konstrukt dar, das nur schwer mit den Veränderungen der Zeit mithalten kann. Einrichtungen wie Krankenhäuser sind gezwungen, neue Wege zu gehen, um sich über den Auftrag als Grund- und Regelversorger hinaus behaupten zu können. Neue Konzepte, Strategien und Denkweisen müssen hierfür herangezogen werden.
Agilität kann je nach Anwendung ein solches Konzept, eine solche Strategie und Denkweise sein. Agilität wird konservative Mauern einreißen und interdisziplinäre und interprofessionelle Strukturen aufbauen. Eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten rückt mehr in den Fokus, und durch moderne Arbeitsweisen erfahren Mitarbeitende eine Wertschätzung und Professionalisierung ihrer Tätigkeiten. Gerade in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels suchen sich hoch qualifizierte und innovativ denkende Mitarbeitende Krankenhäuser als Arbeitsplatz aus, in denen sie ihr Fachwissen anwenden und ihren Arbeitsplatz mitgestalten können.
Das deutsche Krankenhaussystem weist aber eine heterogene Struktur auf. Nicht jeder Klinik stehen die gleichen Ressourcen auf personeller oder finanzieller Ebene zur Verfügung. Deshalb bestehen für die einzelnen Einrichtungen auch nicht die gleichen Möglichkeiten zur Anwendung innovativer Methoden. Denn das Instrumentarium der Agilität ist nicht dazu gedacht, Lecks abzudichten, sondern Innovationen zu ermöglichen.
Die Kluft zwischen „innovativen“ und „konservativen“ Einrichtungen nimmt somit stetig zu. Letztlich wird es im Laufe der Zeit zu einer „darwinistischen Auslese“ im Krankenhausmarkt kommen. Krankenhäuser, die es nicht schaffen (können), moderne Unternehmenskonzepte und Strukturen zu implementieren, werden nach und nach aus den bestehenden Strukturen „wegbrechen“. Nur durch eine generelle Umstrukturierung des Gesundheitssystems von einer eher reaktiven hin zu einer prospektiven Struktur wird es möglich sein, eine solche Entwicklung zu unterbinden.
Meilwes F: Safety Clip: Prozessoptimierung durch Agilität im Krankenhaus. Passion Chirurgie. 2022 Juni; 12(06): Artikel 04_02.