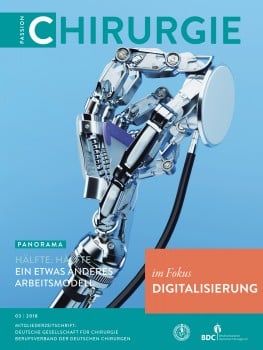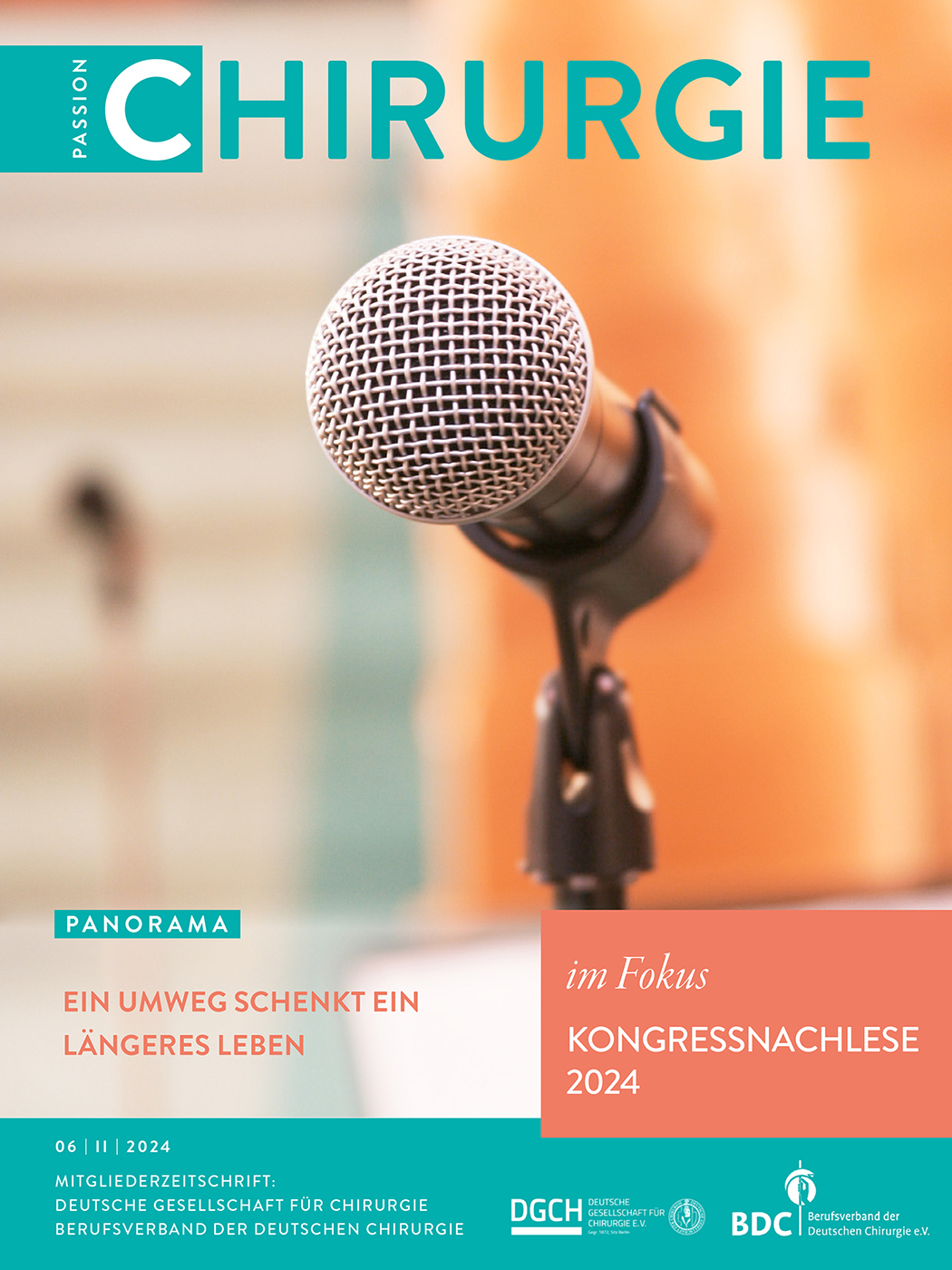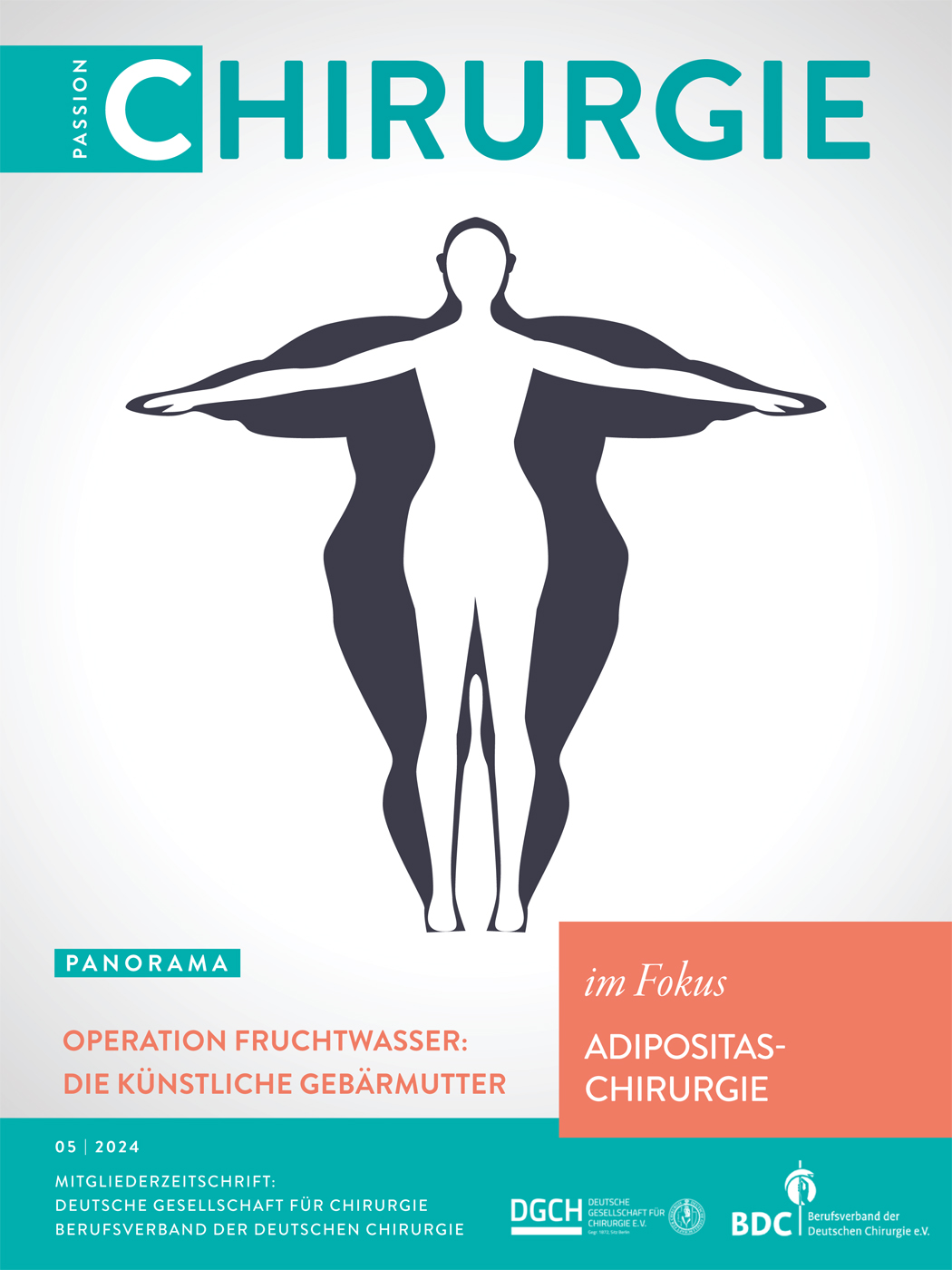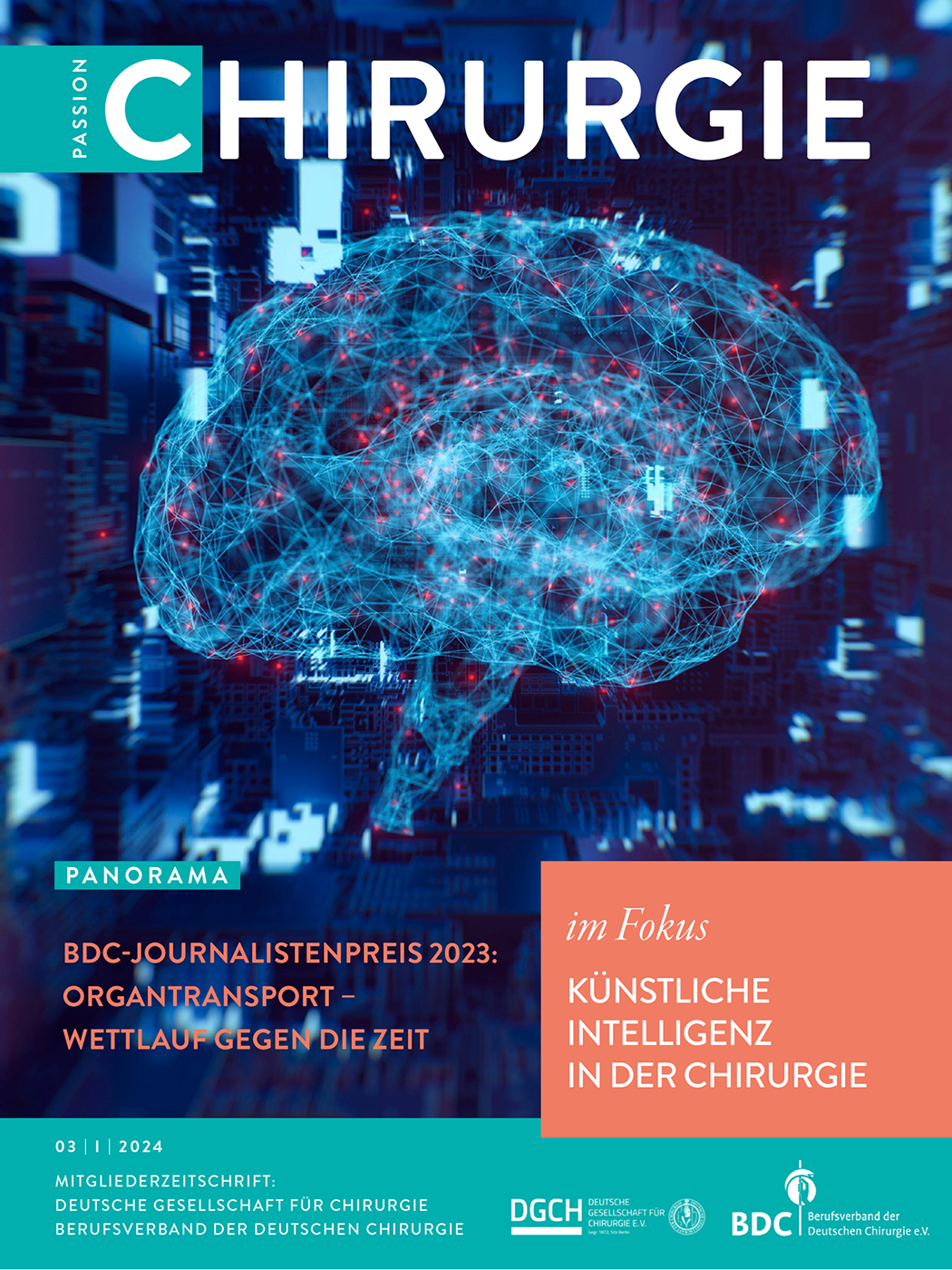01.03.2018 Safety Clip
Safety Clip: Der richtige Umgang mit Katastrophenereignissen

Katastrophenmanagment als Bestandteil des Risikomanagements
In einem Krankenhaus laufen zeitgleich verschiedene aufeinander abgestimmte Versorgungsprozesse ab. Kommt es zu einer ungeahnten Störung der Prozessabläufe, können daraus schwerwiegende Folgen für die Patientensicherheit resultieren. Eine der größten und verheerendsten Störungen verursacht der Katastrophenfall. Ein Brandereignis, eine Störung der technischen Versorgung mit Energie oder Wasser oder der Ausfall des IT-Systems bedrohen die Patientensicherheit in demselben Maße wie ein Großschadenereignis mit einem Massenanfall von Verletzten.
Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, ist die vorausschauende Alarm- und Einsatzplanung ein Muss für alle Einrichtungen des Gesundheitswesens. Hierdurch lassen sich Ausfallzeiten verkürzen, der Versorgungsauftrag sicherstellen und vor allem Menschenleben retten. Hinzu kommt die Abwendung rechtlicher Folgen für die verantwortlichen Personen der Einrichtung. Vernachlässigt die Einrichtung das Thema, macht sie sich im Schadenfall des Organisationsverschuldens strafbar.
Planung fängt bei der Analyse an
Ein zeitgemäßer und ebenso bedarfsgerechter Alarm- und Einsatzplan für den Katastrophenfall bedarf zunächst einer detaillierten Analyse der vorhandenen Gegebenheiten. Dazu sind unter anderem folgende Fragen zu beantworten:
- Wie sind die einzelnen Brandabschnitte im Krankenhaus aufgeteilt?
- Gibt es Stationen mit einer Patientenklientel, bei denen besondere Aufsichtspflichten zu beachten sind (z. B. geschlossene/forensische Psychiatrie)?
- Wie ist die Versorgungsstruktur der Einrichtung? Gibt es Redundanzen zu den Versorgungseinspeisungen?
- Wie gelangt im externen Großschadenfall das Personal zum Krankenhaus ohne die Zu- und Abfahrtswege zu versperren?
- Sind geeignete Räumlichkeiten vorhanden, um z. B. im Pandemiefall mehrere hochkontagiöse Patienten behandeln zu können?
- Bestehen Ausweichmöglichkeiten/Ausfallkonzepte, wenn einzelne Abteilungen wie z. B. die Notaufnahme ausfallen?
Neben dem hausinternen Status quo müssen auch die externen Faktoren erörtert werden:
- Wie ist die umliegende Krankenhausstruktur? Gibt es in der Umgebung geeignete Gesundheitseinrichtungen, in denen Patienten untergebracht werden können?
- Was sind potentielle Schadenszenarien? Liegen Autobahnen oder ein Flugplatz in der Nähe des Krankenhauses? Ist ein großes Fußballstadion oder Messezentrum in der Region vorhanden?
Erst nach einer Ermittlung des Ist-Zustandes kann mit der Erstellung eines konkreten Alarm- und Einsatzplans für den Katastrophenfall begonnen werden.
Understatement statt Überforderung
Die Leitstellen der Rettungsdienste sind im Katastrophenfall auf zuverlässige Aussagen zu den Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser angewiesen, um bereits in der Präklinik die richtigen Weichen für eine sichere Patientenversorgung stellen zu können. In externen Großschadenlagen neigen Krankenhäuser jedoch dazu, sich und damit ihre Aufnahmekapazitäten zu überschätzen. Die Patientensicherheit ist gefährdet. Es ist deshalb wichtig, bereits im Voraus eine realistische Erhebung durchzuführen, wie viele Patienten der Sichtungskategorie rot, gelb und grün mit den vorhandenen Ressourcen im Krankenhaus tatsächlich gleichzeitig behandelt werden können. Bei der Erhebung sind die „regulären“ Patienten in der Notaufnahme nicht zu vernachlässigen. Diese sind ebenfalls zu versorgen und binden somit entsprechende Ressourcen.
Think big, play small
Grundsatz bei der Erstellung eines Alarm- und Einsatzplans für den Katastrophenfall ist die Aussage „Think big, play small“. Ein „Zurückbauen“ der Ressourcen ist immer möglich, ein Aufstocken führt im laufenden Katastrophenfall zu Problemen. Unabhängig von der tatsächlichen Aufnahmekapazität bei einer Großschadenlage sollte das Krankenhaus auf die Versorgung einer höheren Patientenzahl ausgerichtet sein. Dasselbe gilt für die Anzahl an Evakuierungshelfern und Mitarbeitenden im Krankenhaus. Gerade die Ressource „Mitarbeitende“ sollte großzügig berechnet werden, damit im Bedarfsfall ausreichend Personal zur Verfügung steht. Es kann immer ein Mitarbeitender kurzfristig ausfallen.
Teamwork und kein Einzelspiel
Großschadenlagen erfordern auch einrichtungsübergreifend einen optimalen Ressourceneinsatz sowie ein Höchstmaß an interdisziplinärer Zusammenarbeit. Einheitliche Strukturen in den Alarm- und Einsatzplänen erleichtern es der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und den Katastrophenschutzorganisationen mit den einzelnen Krankenhäusern zu agieren. Gemeinsame Alarmierungsserver zum Herbeirufen des dienstfreien Personals sparen Geld. Absprachen bezüglich der Übernahme von Tätigkeiten, zum Beispiel von Materialaufbearbeitungen bei dem Ausfall einer Sterilisationseinheit oder dem Ausfall der Großküche, erzeugen wertvolle Synergien. Gleiches gilt für die frühzeitige Einbindung von zuständigen Behörden in die Alarm- und Einsatzplanung.
Musterpläne
Mittlerweile stellen zahlreiche Behörden und Organisationen Muster für Alarm- und Einsatzpläne zur Verfügung. Diese bieten einen guten Leitfaden für die Erarbeitung eines eigenen Alarm- und Einsatzplans. Ein solcher Musterplan sollte aber tunlichst als das gesehen werden, was er ist: ein Musterplan. Jede Gesundheitseinrichtung hat andere Prozesse, Gebäude- und Personalstrukturen, die einer individuellen Planung bedürfen. Den „Plan aus der Schublade“ gibt es nicht.
Meilwes F: Safety Clip: Der richtige Umgang mit Katastrophenereignissen. Passion Chirurgie. 2018 März, 8(03): Artikel 04_03.
Autoren des Artikels
Martin Meilwes
RisikoberaterGRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbHKlingenbergstr 432758Detmold kontaktierenFrederik Meilwes
Master of Health Business Administration (MHBA)Master in Health and Medical Management (MHMM)Vertriebsleitung/Berater der GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbHEcclesiastraße 1 – 432758Detmold kontaktierenWeitere Artikel zum Thema
01.03.2024 Safety Clip
Safety Clip: Die EU-Medizinprodukte-Verordnung für mehr Patientensicherheit
Der Markt für Medizinprodukte und die damit einhergehenden Anforderungen haben seit 2010 durch einen aufgedeckten Skandal viel Aufmerksamkeit erhalten. Der französische Hersteller Poly Implant Prothèse (PIP) entschied sich unter anderem aus Kostengründen dafür, ein unzulässiges Industriesilikon für seine Brustimplantate zu verwenden.
01.12.2023 Safety Clip
Safety Clip: Die Patientensicherheit fördern mit Ansätzen aus dem „Magnet Recognition Program®“
Das aus dem US-amerikanischen stammende Konzept und Zertifizierungsverfahren „Magnet Recognition Program®“, im Deutschen meist als „Magnetkrankenhaus“ bezeichnet, enthält vielfältige Vorgaben, um Krankenhäuser zu exzellenten Organisationen zu entwickeln.
01.11.2023 Safety Clip
Safety Clip: Von der Wundversorgung zum Wundmanagement
Täglich finden in Praxen, medizinischen Versorgungszentren (MVZ), Ambulanzen und Notaufnahmen von Kliniken Wundversorgungen für Patientinnen und Patienten statt. In der Regel verläuft die primäre Wundheilung problemlos, wie zum Beispiel bei frischen infektionsfreien Verletzungen oder aseptischen Operationswunden. Nach ca. zehn Tagen ist eine primäre Wundheilung komplikationslos abgeschlossen und hinterlässt eine nur minimale Vernarbung.
01.10.2023 Safety Clip
Safety Clip: Morbiditäts und Mortalitätskonferenzen zur Förderung der Sicherheitskultur
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MMK) finden seit Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Der Anteil an MMK in Allgemeinkrankhäusern ist in den letzten acht Jahren deutlich gestiegen.1 Das liegt zum einen daran, dass in der „Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung“ (QM-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Jahr 2016 die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen im Teil B § 1 Satz 6 QM-RL beispielhaft als Instrument des klinischen Risikomanagements aufgeführt werden, zu dessen Einführung die stationären Einrichtungen verpflichtet sind.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.