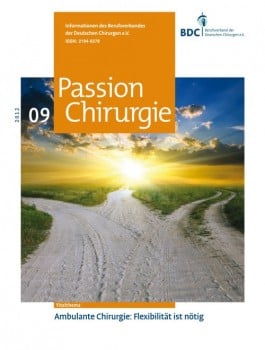Im Juni diesen Jahres hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswesen ein Gutachten zum „Wettbewerb an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung“ vorgelegt. Danach könne ein intensiver zielgerichteter Wettbewerb an den Schnittstellen zwischen den Sektoren zu einer höheren Effizienz führen, erklärte der Vorsitzende Prof. Eberhard Wille.
Insbesondere gebe es ein „noch nicht ausgeschöpfte Potenzial der Substitution von stationären durch ambulante Leistungen“. So sei der Anteil ambulanter Operationen in anderen Ländern deutlich höher als in Deutschland.
Der Rat sieht die Gründe hierfür in unterschiedlichen Qualitätsanforderungen, einer ungleichen Investitionssituation und uneinheitlichne Leistungsbeschreibungen zwischen den Sektoren. Aus unserer chirurgischen Sicht können wir das nur bestätigen. Die Vergütung nach DRG stationär und OPS-basierter EBM-Kategorie ambulant klafft um etwa den Faktor sieben auseinander. Zudem fehlen Richtlinien oder Vereinbarungen, wie ggf. im Falle einer vorzeitigen Entlassung die dann notwendige ambulante Weiterbetreuung finanziert werden soll. Auch die Vergütung für im Krankenhaus durch nicht-angestellte Ärzte vorgenommenen Leistungen ist ungeregelt, obwohl gerade dieser Bereich der sogenannten Honorararzttätigkeit vom Gesetzgeber unmissverständlich freigegeben worden ist.
Der Sachverständigenrat rät allerdings nicht nur zu einer (sinnvollen) einheitlichen Vergütung, sondern auch zu einer Überführung der ambulanten Operationen aus den bisherigen Regelungen der dreiseitigen Verträge nach § 115b SGB V in die neue Systematik der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V. Um eine Mengenausweitung zu verhindern, sollen die Krankenkassen dann Selektivverträge mit Leistungserbringern abschließen können.
Der BDC unterstützt im Einklang mit den Kollegen des BNC die Forderung des Sachverständigenrates nach einem einheitlichen Vergütungssystem. Ein solches System in Anlehnung an das bisherige Fallpauschalen-System der Krankenhäuser macht die rechtliche Abgrenzung zwischen vollstationären Operationen, Ein-Tages-Fällen und ambulanten Eingriffen überflüssig. Damit entfallen auch die ökonomischen Anreize, ambulant mögliche Behandlung in vollstationäre Behandlung zu überführen. Eine zukünftige Vergütung muss für die gleiche Leistung auch gleich sein, unabhängig von der Frage, ob die Behandlung stationär oder ambulant, vom Krankenhaus oder vom Vertragsarzt erbracht wird.
Was schreiben Andere zu diesem Thema?
Dr. med. Ökonomicus im OP?
GKV-Studie: Teil der Mengenentwicklung geht auf das Konto Umsatz
Berlin (opg) – In den Krankenhäusern steigt die Anzahl der Behandlungen und der Schweregrade unaufhaltsam. Nur ein Teil dieser Steigerungsraten lässt sich durch die demographische Entwicklung erklären. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) hat dies im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV) gutachterlich herausgefunden.
Viele Operationen seien nicht medizinischen, sondern ökonomischen Anreizen geschuldet. Demographie allein erklärt Anstieg nicht Nach Analysen der Gutachter um Dr. Boris Augurzky – auch Prof. Stefan Felder, Universität Basel, und Prof. Jürgen Wasem, Universität Duisburg-Essen, gehören dazu – steigt die Leistungsmenge seit Einführung der Fallpauschalen jährlich um ca. drei Prozent. Schon die Begleitforschung zeige, dass weniger als die Hälfte davon auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen ist. Man müsse als Patient aufpassen, dass man nicht unters Messer komme, spitzt Dr. Wulf-Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser des GKV-Spitzenverbandes, vor der Presse am 29. Mai zu. Zu konstatieren sei eine „fast brutal stetige Mengenentwicklung“, die völlig autonom ablaufe und zu einem politischen Problem werde. Es gebe eine Grenze des medizinisch Sinnvollen, insbesondere bei der Endoprothetik oder in letzter Zeit zunehmend bei der Wirbelsäulenchirurgie. Laut RWI-Bericht nahm zwischen 2006 und 2010 die Summe aller Casemixpunkte, d.h. die Summe aller mit dem Schwergrad gewichteten stationären Fälle, um insgesamt 13 Prozent zu. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,1 Prozent. Die durchschnittliche Fallzahl stieg über denselben Zeitraum um 8,1 Prozent bzw. im Durchschnitt um 2,0 Prozent pro Jahr. Selbst wenn man der durchaus umstrittenen These folgen wollte, dass die demographische Änderung zu steigenden Krankenhauseinweisungen führe, würde sie den tatsächlichen Anstieg der stationären Fallzahlen bei weitem nicht erklären können, heißt es in dem Gutachten. Weniger als 40 Prozent des beobachtbaren Anstiegs lasse sich mit der Alterung in Deutschland erklären, hat Augurzky errechnet. Also müsse es andere Faktoren geben: Medizinischer Fortschritt? Angebotsinduzierte Nachfrage? Eine vorhandene Rationierung wurde aufgebrochen?, wirft der Wissenschaftler in den Raum.
Leber: Es muss auch am Preis angesetzt werden.
Es gebe verschiedene, darunter eben auch ökomische Gründe für die Entwicklung. Als eine Ursache geben RWI und Kassenverband an, dass einzelne Behandlungen in den Kliniken immer höher bezahlt werden – und die Krankenhäuser analog dazu die Zahl steigerten. Positiv bewertet der Spitzenverband die Maßnahmen, die von der Politik im Rahmen des Psych-Entgeltgesetzes zur Begrenzung der Mengendynamik verabschiedet werden sollen. Es sollen insbesondere Mehrleistungsabschläge den Anreiz für Krankenhäuser reduzieren, ökonomisch indizierte und medizinisch nicht notwendige Leistungen zu erbringen. Dies sei ein richtiger Ansatz, würde aber auf Dauer das Mengenproblem nicht lösen. Leber fordert aus Sicht des GKV-SV: „Es muss auch am Preis angesetzt werden, wenn man die Menge in den Griff kriegen will.“
Bringt Zertifikatehandel eine Lösung?
Die Krankenkassen und die Kliniken auf Bundesebene – GKV-SV und Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) – sollen im Rahmen eines Forschungsauftrages nachhaltige Lösungen bis Mitte 2013 erarbeiten. Wesentliche Optionen, um die Mengen zu steuern, werden bereits im RWI-Gutachten aufgezeigt. Leber nennt auf der einzelvertraglichen Ebene direkte Verträge, die zwischen Kassen und einzelnen Kliniken möglich sein sollten. Damit unterstützt er das von der AOK lange geforderte Wettbewerbselement. Kollektivvertraglich seien Mengenübertragungen zu prüfen. RWI-Vertreter Augurzky spricht bei diesem für Deutschland neuen Instrument vom Handel mit Zertifikaten, über den die einzelnen Einrichtungen die Berechtigung für die Casemix-Punkte (CMP) erwerben könnten. Dabei würden bei Einführung des Instrumentes die Krankenhäuser im Umfang ihrer erbrachten CMP Zertifikate erhalten, die zur künftigen Abrechnung zum Landesbasisfallwert gegenüber den Kassen berechtigen. Ohne Zertifikate können Leistungen dagegen gar nicht oder nur mit einem hohen Abschlag erbracht werden, heißt es in dem Gutachten. Die Einführung dieses Handels werde dazu führen, „dass Krankenhäuser, die ihre Leistungen ausweiten wollen, Zertifikate von solchen Häusern erwerben, die ihre Leistungen zurückfahren wollen“. Es seien unterschiedliche Modelle denkbar, wie die Ausgabe neuer, zusätzlicher Zertifikate im Zeitablauf organisiert werde – aufgrund des sich ändernden demographisch oder medizinisch bedingt steigenden Behandlungsbedarfs.
Über andere Möglichkeiten der Steuerung müsste man ebenfalls nachdenken, so Leber. Ein weiterer Vorschlag aus dem RWI sieht vor, die Schiedsstellenfähigkeit prospektiver Mehrleistungsvereinbarungen wegfallen zu lassen. Dies bewirke, dass Mengenausweitungen, auf die sich die Krankenhäuser und Krankenkassen nicht ex ante einigen, nur im Rahmen des retrospektiven Mehrerlösausgleichs vergütet werden. Als Nachteil nennen die RWI-Vertreter, dass der Wettbewerb der Krankenhäuser im Vergleich zum Status quo verrringert, in gewissem Maße auch der Anreiz zur Spezialisierung reduziert werde. Eine Gefährdung der Versorgungssicherheit könne vereinzelt nicht ausgeschlossen werden.
DKG spricht von diffamierenden Verdächtigungen
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) reagiert pikiert auf den RWI-Bericht. „Es wundert schon sehr, dass die Krankenkassen vor Ort mit den Krankenhäusern die Leistungen vereinbaren und dann der Bundesverband der Kassen hingeht und alles in Frage stellt“, kommentiert Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Die Vergütungen für die stationären Behandlungen würden jährlich zwischen dem GKV-Spitzenverband und der Deutschen Krankenhausgesellschaft neu vereinbart. „Sollte der Bundesverband der Kassen Erkenntnis haben, dass Fallpauschalen zu hoch vergütet sind, dann hätten wir schon erwartet, dass er dies in den vom Gesetzgeber vorgesehenen Selbstverwaltungsprozess einbringt“, so Baum. Der medizinische Behandlungsbedarf könne nur von den behandelnden Ärzten beurteilt werden. Die pauschale Verdächtigung, die Krankenhäuser würden aus nichtmedizinischen Gründen Patienten operieren, sei diffamierend und dezidiert zurückzuweisen.
Quelle: OPG – Operation Gesundheitswesen, Der gesundheitspolitische Infodienst, Ausgabe 17/2012, 01. Juni 2012