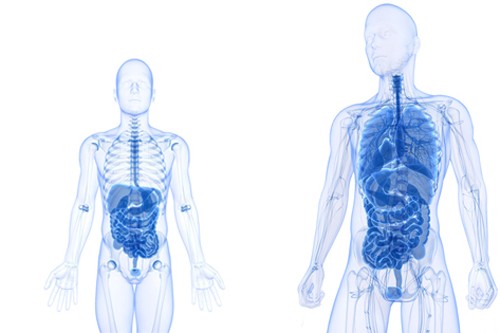Gemeinsame Pressemitteilung der DGCH und des BDC
Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH), sämtliche medizinisch-wissenschaftlichen chirurgischen Fachgesellschaften und der Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC) mit weiteren Berufsverbänden kritisieren das Vorhaben der Ständigen Konferenz „Ärztliche Weiterbildung“ der Bundesärztekammer (BÄK), an einer generalistischen Weiterbildung zum Allgemeinchirurgen festzuhalten. „Die Forderung nach einem eigenständigen Facharzt für Allgemeinchirurgie in der derzeitigen Form kann (…) nur als Rückschritt gewertet werden“, heißt es in einem Schreiben an die Bundes- und Landesärztekammern. Damit würden heute etablierte Qualitätsstandards und die Patientensicherheit gefährdet, warnen die Chirurgen. Auch eine Verkürzung der Weiterbildungszeit um ein Jahr lehnen sie ab.
Wie das Deutsche Krankenhausverzeichnis belegt, halten heute 81 Prozent aller deutschen Kliniken eine Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie eine weitere für Orthopädie und Unfallchirurgie vor. „Damit bilden Krankenhäuser heute in ihrer Organisation den hohen Spezialisierungsgrad in den chirurgischen Fächern ab und entwickeln sich vermehrt in Richtung der auch von der Politik geforderten Zentren“, stellt Professor Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer fest, Generalsekretär der DGCH und Präsident des BDC. Nur in diesen spezialisierten Einheiten sei der einzelne Operateur imstande, die notwendige Expertise für die Behandlung seiner Patienten zu entwickeln. „Ein Chirurg, der einen Darmkrebs exzellent operiert, kann nicht genauso erfahren in der Chirurgie des Gelenkersatzes sein“, betont Meyer.
Die Ständige Kommission „Ärztliche Weiterbildung“ der BÄK sieht dies jedoch anders, wie deren aktuelle Planungen zur anstehenden Novellierung der Musterweiterbildungsordnung im Gebiet Chirurgie zeigen. Sie hält darin an einer Weiterbildung zum Allgemeinchirurgen fest, der dann ohne tiefergehende Spezialisierung eine Vielzahl an Eingriffen vornehmen darf. Damit will das Gremium nicht zuletzt dem sich abzeichnenden Ärztemangel in der Fläche entgegenwirken – ungeachtet der Tatsache, dass aufgrund des medizinischen Fortschritts Spezialisierung und Zentrenbildung seit Jahren auch den klinischen Alltag der kleineren Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung prägen. In Anbetracht dieser Entwicklung hat die gemeinsame Weiterbildungskommission von DGCH, sämtlichen chirurgischen Fachgesellschaften und Berufsverbänden bereits am 8. Oktober 2015 einstimmig entschieden, dass der Facharzt für Allgemeinchirurgie nicht weitergeführt werden sollte.
„Die Zeiten, in denen ein einzelner Chirurg einen Patienten von Kopf bis Fuß angemessen operieren konnte, sind längst vorbei“, erklärt auch Tim Pohlemann, Präsident der DGCH. Aus gutem Grunde habe sich aufgrund der Komplexität operativer Eingriffe eine grundsätzliche Zweiteilung ergeben – zum einen die Konzentration auf die Weichteilchirurgie, die Allgemein- und Viszeralchirurgie, zum anderen der Schwerpunkt Skelett und Knochen, die Unfallchirurgie und Orthopädie. „Diese Entwicklung sollten wir auch in der künftigen Weiterbildung abbilden, um keine Verschlechterung in der operativen Versorgung zu riskieren“, warnt der DGCH-Präsident. Das haben auch die Studierenden erkannt. Die angehenden Mediziner entscheiden in aller Regel frühzeitig in ihrem Praktischen Jahr, in welchem chirurgischen Fach sie sich spezialisieren wollen. Ein späterer Wechsel zwischen den Fächern stellt die Ausnahme dar.
Die DGCH, die chirurgischen Fachgesellschaften und Berufsverbände in der Chirurgie akzeptieren daher diese mehr als rückwärtsgewandte Entwicklung zum Allgemeinchirurgen nicht. „Wir brauchen keine Festschreibung eines real nicht mehr existierenden ‚Pseudo-Generalisten‘ in der Chirurgie“, bemängelt Pohlemann. „Sollten erweiterte Kompetenzen, vertreten durch eine Person, nötig sein, wie beispielsweise in der Einsatzchirurgie der Bundeswehr, können diese auch jetzt schon erfolgreich durch Doppel- und Dreifachqualifikationen erlangt werden“, so der DGCH-Präsident. Ihre Kritik haben die Chirurgen jetzt in einem Schreiben an die Bundes- und Landesärztekammern formuliert. Darin wird auch die geplante Verkürzung der Weiterbildungszeit von derzeit sechs auf fünf Jahre abgelehnt. „Die exakt auf sechs Jahre ausgelegten Weiterbildungsinhalte, immer neue therapeutische Verfahren und die zunehmende Spezialisierung machen gerade in den operativen Fächern häufiges Praktizieren notwendig“, so Meyer. Und das brauche Zeit.
„Die durch die Ständige Kommission ‚Ärztliche Weiterbildung‘ vorbereiteten Beschlussvorlagen für den Ärztetag widersprechen den einstimmig vorgebrachten, begründeten Vorschlägen der Chirurgen, stoßen dort auf völliges Unverständnis und bedrohen die berechtigten Interessen der Patienten nach Qualität und Sicherheit einer flächendeckenden chirurgischen Versorgung in Deutschland“, fasst Pohlemann die Kritik zusammen. Beim Deutschen Ärztetag vom 23. bis 26. Mail 2017 in Freiburg wird über die Novellierung der Musterweiterbildungsordnung entschieden. Die Chirurgen erwarten, dass dort die Empfehlung der großen Gemeinschaft chirurgischer Fachexperten für eine spezialisierte Weiterbildung umgesetzt wird.