Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,
ich möchte Sie herzlich im Namen des Vorstands des BDC|Schleswig-Holstein zu unserem Jahrestreffen am 22.11.2017 einladen.
Nach der Bundestagswahl und dann wohl auch weitestgehend abgeschlossenem Koalitionsvertrag ist es erforderlich zu analysieren, wo es mit dem deutschen Gesundheitssystem unter besonderer Berücksichtigung der Belange unseres chirurgischen Fachgebietes hingeht. Die Einschätzung der gesundheitspolitischen Großwetterlage erfolgt in gewohnt kompetenter Weise durch unseren Vizepräsidenten Dr. Rüggeberg, der den Weg aus Berlin zu uns wieder einmal nicht gescheut hat.
Der zweite Themenblock dreht sich um ein zentrales Thema in der Akutversorgung von Patienten. So erfordert der zunehmende Ansturm von Patienten auf die Notfallambulanzen der Kliniken mit mehr oder minder geringfügigen Beschwerden ein tragfähiges Konzept zur Organisation dieser Patientenströme. Diese Schnittstelle in der intersektoralen Versorgung entwickelt sich zunehmend zu einem Problem was einer dringlichen Lösung bedarf. Spannend ist hierzu der Vorschlag des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, den ich vorstellen werde.
Danach verbleibt dann hoffentlich noch genügend Zeit um weitere berufspolitisch relevante Themen zu diskutieren. Das Spektrum ist breit und reicht von rechtlichen Belangen, Honorar- und Vergütungsfragen, Problemen bei der Organisation der zunehmend geforderten sektorenübergreifenden Versorgung bis hin zur Ausgestaltung der Weiterbildung. Und das gilt für alle Chirurginnen und Chirurgen, egal ob in der Weiterbildung oder als Chefarzt, ob niedergelassen, angestellt oder verbeamtet. Also eigentlich ist für jeden etwas dabei.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und eine rege Diskussion und verbleibe im Namen des gesamten Vorstands mit freundlichen Grüßen
R. W. Schmitz
Vorsitzender
BDC|Schleswig-Holstein
| Jahrestreffen2017 am 22. November 2017 um 19:00 Uhr Haus des Sports in Kiel |






















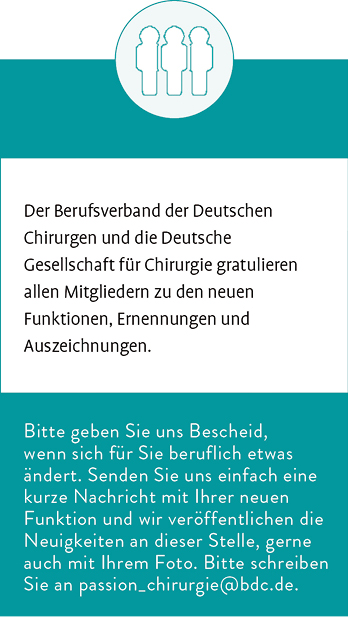 Prof. Dr. med. Hartmut Siebert, ehemaliger Generalsekretär der DGOU und DGU, wurde im März 2017 im Auftrag des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Er wurde damit für sein Engagement und seine Verdienste um das Gemeinwohl ausgezeichnet.
Prof. Dr. med. Hartmut Siebert, ehemaliger Generalsekretär der DGOU und DGU, wurde im März 2017 im Auftrag des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Er wurde damit für sein Engagement und seine Verdienste um das Gemeinwohl ausgezeichnet.





