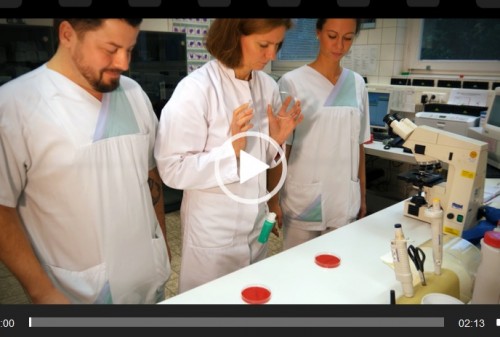Krankenhausstrukturen in Deutschland müssen zentralisiert werden
Bei der Krankenhausplanung in Deutschland ist es schon heute möglich, die Klinikstrukturen qualitätsorientiert zu zentralisieren und zu spezialisieren. Darauf weisen der AOK-Bundesverband und das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) bei der Vorstellung des Krankenhaus-Reports 2018 zum Thema “Bedarf und Bedarfsgerechtigkeit” hin. Das Krankenhaus-Strukturgesetz hat den Bundesländern dafür schon vor zwei Jahren umfangreiche Möglichkeiten eingeräumt. Doch die Länder machen nur zögerlich davon Gebrauch. Deshalb schlägt der AOK-Bundesverband ein gemeinsames Zielbild von Bund und Ländern für das Jahr 2025 vor. “Das Zielbild 2025 sollte festhalten, wo wir mit der stationären Versorgung am Ende der nächsten Legislaturperiode stehen möchten”, so Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. “Dabei geht es nicht vorrangig um die Frage, wie viele Kliniken es am Ende deutschlandweit gibt. Ein deutlicher Schritt wäre es bereits, wenn zukünftig Kliniken mit mehr als 500 Betten nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel in der Krankenhauslandschaft bilden.”
In Nordrhein-Westfalen wird der Wandel in der Krankenhausplanung bereits umgesetzt. Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, sagt dazu: “Bei den Planungen standen bisher oftmals die Bettenzahlen im Fokus. In Zukunft muss mehr die Qualität im Fokus stehen. Für die Patientinnen und Patienten kommt es maßgeblich auf die Ergebnis-Qualität der Leistungen an. Nordrhein-Westfalen will auch hier seinen Beitrag leisten, um diesen Prozess für eine gute Krankenhausversorgung gewinnbringend zu begleiten.”
Aktuelle Analysen des WIdO zeigen unter anderem am Beispiel von Darmkrebsoperationen, dass die Versorgung der Patienten durch eine Zentralisierung deutlich verbessert werden könnte. 2015 sind in Deutschland rund 44.000 Darmkrebsoperationen in mehr als 1.000 Krankenhäusern vorgenommen worden. Doch von allen Kliniken, die diese Operation angeboten haben, führte ein Viertel den Eingriff maximal 17 Mal im Jahr durch, ein weiteres Viertel hatte zwischen 18 und 33 Eingriffe. Unter der Annahme, dass nur noch zertifizierte Zentren bzw. Krankenhäuser, die mindestens 50 Darmkrebsoperationen durchführen, diese Leistung erbringen dürften, blieben bundesweit 385 Kliniken für die operative Versorgung übrig. Auf dieser Grundlage würde sich der mittlere Anfahrtsweg für Patienten bundesweit von acht auf gerade einmal 16 Kilometer verlängern. Im dicht mit Krankenhäusern versorgten Nordrhein-Westfalen (NRW) würde der mittlere Anfahrtsweg von sechs auf lediglich zehn Kilometer steigen. Die höchsten mittleren Fahrwege ergeben sich mit 33 Kilometern in Mecklenburg-Vorpommern. Letztlich wären es nur wenige Regionen in Deutschland, für die bei diesem Szenario etwas längere Wege anfallen. Heute haben 0,03 Prozent der Bevölkerung einen Anfahrtsweg, der länger als 50 Kilometer ist. Dieser Anteil würde sich auf 2,5 Prozent erhöhen.
“Nicht nur bei Krebsoperationen, auch bei anderen planbaren Eingriffen wie Hüftprothesenoperationen und sogar in der Notfallversorgung ist eine stärkere Zentralisierung nötig und möglich, wie die Analysen des WIdO zeigen”, sagt Jürgen Klauber, Mitherausgeber des Krankenhaus-Reports und WIdO-Geschäftsführer. “Wenn sich die Therapiequalität erhöht und Überlebenschancen besser werden, sollten etwas längere Fahrstrecken kein Thema sein. Wir wissen aus Befragungen, dass die Menschen schon jetzt längere Wege in Kauf nehmen, um in guten Krankenhäusern versorgt zu werden.”
Auf die Notwendigkeit einer zentralisierten Krankenhausversorgung weist auch Prof. Dr. Reinhard Busse von der Technischen Universität Berlin hin: “Die Diagnose, dass die mangelnde Konzentration von stationären Fällen zu unnötigen Todesfällen führt, wird von der Politik mittlerweile akzeptiert, auch wenn es mit der Therapie noch hapert.” So wäre es notwendig, Patienten mit Verdacht auf einen Herzinfarkt nur in Krankenhäuser mit einer Herzkathetereinheit einzuliefern und dort zu behandeln. Von den fast 1.400 Krankenhäusern, die Patienten mit Herzinfarkten behandeln, weisen weniger als 600 eine solche Einheit auf. Das gleiche gilt für die Behandlung von Schlaganfällen. Nur gut 500 der 1.300 Kliniken, die Schlaganfälle derzeit behandeln, weisen entsprechende Schlaganfalleinheiten (Stroke Units) auf. Gleichzeitig müsste in beiden Fällen garantiert sein, dass das Krankenhaus rund um die Uhr über entsprechende Fachärzte verfügt. Würden die Neurologen und Kardiologen so auf die Krankenhäuser verteilt werden, dass immer genau ein Facharzt verfügbar ist, würde es für jeweils nur rund 600 Krankenhäuser reichen. Busse: “Die Therapie kann also nicht lauten, jetzt noch die jeweils anderen rund 800 Krankenhäuser mit Schlaganfall- und Herzkathetereinheiten auszustatten.”
Diese Situation betrifft auch die Pflegekräfte, wie der AOK-Bundesverband betont. “Wir haben nicht genügend Personal, um alle heute existierenden Klinikstandorte so auszustatten, dass sinnvolle Personalanhaltszahlen oder Personaluntergrenzen gut umgesetzt werden können. Dieses Personal wird auch nicht kurzfristig auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein, egal ob es 8.000 oder 80.000 sind”, so Martin Litsch. Auch deshalb ist die Zentralisierung der Krankenhausstrukturen sinnvoll. In der Diskussion um eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte drängt die AOK auf mehr Transparenz darüber, welche Gelder der Krankenhausfinanzierung für das Pflegepersonal gedacht sind und ob diese Gelder auch an den richtigen Stellen ankommen. Um dieses Mehr an Transparenz zu erhalten, dürfe das bewährte System der Fallpauschalen jedoch nicht als Ganzes in Frage gestellt werden.
Auf die große Relevanz des medizinischen Personals weist auch Gesundheitsminister Laumann hin: “Wir brauchen sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Versorgung ausreichend gut ausgebildetes Personal im Gesundheitswesen, und zwar im ärztlichen genauso wie im pflegerischen Bereich. Gerade im pflegerischen Bereich muss sich hier noch einiges tun.”
Quelle: AOK-Bundesverband GbR, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin, www.aok-bv.de, 19.03.2018