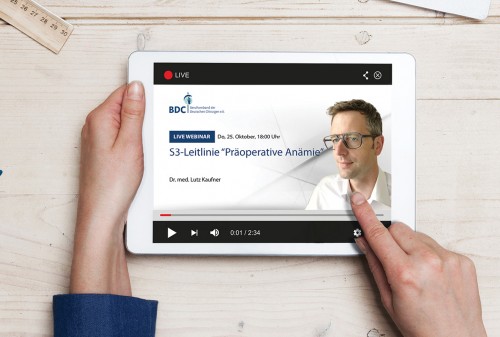Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende
Das Bundeskabinett hat heute dem Entwurf eines “Zweiten Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes – Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO)” zugestimmt.
Das Gesetz ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig und soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 in Kraft treten.
Bundesminister Jens Spahn: “Das Hauptproblem bei der Organspende ist nicht die Spendebereitschaft. Die hat in den vergangenen Jahren sogar zugenommen. Ein entscheidender Schlüssel liegt vielmehr bei den Kliniken. Ihnen fehlen häufig Zeit und Geld, um mögliche Organspender zu identifizieren. Da setzen wir jetzt ganz konkret an. Losgelöst von der grundsätzlichen Debatte zur Widerspruchslösung sollten wir das Gesetz zügig beraten und beschließen. Denn es wird Leben retten. Das sind wir den zehntausend Menschen schuldig, die auf ein Spenderorgan warten.”
Die Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen:
Transplantationsbeauftragte (TxB) bekommen mehr Zeit für ihre Aufgaben
Es wird künftig verbindliche Vorgaben für die Freistellung der Transplantationsbeauftragten geben:
- Die Freistellung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der Intensivbehandlungsbetten in den Entnahmekrankenhäusern für einen definierten Stellenanteil von 0,1 Stellen je 10 Intensivbehandlungsbetten.
- Hat ein Entnahmekrankenhaus mehr als eine Intensivstation, soll für jede dieser Stationen mindestens ein Transplantationsbeauftragter bestellt werden.
- Der Aufwand wird vollständig refinanziert; die korrekte Mittelverwendung durch die Entnahmekrankenhäuser ist nachzuweisen.
Die Rolle der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken wird deutlich gestärkt
- TxBs sind auf den Intensivstationen hinzuzuziehen, wenn Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht kommen;
- sie erhalten Zugangsrecht zu den Intensivstationen;
- den TxBs sind alle erforderlichen Informationen zur Auswertung des Spenderpotentials zur Verfügung zu stellen;
- TxBs sind für die fachspezifische Fort- und Weiterbildung freizustellen; die Kosten dafür trägt die Klinik.
Mehr Geld für die Entnahmekrankenhäuser
- Entnahmekrankenhäuser werden künftig für den gesamten Prozessablauf einer Organspende besser vergütet
- sie erhalten einen Anspruch auf pauschale Abgeltung für die Leistungen, die sie im Rahmen des Organspendeprozesses erbringen;
- Zusätzlich erhalten sie einen Zuschlag als Ausgleich dafür, dass ihre Infrastruktur im Rahmen der Organspende in besonderem Maße in Anspruch genommen wird;
- die Höhe dieses Zuschlags beträgt das Zweifache der berechnungsfähigen Pauschalen.
Kleinere Entnahmekrankenhäuser werden durch qualifizierte Ärzte unterstützt
- Bundesweit bzw. flächendeckend wird ein neurologischer/neurochirurgischer konsiliarärztlicher Rufbereitschaftsdienst eingerichtet.
- Dieser soll gewährleisten, dass jederzeit flächendeckend und regional qualifizierte Ärzte bei der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls zur Verfügung stehen. Damit werden insbesondere die kleineren Entnahmekrankenhäuser unterstützt.
- Die TPG-Auftraggeber (GKV-Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer) werden verpflichtet, bis Ende 2019 eine geeignete Einrichtung mit der Organisation dieses Bereitschaftsdienstes zu beauftragen.
Potentielle Organspender werden besser erkannt und erfasst
- Mit der Einführung eines klinikinternen Qualitätssicherungssystems wird die Grundlage für ein flächendeckendes Berichtssystem bei der Spendererkennung und Spendermeldung geschaffen.
- Dabei sollen die Gründe für eine nicht erfolgte Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls oder eine nicht erfolgte Meldung an die Koordinierungsstelle (DSO) intern erfasst und bewertet werden.
- Die Daten sollen von der Koordinierungsstelle ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen dann den Entnahmekrankenhäusern und den zuständigen Landesbehörden übermittelt und veröffentlicht werden.
Abläufe und Zuständigkeiten müssen klar und nachvollziehbar dokumentiert werden.
- Die Kliniken müssen zukünftig verbindliche Verfahrensanweisungen erarbeiten, mit der die Zuständigkeiten und Handlungsabläufe für den gesamten Prozess einer Organspende festgelegt werden.
Angehörige sollen besser betreut werden
- Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung zur Angehörigenbetreuung wird insbesondere der Austausch von anonymisierten Schreiben zwischen Organempfängern und den nächsten Angehörigen der Organspender klar geregelt. Ein solcher Austausch ist für viele Betroffenen von großer Bedeutung.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Rochusstr. 1, 53123 Bonn, www.bundesgesundheitsministerium.de, 31.10.2018