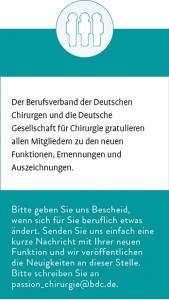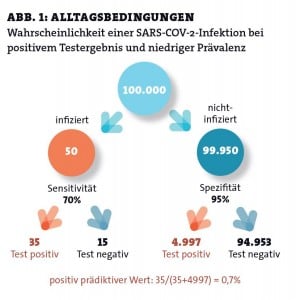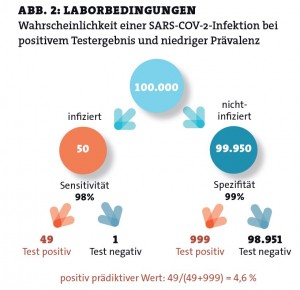Überschüsse bei den Krankenkassen und Defizit beim Gesundheitsfonds
Die 105 gesetzlichen Krankenkassen haben im 1. Halbjahr 2020 einen Einnahmenüberschuss von rund 1,3 Mrd. Euro erzielt. Im 1. Quartal hatten sie noch ein Defizit von 1,3 Mrd. Euro ausgewiesen. Der Gesundheitsfonds verbuchte in den Monaten Januar bis Juni ein Defizit von 7,2 Mrd.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Weil Patienten in der ersten Jahreshälfte weniger zum Arzt und ins Krankenhaus gegangen sind, sind die Ausgaben der Krankenkassen vor allem in den Monaten April bis Juni gesunken. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Wie sich das weitere Jahr entwickelt, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Krankenkassen und den Gesundheitsfonds haben wird, werden wir erst im Herbst einschätzen können.“
Einnahmen der Krankenkassen in Höhe von 129,9 Mrd. Euro standen im 1. Halbjahr Ausgaben von rund 128,6 Mrd. Euro gegenüber. Damit sind die Einnahmen der Krankenkassen, die sie in erster Linie durch vorab festgelegte Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds erhalten, um 4,2 Prozent gestiegen. Die Finanzreserven der Krankenkassen konnten durch den Überschuss bis Ende Juni auf rund 20,8 Mrd. Euro steigen.
Die Ausgaben für Leistungen und Verwaltungskosten verzeichneten bei einem Anstieg der Versichertenzahlen von 0,3 Prozent einen Zuwachs von 2,3 Prozent. Im 1. Quartal hatte der Ausgabenzuwachs noch bei 5,6 Prozent gelegen. Das bedeutet: Die Ausgaben der Krankenkassen sind in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,9 Prozent zurückgegangen. Der durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene Zusatzbeitragssatz liegt weiterhin stabil bei 1,0 Prozent.
Finanzentwicklung nach Krankenkassenarten
Bis auf die Knappschaft Bahn See (KBS), die ein Defizit von rund 50 Mio. Euro erzielte, verbuchten alle Krankenkassenarten Überschüsse: die Ersatzkassen erzielten ein Plus von 908 Mio. Euro, die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) von 320 Mio. Euro, die Betriebskrankenkassen (BKK) von 50 Mio. Euro, die Innungskrankenkassen (IKK) von 46 Mio. Euro und die landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) von 21 Mio. Euro.
Ergebnis des Gesundheitsfonds
Der Gesundheitsfonds, der zum Stichtag 15. Januar 2020 über eine Liquiditätsreserve in einer Größenordnung von rund 10,2 Mrd. Euro verfügte, verzeichnete im 1. Halbjahr 2020 ein Defizit von rund 7,2 Mrd. Euro. Dieses Defizit ist neben saisonalen Effekten maßgeblich auf konjunkturbedingte Mindereinnahmen sowie auf Ausgleichszahlungen an Leistungserbringer zurück zu führen.
Für die Ausgleichszahlungen für freigehaltene Krankenhausbetten sowie zum Ausgleich von Belegungsrückgängen von Vorsorge – und Rehabilitationseinrichtungen, den Ausbau von Intensivbetten, sowie zum Ausgleich von Einkommenseinbußen für Heilmittelerbringer und die Zuschüsse für Sozialdienstleister wurden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds bis Ende Juni insgesamt 7,25 Mrd. Euro ausgezahlt. Davon hat der Bund als Kompensation für die Ausgleichszahlungen aufgrund von Belegungsrückgängen in Krankenhäusern für das 1. Halbjahr rund 5,73 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds zurück überwiesen.
Der Zuwachs der Beitragseinahmen blieb mit lediglich 1,8 Prozent – trotz der Stabilisierung der Sozialversicherungseinnahmen durch die Regelungen beim Kurzarbeitergeld – erheblich hinter den Veränderungsraten der Vorjahre von durchschnittlich deutlich über vier Prozent zurück
Entwicklungen bei den Ausgaben
Bei den Krankenkassen gab es im 1. Halbjahr 2020 einen absoluten Ausgabenzuwachs für Leistungen und Verwaltungskosten von 2,3 Prozent, nachdem der Zuwachs im 1. Quartal noch bei 5,6 Prozent lag.
Die Leistungsausgaben stiegen um 2,2 Prozent, die Verwaltungskosten um 5,8 Prozent. Bei der Interpretation der Daten des 1. Halbjahrs ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Ausgaben in vielen Leistungsbereichen von Schätzungen geprägt sind, da Abrechnungsdaten häufig noch nicht oder nur teilweise vorliegen.
Der Rückgang des Ausgabenanstiegs im 1. Halbjahr ist vor allem auf eine verringerte Inanspruchnahme von Leistungen in verschiedenen Leistungsbereichen im zweiten Quartal zurückzuführen. Er stellt zudem nur eine Momentaufnahme dar, auf dessen Basis keine Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf der Ausgaben gezogen werden sollten.
Ausgabenrückgänge bei Krankenhaus- und Rehabehandlung, Zahnärzten/Zahnersatz und Heilmitteln – hohe Zuwachsraten bei Krankengeld und Arzneimitteln
Als Folge der Corona-Pandemie ist es in einer Reihe von Leistungsbereichen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu Ausgabenrückgängen bei den Krankenkassen gekommen. Der Rückgang bei planbaren Leistungen hat bei den Krankenhausausgaben im 1. Halbjahr zu einem Minus von 2,4 Prozent geführt. Bei Vorsorge- und Reha-Maßnahmen gab es einen Rückgang 15,2 Prozent, bei zahnärztlicher Behandlung von 3,6 Prozent, beim Zahnersatz von 9,0 Prozent und bei Heilmitteln von 1,8 Prozent.
Hohe zweistellige Zuwachsraten gab es hingegen bei den Krankengeldausgaben, die einen zweistelligen Anstieg von 14,2 Prozent verzeichneten. Der Ausgabenzuwachs für Arzneimittel, der im 1. Quartal aufgrund von Mengenentwicklungen und Vorzieheffekte durch Verordnung von Großpackungen noch bei 11,5 Prozent lag, hat sich zwar im 1. Halbjahr auf 7,4 Prozent abgeflacht, ist aber im Vergleich zu den übrigen Leistungsbereichen immer noch deutlich überproportional.
Bei den Ausgabenzuwächsen für ärztliche Behandlung von 4,5 Prozent ist zu berücksichtigen, dass den Krankenkassen für das 1. Halbjahr noch keinerlei Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen vorliegen. Der überproportionale Zuwachs bei Verwaltungskosten der Krankenkassen von 5,8 Prozent ist zum Teil auf eine erhöhte Bildung von Altersrückstellungen bei einigen größeren Krankenkassen zurückzuführen.
Weitere Entwicklung
Mit dem am 17. Juni vom Bundeskabinett beschlossenen Nachtragshaushalt wurde der gesetzlichen Krankenversicherung ein zusätzlicher Bundeszuschuss von 3,5 Mrd. Euro für 2020 zur Verfügung gestellt, der zum 15. Juli dem Gesundheitsfonds zufloss. Damit wird die Einnahmeentwicklung der GKV und die Liquiditätssituation des Gesundheitsfonds in der 2. Jahreshälfte verbessert. Ferner tragen die zusätzlichen Mittel zum Erhalt der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve des Gesundheitsfonds im Jahr 2020 bei.
Die Bundesregierung hat sich in Ihrem Konjunkturprogramm ferner darauf verständigt, dass zur Vermeidung einer Belastung von Arbeitnehmern und Betrieben die Sozialversicherungsabgaben in den Jahren 2020 und 2021 eine Grenze von 40 Prozent der Löhne und Gehälter nicht überschreiten sollen.
In welchem Umfang dafür im Jahr 2021 zusätzliche Bundesmittel in der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung bereitgestellt werden müssen, wird im Herbst zu entscheiden sein.
Zunächst werden BMG und GKV-SV mit den Krankenkassen die aktuelle Entwicklung analysieren und die weiteren Perspektiven zur Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds für dieses und das kommende Jahr erörtern.