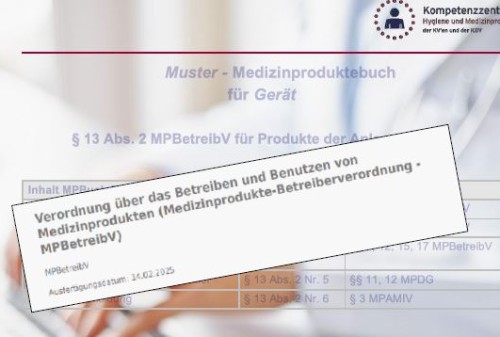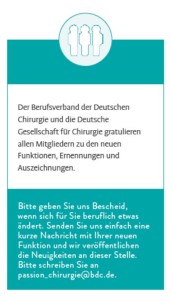Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?
Patienten gesund und glücklich nach erfolgter Therapie nach Hause zu entlassen.
Welche Forschungsrichtung inspiriert Sie?
Robotik und neue technische Innovationen
Welchen klinischen Schwerpunkt haben Sie?
Perspektivisch die Chirurgie des oberen Gastrointestinaltrakts
Welche Publikation der letzten vier Jahre halten Sie für einen Game Changer in Ihrem Fach?
Perioperative Chemotherapy or Preoperative Chemoradiotherapy in Esophageal Cancer – von Hoeppner et al.
Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?
The Wide Wide Sea von Hampton Sides
Mit welchem Song wachen Sie in der Früh am liebsten auf?
Das kommt ganz darauf an, was mein 20 Jahre alter Radiowecker um 05:30 Uhr spielt.
Was war für Ihr berufliches Fortkommen besonders hilfreich?
Mein Forschungsjahr in Portland, OR (USA) 2019 im Bereich der Chirurgie des oberen Gastrointestinaltrakts.
Was war Ihre größte Inspiration?
Meine Mentoren sowohl im Bereich der Forschung als auch der klinischen Ausbildung – bis heute.
Welches Forschungsthema bearbeiten Sie?
Die Implementierung der Robotik insbesondere unter den Aspekten Sicherstellung der Patientensicherheit und Schaffung eines ergonomischen Arbeitsplatzes für Chirurg:innen.
Was haben Sie erst vor kurzem in Ihre chirurgische Praxis implementiert?
Eine ergonomische Arbeitsweise insbesondere im robotischen Operationssaal.
Welche persönlichen Visionen möchten Sie gerne umsetzen?
Flexibilität in der Chirurgie – vor allem Konzepte, die Forschung und Klinik kombinieren.
In der Krankenhauspolitik gibt es viele Baustellen. Was sollte als Erstes angepackt werden?
Den Erhalt einer strukturierten Weiterbildung im Hinblick auf die Mindestmengen.
Wann platzt Ihnen der Kragen?
Bei Gleichgültigkeit.
Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Mit der Deutschen Bahn pünktlich anzukommen.
Wie gehen Sie mit Frustrationen um?
Kurz aufregen – dann schnell eine Lösung finden.
Ihr wichtigstes Hobby?
Mein kleiner Gemüsegarten auf meinem Balkon und kreatives Geschenkebasteln.
Wo werden Sie schwach?
Bei Ziegen – absolute Empfehlung: Probieren Sie Ziegen-Yoga aus!
Was bringt Sie zum Lachen?
Situationskomik
Was gehört für Sie zu einem gelungenen Tag?
Ein guter Kaffee
Wie gehen Sie mit fehlender Teamfähigkeit bei einer/m Mitarbeiter:in um?
Klare Strukturen schaffen sowie eine faire und offene Kommunikation der Aufgabenverteilung und Pflichten.
Wie fördern Sie die persönliche und fachliche Entwicklung in Ihrem Team?
Besprechen der persönlichen und fachlichen Ziele und planen der nächsten konkreten Schritte, um diese zu erreichen.
Muss eine Chirurgin/ein Chirurg Optimismus ausstrahlen?
Nein, ich denke das ist jedem selbst überlassen – ich persönlich bin absolute Optimistin.
|
Dr. med. Dolores Thea Krauss
Ärztin in Weiterbildung der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie der Uniklinik Köln
Assistentensprecherin, Consultant des EAES Technology Robotic Committee
Mitglied im Organisationskomitee
Verheiratet, 2 Ragdoll Katzen
|
Die Fragen stellte Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Schmitz-Rixen.