Nach der Verabschiedung des eHealth-Gesetzes durch den Bundestag will die KBV die digitale Vernetzung im Gesundheitswesen weiter vorantreiben. „Wir brauchen endlich mehr sinnvolle Anwendungen, die Ärzten und Patienten nützen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Gassen.
Das vor einer Woche beschlossene Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen (eHealth-Gesetz) zielt darauf ab, Praxen, Krankenhäuser, Apotheken und weitere Akteure in der Gesundheitsversorgung besser miteinander zu vernetzen und Patientendaten schneller digital überprüfbar zu machen. Es enthält ein Bündel von Vorgaben, Fristen, Anreizen und Sanktionen.
Medikationsplan und eArztbrief
Ab Oktober 2016 zum Beispiel haben Patienten, die mindestens drei Medikamente einnehmen, Anspruch auf einen Medikationsplan in Papierform, ab 2018 elektronisch. Die Übersendung elektronischer Arztbriefe, die jetzt schon via KV-Connect erfolgt, wird ab Januar 2017 für ein Jahr finanziell gefördert. Ab 2018 soll es technisch möglich sein, dass auf Wunsch des Patienten wichtige Notfalldaten auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespeichert werden, zum Beispiel zu Allergien oder Arzneimittelunverträglichkeiten.
Kritik am Versichertenstammdaten-Management
„Dass der Gesetzgeber die elektronische Vernetzung fördert und Fristen setzt, ist grundsätzlich gut und richtig. Nur völlig unverständlich ist, warum unbeliebte bürokratische Anwendungen, die noch nicht lauffähig sind, durchgedrückt, sinnvolle und gewünschte medizinische Anwendungen verschoben oder gar gestrichen werden“, sagte Gassen.
Hintergrund für seine Kritik ist, dass das Versichertenstammdaten-Management als erste Online-Anwendung auf der eGK zum 1. Juli 2016 starten soll, obwohl die Industrie die Technik noch nicht liefern kann. Der fertige elektronische Arztbrief hingegen wird jetzt erst ab 2017 und dann auch nur für ein Jahr gefördert. Ursprünglich sollten die Krankenkassen bereits ab Januar 2016 für zwei Jahre zusätzliche Mittel bereitstellen. Die Förderung des eEntlassbriefes wurde komplett gestrichen.
„Dieser Zickzackkurs des Bundesgesundheitsministeriums ist mehr als unverständlich, zumal die Technik für den elektronischen Versand von Briefen fertig und gewünscht ist“, sagte Gassen. Er wies darauf hin, dass Ärzte und Psychotherapeuten bereits jetzt über das Sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen eArztbriefe verschicken und empfangen könnten. Auch andere Anwendungen könnten darüber genutzt werden.
Vertreterversammlung kritisiert Sanktionen
Die Vertreterversammlung der KBV hatte in ihrer öffentlichen Sitzung am vergangenen Freitag die Vorgaben des Gesetzgebers zur Einführung des Versichertenstammdaten-Managements scharf kritisiert. In einem mit großer Mehrheit angenommenen Beschlussantrag monierten die Delegierten vor allem die finanziellen Sanktionen im Verzögerungsfall, die gelten sollen, „ohne dass zuvor die verbindlichen und offiziell ausgeschriebenen Tests in 1.000 Praxen plus Kliniken erfolgreich durchgeführt und wissenschaftlich evaluiert werden können“.
Das eHealth-Gesetz in Kürze
Die folgende Übersicht listet wesentliche Punkte des eHealth-Gesetzes auf.
Elektronischer Arztbrief
1. Januar bis 31. Dezember 2017: Förderung des eArztbriefes
Ärzte und Psychotherapeuten können bereits jetzt schon elektronische Arztbriefe im Sicheren Netz via KV-Connect versenden, empfangen und abrechnen. Ab 1. Januar 2017 erhalten sie für den Versand und Empfang eine Pauschale von insgesamt 55 Cent für jeden elektronisch übermittelten Brief, wenn dessen Übertragung sicher erfolgt und der Papierversand entfällt. Voraussetzung ist hierbei auch, dass die Briefe mit dem elektronischen Heilberufsausweis signiert sind. Der Ausweis wird über die Landesärztekammern ausgegeben.
Die Förderung läuft bis 31. Dezember 2017. Die Vergütung erfolgt dabei nicht wie bisher aus der begrenzten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV), sondern extrabudgetär. Die Kosten, die für den Papierversand entfallen, sind bei der jährlichen Anpassung der MGV zu berücksichtigen. Details zur Abrechnung und zur Aufteilung der Pauschale zwischen Sender und Empfänger legt die KBV in einer Richtlinie fest.
Medikationsplan
Ab 1. Oktober 2016: Medikationsplan in Papierform
Ab 1. Januar 2018: Medikationsplan in elektronischer Form
Patienten, denen mindestens drei Medikamente gleichzeitig verordnet werden, haben ab 1. Oktober 2016 Anspruch auf die Erstellung sowie Aktualisierung eines Medikationsplans in Papierform durch die behandelnden Ärzte. Die Ärzte erhalten dafür eine Vergütung. Auch Apotheker sind verpflichtet, auf Wunsch der Versicherten den Medikationsplan zu aktualisieren. Der Medikationsplan soll ab 2018 auch elektronisch verfügbar sein.
Notfalldatenmanagement
Ab 1. Januar 2018: Anlage und Pflege des Notfalldatensatzes wird vergütet
Für schnelles Handeln bei einem Notfall sollen Ärzte ab 2018 wichtige notfallrelevante medizinische Informationen zu Allergien, Vorerkrankungen oder zu Implantaten direkt von der eGK abrufen können. Die Anlage und Pflege dieser Datensätze werden den Ärzten ab dem 1. Januar 2018 vergütet. Der Patient muss der Speicherung der Daten zustimmen.
Elektronische Patientenakte
Start ab 2019
Die gematik soll die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass ab 2019 Patientendaten aus bereits vorhandenen Dokumentationen in einer sektorübergreifenden elektronischen Patientenakte bereitgestellt werden können. Dazu zählen beispielsweise Befunde, Arztbriefe, Medikationsplan sowie medizinische Dokumente wie Impfpass oder Mutterpass, die durch den Patienten den jeweiligen Behandelnden zur Verfügung gestellt werden können.
Elektronisches Patientenfach
Start ab 2019
Das elektronische Patientenfach ist eine Anwendung auf der eGK, die es dem Patienten ermöglichen soll, selbst Daten in einem Onlinefach zu speichern und auch außerhalb der Arztpraxis eigenständig einzusehen, beispielsweise selbstgemessene Blutzucker- oder Blutdruckwerte. Die Daten aus der elektronischen Patientenakte sollen auf Wunsch des Patienten auch in sein Patientenfach aufgenommen werden können. Jeder Patient kann individuell entscheiden, ob er das Patientenfach nutzen möchte.
Telemedizinische Anwendungen
Ab 1. April 2017: Vergütung von telemedizinischen Röntgenkonsilen
Ab 1. Juli 2017: Finanzielle Förderung von Videosprechstunden
Ab 1. April 2017 werden Telekonsile bei der Befundbeurteilung von Röntgenaufnahmen vergütet. Darüber hinaus werden ab 1. Juli 2017 auch Online-Videosprechstunden finanziell gefördert: Hierbei geht es um eine telemedizinisch gestützte Betreuung von Patienten, mit der die ansonsten wiederholte persönliche Vorstellung in der Arztpraxis ersetzt werden kann, beispielsweise bei Verlaufskontrollen.
Versichertenstammdaten-Management
Ab 1. Juli 2018: Ärzte sind zur Prüfung der Versichertenstammdaten verpflichtet
Laut Gesetz soll die Telematikinfrastruktur bis Mitte 2016 soweit zur Verfügung stehen, dass die erste Online-Anwendung der Gesundheitskarte – das Versichertenstammdaten-Management – bundesweit möglich ist. Ärzte sind dann nach einer Übergangsfrist spätestens ab dem 1. Juli 2018 zur Onlineprüfung und -aktualisierung der Versichertenstammdaten gesetzlich verpflichtet. Praxen, die diese Aufgabe nicht erledigen, drohen Honorarkürzungen von einem Prozent.
Praxisverwaltungssystem
Ärzte und Psychotherapeuten sollen künftig den Anbieter ihres Praxisverwaltungssystems (PVS) leichter wechseln können. Die KBV wurde beauftragt, die Schnittstellen zur systemneutralen Archivierung sowie zur Übertragung von Patientendaten bei einem Systemwechsel zu definieren. Der Gesetzgeber verbindet damit das Ziel, dass PVS-Systeme austauschbar werden und Ärzte damit leichter von PVS „A“ zu PVS „B“ wechseln können.
eHealth-Gesetz
Das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen (eHealth-Gesetz) soll die Einführung einer digitalen Informations- und Kommunikationsstruktur im Gesundheitswesen vorantreiben.
Ziel ist es, Informations- und Kommunikationstechnologie in der sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung zu etablieren und dadurch die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung weiter zu verbessern: Zukünftig sollen alle Akteure des Gesundheitssystems durch eine Telematikinfrastruktur (TI) miteinander vernetzt sein. Anwendungsmöglichkeiten der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) oder der Telemedizin sollen weiter ausgebaut werden.
Die Einführung und Weiterentwicklung der TI und der eGK ist Aufgabe der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH, kurz gematik. Gesellschafter der gematik sind mit jeweils 50 Prozent die Verbände von Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern und Apotheken sowie die Krankenkassen.
Das Sichere Netz für Ärzte und Psychotherapeuten, das KBV und KVen bereitstellen, steht bereits jetzt mit vielen Diensten zur Online-Kommunikation bereit. Es soll später an die TI angeschlossen werden. Damit werden alle Dienste weiterhin nutzbar sein.











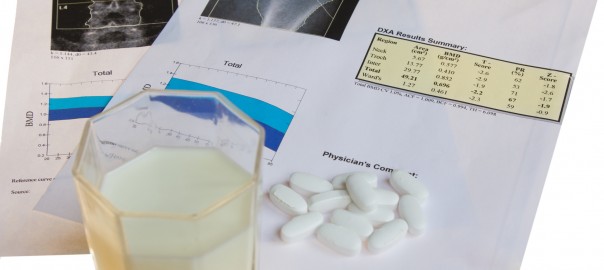





 unda Leschber erhält die Medaille, weil sie sich frühzeitig für die Belange der Frauen in der Chirurgie eingesetzt hat, was später zur Einrichtung eines speziellen Referates geführt hat. Umso bedeutender ist es, dass sie als erste Frau mit der Müller-Osten-Medaille ausgezeichnet wird. Leschber war ebenfalls maßgeblich beteiligt am Aufbau einer Kinderbetreuung während chirurgischer Kongressveranstaltungen. Unabhängig davon war sie stets eine kritische Ratgeberin für den Vorstand im Besonderen in Bezug auf Zukunftsfragen unseres Berufs. Ihre Berufung in die Führung europäischer und internationaler Gremien und Dachorganisationen hat mittelbar auch dem BDC eine erhöhte Aufmerksamkeit beschert.
unda Leschber erhält die Medaille, weil sie sich frühzeitig für die Belange der Frauen in der Chirurgie eingesetzt hat, was später zur Einrichtung eines speziellen Referates geführt hat. Umso bedeutender ist es, dass sie als erste Frau mit der Müller-Osten-Medaille ausgezeichnet wird. Leschber war ebenfalls maßgeblich beteiligt am Aufbau einer Kinderbetreuung während chirurgischer Kongressveranstaltungen. Unabhängig davon war sie stets eine kritische Ratgeberin für den Vorstand im Besonderen in Bezug auf Zukunftsfragen unseres Berufs. Ihre Berufung in die Führung europäischer und internationaler Gremien und Dachorganisationen hat mittelbar auch dem BDC eine erhöhte Aufmerksamkeit beschert. ür sein langjähriges Engagement beim BDC erhält Jörg Ansorg die Wolfgang-Müller-Osten-Medaille. Er hat die positive Entwicklung des BDC seit 2002 maßgeblich geprägt. Durch seinen persönlichen Einsatz hat Ansorg den Berufsverband besonders im Bereich der Nachwuchsförderung und der flächendeckenden Aus-, Weiter- und Fortbildung stark gemacht. Die mittlerweile seit Jahren erfolgreich etablierte BDC|Akademie wurde entscheidend durch seine Arbeit gestaltet. Als ehemaliger Geschäftsführer des BDC hat Jörg Ansorg in den vergangenen Jahren viele Projekte initiiert und umgesetzt, die den BDC insgesamt gestärkt haben.
ür sein langjähriges Engagement beim BDC erhält Jörg Ansorg die Wolfgang-Müller-Osten-Medaille. Er hat die positive Entwicklung des BDC seit 2002 maßgeblich geprägt. Durch seinen persönlichen Einsatz hat Ansorg den Berufsverband besonders im Bereich der Nachwuchsförderung und der flächendeckenden Aus-, Weiter- und Fortbildung stark gemacht. Die mittlerweile seit Jahren erfolgreich etablierte BDC|Akademie wurde entscheidend durch seine Arbeit gestaltet. Als ehemaliger Geschäftsführer des BDC hat Jörg Ansorg in den vergangenen Jahren viele Projekte initiiert und umgesetzt, die den BDC insgesamt gestärkt haben.





