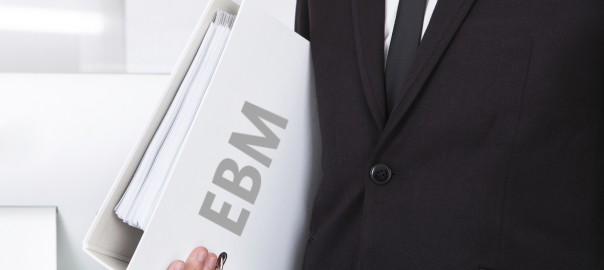Crusius: “Ärzte machen Fehler, sie sind aber keine Pfuscher”
“Überall wo Menschen arbeiten, passieren Fehler – auch in der Medizin. Wir gehen aber offen mit unseren Fehlern um, wir lernen aus Ihnen und wir verhelfen betroffenen Patienten zu ihrem Recht.” Das sagte Dr. Andreas Crusius, Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer, bei der Vorstellung der Behandlungsfehlerstatistik für das Jahr 2015 in Berlin.
Crusius forderte, Ärztinnen und Ärzte bei ihrem Engagement für eine offene Fehlerkultur zu unterstützen. “Wir müssen wegkommen von Pauschalvorwürfen. Und ein Arzt, dem ein Fehler unterläuft, ist kein Pfuscher. Fehler können viele Ursachen haben. Pfusch dagegen beinhaltet immer eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Auswirkungen des eigenen Handelns.”
In diesem Zusammenhang wandte sich Crusius gegen immer wieder kolportierte Hochrechnungen zu Behandlungsfehlern. “Das sind Schätzungen auf Grundlage US-amerikanischer Uraltstudien, die keinerlei Bezug zu unserem Gesundheitssystem haben. Die Daten der Ärztekammern dagegen sind absolut valide, weil sie auf realen Fällen beruhen. Auch wenn sie nicht das gesamte Behandlungsgeschehen abdecken, kann man mit ihnen arbeiten und wirksam Fehlerprävention betreiben.”
Crusius betonte, dass die Ursachen für Behandlungsfehler komplex sein können. Ein Grund sei der stetig wachsende Behandlungsdruck in Kliniken und Praxen. So hat sich die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle zwischen den Jahren 2004 und 2014 um 152 Millionen auf 688 Millionen Fälle erhöht. Im stationären Sektor wurden 2014 mehr als 19 Millionen Patienten behandelt. “Da nützt es wenig, dass die Politik eine Qualitätsoffensive für das Gesundheitswesen ausgerufen hat. Qualität hat ihren Preis und deshalb brauchen wir auch eine ausreichende Finanzierung der Personalkosten.”
Wie Kerstin Kols, Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern, berichtete, liegt die Zahl der festgestellten Fehler gemessen an der Gesamtzahl der Behandlungsfälle im Promillebereich. Die Zahl der Sachentscheidungen sowie die Zahl der festgestellten Fehler sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.
So haben die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen im Jahr 2015 bundesweit insgesamt 7.215 Entscheidungen zu mutmaßlichen Behandlungsfehlern getroffen (Vorjahr 7.751). Es lag in 2.132 Fällen ein Behandlungsfehler vor (Vorjahr 2.252). Davon wurde in 1.774 Fällen ein Behandlungsfehler/Risikoaufklärungsmangel als Ursache für einen Gesundheitsschaden ermittelt, der einen Anspruch des Patienten auf Entschädigung begründete. Die häufigsten Diagnosen, die zu Behandlungsfehlervorwürfen führten, waren Knie- und Hüftgelenkarthrosen sowie Unterschenkel- und Sprunggelenkfrakturen. In 358 Fällen lag ein Behandlungsfehler / Risikoaufklärungsmangel vor, der jedoch keinen kausalen Gesundheitsschaden zur Folge hatte.
“Auch wenn selten etwas passiert, ist jeder Fehler einer zu viel”, betonte Priv. Doz. Dr. Peter Hinz, leitender Oberarzt an der Klinik für Unfall-, Wiederherstellungschirurgie und Rehabilitative Medizin der Universitätsmedizin Greifswald. Er erläuterte, wie das Thema Patientensicherheit und Qualitätssicherung im ärztlichen Alltag gelebt wird. Darüber hinaus verwies er auf die vielfältigen Initiativen und Projekte der Ärzteschaft zur Förderung der Patientensicherheit und Qualitätssicherung.
Allein die Datenbank ärztlicher Qualitätssicherungsinitiativen der Bundesärztekammer führt rund 160 absolut freiwillige Initiativen auf. Für den ambulanten Sektor führt der Qualitätsbericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung rund 9.000 Qualitätszirkel mit mehr als 35.000 teilnehmenden Ärzten und psychologischen Psychotherapeuten auf.
Als vorbildliches Projekt zur Vermeidung von Behandlungsfehlern wurde auch auf das vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin betriebene Fehlerlernsystem “CIRSmedical” hingewiesen. Über das System können Ärzte Beinahefehler anonym melden, damit potentielle Risiken abgestellt werden können.
Dr. Walter Schaffartzik, Ärztlicher Leiter des Unfallkrankenhauses Berlin und Ärztlicher Vorsitzender der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern, forderte betroffene Patienten auf, sich im Schadensfall an die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern zu wenden. “An unseren Stellen sind hochqualifizierte Fachgutachter tätig, die gemeinsam mit Juristen prüfen, ob ein Behandlungsfehlervorwurf gerechtfertigt ist, oder nicht. Es genügt ein formloser Antrag und das Gutachten sowie die abschließende Bewertung ist für Patienten kostenfrei.”
In rund 90 Prozent der Fälle werden die Entscheidungen der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen von beiden Parteien akzeptiert und die Streitigkeiten beigelegt. Wird nach Begutachtung durch diese Institutionen doch noch der Rechtsweg beschritten, werden die Entscheidungen der Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen überwiegend bestätigt.