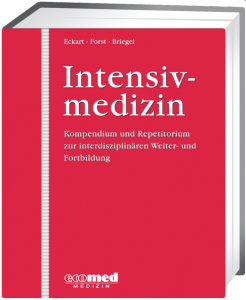Medizinischer Versorgungsbedarf steigt schneller als die Zahl der Ärzte
„Die Zahl der Ärzte steigt, aber der Bedarf steigt schneller.“ So fasste Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), die Ergebnisse der Ärztestatistik für das Jahr 2015 zusammen. Wie aus den Daten der BÄK hervorgeht, erhöhte sich die Zahl der bei den Landesärztekammern gemeldeten ärztlich tätigen Mediziner im vergangenen Jahr nur leicht um 1,7 Prozent. Das bedeutet einen Anstieg um 6.055 Ärzte auf nunmehr 371.302 bundesweit. Davon arbeiteten 189.622 im Krankenhaus (+ 1,8 Prozent).
Ambulant tätig waren 150.106 Ärzte (+ 1,5 Prozent). Gleichzeitig stieg die Zahl der Behandlungsfälle kontinuierlich an, und ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. Zwischen 2004 und 2014 erhöhte sich die Zahl der ambulanten Behandlungen in Deutschland um 152 Millionen. Ähnlich sieht es in den Krankenhäusern aus. Die Unternehmensberatung Deloitte prognostiziert bis zum Jahr 2030 eine Zunahme der Fallzahlen im stationären Bereich um mehr als zwölf Prozent. Verantwortlich dafür ist vor allem der steigende Behandlungsbedarf einer alternden Gesellschaft. Im Jahr 2015 betrug der Anteil der über 60-Jährigen Patienten in den Krankenhäusern 51,5 Prozent. Bis zum Jahr 2030 erwarten die Experten von Deloitte einen Anstieg auf 60,8 Prozent.
„Wenn wir jetzt nicht entschieden gegensteuern, steht die medizinische Versorgung in Zukunft vor immensen Problemen“, warnte Montgomery. Daher müsse die Zahl der Studienplätze bundesweit um mindestens zehn Prozent erhöht werden. „Noch im Jahr 1990 gab es in den alten Bundesländern 12.000 Plätze im Studiengang Humanmedizin. Heute sind es gerade noch 10.000, obwohl durch die Wiedervereinigung acht medizinische Fakultäten hinzugekommen sind“, so der Ärztepräsident. Er forderte die Bundesregierung auf, im Zuge ihres Masterplans Medizinstudium 2020 auch die Auswahlverfahren an den Universitäten zu reformieren: „Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen ausgewählt werden, die hinterher auch in der Versorgung der Bevölkerung arbeiten wollen.“ Neben der Abiturnote müssten daher Faktoren wie psychosoziale Kompetenzen, soziales Engagement und einschlägige Berufserfahrung stärker berücksichtigt werden. Um den Ärztemangel im hausärztlichen Bereich zu mildern, sollten Medizinstudierende gleich zu Beginn des Studiums an die Allgemeinmedizin herangeführt werden. Montgomery sprach sich dafür aus, bis 2017 an allen medizinischen Fakultäten in Deutschland Lehrstühle für Allgemeinmedizin einzuführen.
Nicht nur die Gesellschaft insgesamt altert, sondern mit ihr auch die Ärzteschaft. Zwar stieg im Jahr 2015 der Anteil der unter 35-Jährigen Ärzte um 0,2 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent. Dem steht aber bei den über 59-Jährigen ein Zuwachs auf 17,3 Prozent gegenüber (Vorjahr: 16,4 Prozent). Weiterhin ist der Anteil der 40- bis 49-Jährigen von 25,2 Prozent auf 24,1 Prozent zurückgegangen, während der Anteil der 50-bis 59-Jährigen von 28,5 Prozent auf 28,6 Prozent anstieg. Damit gibt es viel mehr 50- bis 59-Jährige als 40- bis 49-Jährige Ärzte.
Zudem verschieben sich bei den Jungmedizinern die persönlichen Prioritäten. „Es wächst eine sehr selbstbewusste Ärztegeneration nach. Sie ist verständlicherweise nicht mehr bereit, Versorgungslücken bedingungslos auf Kosten der eigenen Lebensplanung zu schließen“, so Montgomery. Wie Umfragen zeigen, räumen die angehenden Mediziner der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die höchste Priorität ein. Knapp dahinter folgt der Wunsch nach geregelten und flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten – noch vor guten Verdienstmöglichkeiten.
Dementsprechend entscheiden sich immer mehr Ärzte gegen eine Vollzeitstelle. Betrug der Anteil der Teilzeitärzte an allen niedergelassenen Ärzten im Jahr 2009 noch fünf Prozent, so waren es im Jahr 2013 bereits 13,6 Prozent. Einer Studie des Forschungsinstituts Prognos zufolge sank die tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit der Ärzte in den Praxen von durchschnittlich 42,6 Stunden im Jahr 2011 auf 40,2 Stunden im Jahr 2014. Bei den Krankenhausärzten ging die Zahl der geleisteten Wochenstunden zwischen den Jahren 1991 und 2013 von 37,6 auf 29,8 Stunden zurück.
„Gerade im Hinblick auf die Patientensicherheit müssen Bund und Länder daher in den Krankenhäusern für eine ausreichende Personalausstattung und Personalfinanzierung sorgen“, forderte Montgomery. Notwendig seien darüber hinaus Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, zur Reduktion der Arbeitsverdichtung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gleichzeitig ging die Zahl der Ärzte mit eigener Praxis im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent zurück. Dagegen stieg die Anzahl der im ambulanten Bereich angestellten Ärzte um 3.066 auf 29.373. Dies entspricht einem Plus von 11,7 Prozent. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die exzellente Arbeitsmarktsituation. So liegt die Arbeitslosenquote in Bezug zu der Zahl der berufstätigen Ärzte bei 1,0 Prozent. „Auf dem Arbeitsmarkt für Ärzte herrscht Vollbeschäftigung. Das ist eine gute Nachricht für unsere Ärztinnen und Ärzte. Problematisch ist aber, dass schon jetzt viele offene Stellen nicht besetzt werden können“, erklärte der BÄK-Präsident.
Daran ändert auch die Zuwanderung von 3.560 Ärzten aus dem Ausland nur wenig (+7,4 Prozent), zumal im selben Zeitraum 2.143 Ärzte aus Deutschland abgewandert sind.
Insgesamt waren im Vorjahr 42.604 ausländische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland gemeldet. In den Krankenhäusern stieg der Anteil der Ärzte aus dem Ausland um 9,2 Prozent (2014: 11,6 Prozent). Der Anteil der Ausländer an den Erstmeldungen bei den Ärztekammern betrug im vergangenen Jahr 31,1 Prozent.
Die stärksten Zuwächse verzeichneten mit 1.421 die Ärztinnen und Ärzte aus den europäischen Staaten und aus Asien mit 1.079. Der größte Zustrom konnte aus Syrien (+ 493) verbucht werden, es folgen Serbien (+ 206), Rumänien (+ 205), Russland (+ 159), Bulgarien (+ 127) und Ägypten (+ 125). Einen größeren Rückgang gab im Jahr 2015 lediglich bei Ärzten aus Österreich (- 122).
Die größte Zahl ausländischer Ärzte kommt aus Rumänien (4.062), Griechenland (3.017) und Österreich (2.573), gefolgt von Syrien (2.149).
Quelle: Bundesärztekammer Stabsbereich Politik und Kommunikation Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin, www.baek.de , 12.04.2016