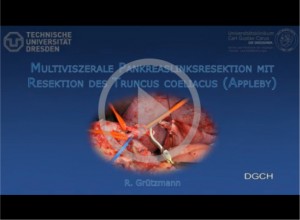Eine bessere Sicherheitskultur in deutschen Gesundheitseinrichtungen zu schaffen – das ist zentrales Ziel des Aktionsbündnisses Patientensicherheit e. V. (APS). Um sie weiter voran zu treiben, vergibt das Bündnis im Jahr 2017 zum vierten Mal den Deutschen Preis für Patientensicherheit. Die mit insgesamt 19 500 Euro dotierte Auszeichnung prämiert Best-Practice-Beispiele für mehr Patientensicherheit in Kliniken, Praxen, Pflegediensten, Apotheken sowie bei Healthcare-Anbietern, Verbänden, Gesundheitsämtern und Krankenkassen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. November 2016. Den Preis schreibt das Aktionsbündnis Patientensicherheit zusammen mit der Aesculap Akademie, der Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, der MSD SHARP & DOHME GMBH und dem Georg Thieme Verlag aus.
„Wir möchten mit dem Deutschen Preis für Patientensicherheit ein Zeichen für mehr Behandlungssicherheit setzen“, so Hedwig François-Kettner, die 1. Vorsitzende des APS. „Anhand von wirksamen Lösungsansätzen – beispielsweise aus dem Praxis- und Klinikalltag – können Gesundheitsinstitutionen zeigen, wie Fehler vermieden werden können.“ Die prämierten Maßnahmen sollen anderen Einrichtungen als Inspiration und Vorbild dienen. Neben der Patientensicherheit steht auch das Risikomanagement im Mittelpunkt: Zu diesen Themen werden nachhaltige Best-Practice-Beispiele und praxisrelevante Forschungsarbeiten gesucht. Dazu gehören etwa Methoden zur Verbesserung der Arzneimittel-therapiesicherheit, zielgerichtete Aus-, Fort- und Weiterbildungen für medizinische Berufsgruppen, Ideen zur Optimierung der Infrastruktur und Ablauforganisation sowie Modelle für eine patientenfokussierte Kommunikation. „Die teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen sind eingeladen, ihr ganzes Spektrum rund um Patientensicherheit einzubringen“, betont François-Kettner.
Der erste Platz ist mit 10 000 Euro, der zweite mit 6000 Euro und der dritte Platz mit 3500 Euro dotiert. Das APS verleiht den Deutschen Preis für Patientensicherheit auf seiner 12. Jahrestagung, die vom 4. bis 5. Mai 2017 in Berlin stattfindet. Wer Preisträger wird, entscheidet eine fachkundige Jury aus Pflege, Ärzteschaft, Apotheke, Selbsthilfe, Kostenträger und Patientensicher-heitsforschung gemeinsam mit Vertretern der Initiatoren. Einsendeschluss ist der 15. November 2016. Hinweise zur Bewerbung finden Sie hier.
Über das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V.:
Vertreter der Gesundheitsberufe, ihrer Verbände, der Patientenorganisationen sowie aus Industrie und Wirtschaft haben sich im Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Plattform zur Verbesserung der Patientensicherheit in Deutschland aufzubauen. Zusammen entscheiden und tragen sie die Projekte und Initiativen des Vereins.
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. wurde im April 2005 als gemeinnütziger Verein gegründet. Es setzt sich für eine sichere Gesundheitsversorgung ein und widmet sich der Erforschung, Entwicklung und Verbreitung dazu geeigneter Methoden.
Quelle: Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS), Am Zirkus 2, 10117 Berlin, http://www.aps-ev.de, 03.08.2016