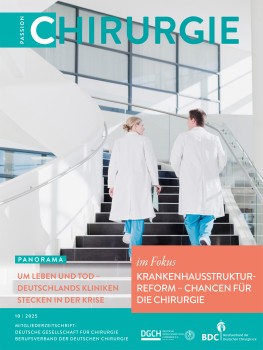20.09.2025 Politik
BDC-Praxistest: Krankenhausfinanzierung anhand von Leistungsgruppen und Vorhaltefinanzierung – wird nun alles besser?

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Karl Lauterbach hat den deutschen Krankenhäusern ein ganz besonderes Vermächtnis hinterlassen: das Krankenhausversorgungs-Verbesserungsgesetz (KHVVG) mit der Integration von Leistungsgruppen und der sogenannten Vorhaltefinanzierung.
Mit der Vorhaltefinanzierung wurde die Hoffnung verbreitet, dass diese zu einer wirtschaftlichen Absicherung der Krankenhäuser und gleichzeitig zu einer „Entökonomisierung“ führt. Es galt die Annahme, dass sämtliche Vorhaltekosten refinanziert werden.
Nachdem nun immer mehr Details zur konkreten Umsetzung der Vorhaltefinanzierung bekannt werden, macht sich jedoch etwas Ernüchterung breit. Denn mit dem Wechsel zur Vorhaltefinanzierung fließt gar nicht mehr Geld ins System, sondern es kommt lediglich zu einer Umverteilung der bisher schon für die Finanzierung der Krankenhäuser ausgeschütteten Mittel.
Um die zukünftigen Jahre möglichst unbeschadet zu überstehen, sollte man als Kliniker auch dieses Detail der aktuellen Reform und seine Auswirkungen verstehen, denn neben den Leistungsgruppen wird die Vorhaltepauschale die bundesweiten Krankenhausstrukturen am nachhaltigsten verändern. Nachfolgender Artikel beleuchtet das Thema exzellent.
Erhellende Lektüre
Prof. Dr. med. C. J. Krones und Prof. Dr. med. D. Vallböhmer
„Die Vorhaltepauschale wird bleiben.“ So wird die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken nach ihrer Pressekonferenz zu den Abstimmungen mit den Gesundheitsministerinnen und -ministern der Länder am 03. Juli 2025 zitiert [1]. Die vereinbarten Anpassungen zwischen Bund und Ländern sollen nun kurzfristig im Rahmen eines zustimmungsfreien Gesetzgebungsverfahrens durch den Bundestag beraten und beschlossen werden [1]. Auf dieser Basis kann man den handelnden Akteuren in den zuständigen Planungsbehörden und in den Krankenhäusern nur dringend empfehlen, sich so schnell wie möglich mit der Adaption der veränderten Rahmenbedingungen und Anreize auseinander zu setzen.
Aus dem Kreis der Ärzteschaft erfährt man mehr oder weniger offen, dass die zukünftige Zuordnung von Leistungsgruppen durchaus das Potential hat, die eigene Arbeitsplatzwahl zu beeinflussen. Das Ausmaß dieser Effekte ist zum heutigen Zeitpunkt kaum absehbar. Tatsache ist jedoch, dass die Krankenhausreform mit ihren beiden Komponenten aus bundeseinheitlicher Leistungsgruppensystematik und Vorhaltefinanzierung die stationäre Versorgung in Deutschland grundlegend verändern wird. Die maßgebliche Veränderungsdynamik ergibt sich dabei gerade durch die systematische Verknüpfung beider Konzepte: Ohne eine veränderte Finanzierungslogik birgt eine Konkretisierung der Versorgungsaufträge das Risiko von nicht tragfähigen Betriebskonzepten. Umgekehrt kann eine veränderte Krankenhausfinanzierung, die nicht allein auf der Vergütung erbrachter Mengen beruht, nur auf Basis einheitlicher Anforderungen an die Strukturen rechtssicher und wirtschaftlich tragfähig ausgestaltet werden. Dabei muss jedem Akteur bewusst sein, dass eines der zentralen Reformziele eine deutliche Reduzierung der Ausgaben für Krankenhausleistungen auf Seiten der gesetzlichen Krankenkassen war und angesichts der aktuellen Finanzlage auch bleiben wird [2].
Verbindung von Finanzierung und Planung verändert Anreize auf allen Ebenen
Während die öffentliche Debatte bisher von möglichen Ausnahmen und Besonderheiten der Leistungsgruppensystematik dominiert wird, ist es eigentlich die Vorhaltefinanzierung, die eine einheitliche Krankenhausplanungssprache zwischen den Bundesländern erforderlich macht. Grundsätzlich bringt die Vorhaltefinanzierung in ihrer vorgesehenen Ausgestaltung zwei wesentliche Vorteile für eine nachhaltige Ausrichtung der stationären Versorgung in Deutschland mit:
1.Sie verbindet die Krankenhausplanung mit der Krankenhausfinanzierung und löst damit die bestehende Pattsituation zwischen Bund und Ländern bei der Frage nach qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Krankenhausstrukturen auf. Voraussetzung ist, dass die Bundesländer die Möglichkeiten der Planfallzahlen aktiv nutzen. Auf diese Weise können die Bundesländer mit der Krankenhausplanung erstmals auch relevante Finanzierungszusagen für den Betrieb der Krankenhausstandorte verbinden.
2.Sie reduziert die Mengenanreize in der stationären Leistungserbringung und fördert gleichzeitig die ambulante Leistungserbringung durch die Krankenhäuser. Dies ergibt sich aus dem 80 % – Korridor in dessen Rahmen auch bei weniger Fallzahlen die volle Vorhaltefinanzierung ausgezahlt wird. Dieser Mechanismus verändert den Optimierungsanreiz im Krankenhausbetrieb grundlegend und reduziert in Verbindung mit den erweiterten Gestaltungsoptionen der Bundesländer (Planfallzahlen) den Fallzahlenwettbewerb zwischen den Krankenhausstandorten.
Das Instrument der Planfallzahlen ist erst mit dem Referentenentwurf vom 15. April 2024 in die Reformüberlegungen aufgenommen worden. Die Bedeutung dieses Instrumentes wird in der öffentlichen Debatte bisher vielfach kleingeredet. Tatsächlich verlangt dieses Instrument von den Planungsbehörden in den Bundesländern eine fundierte und belastbare Planung von Versorgungsbedarfen im regionalen Kontext. Bei der Zuweisung des Vorhaltevolumens auf die Krankenhausstandorte werden entweder die IST-Fallzahlen des Vorjahres oder eben die gemeldeten Planfallzahlen der Landesbehörden als Kalkulationsgrundlage herangezogen. Aufgrund der begrenzten Vorhaltebudgets je Land und je Leistungsgruppe werden die (geplanten) Fallzahlen auf der Standortebene zur Ermittlung der Anteile am Gesamtvolumen für den jeweiligen Krankenhausstandort benötigt. Als weiterer Faktor kommt die standortindividuelle Vorhaltebewertungsrelation zur Anwendung. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Vorhaltefinanzierung möglichst wenig fallmengensensibel, wohl aber fallschweresensibel ausgestaltet wird. Mit anderen Worten erhält jeder Krankenhausstandort ein Vorhaltevolumen, dass seinem Versorgungsanteil (Fallmenge) im Bundesland entspricht und seine spezifische Versorgungsrolle (Fallschwere) berücksichtigt. Auf diese Weise können die Planungsbehörden in den Bundesländern aktiv einen relevanten Anteil der Krankenhausfinanzierung entsprechend ihrer Versorgungsplanung an den bedarfsnotwendigen Standorten allokieren.
Diese Umverteilung ergibt sich schon alleine daraus, dass der Gesundheitsausschuss im Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses auf den letzten Metern noch eine Anpassung für die Sicherstellungshäuser nach § 136c Absatz 3 Satz 2 SGB V in das Gesetz aufgenommen hat [3]. Demnach gilt für Krankenhausstandorte, die vom G-BA auf der Liste der Sicherstellungshäuser geführt werden, dass sich die Vorhaltefinanzierung dieser Standorte mindesten aus den Mindestvorhaltezahlen je Leistungsgruppe gemäß der Richtlinie nach § 135f SGB V errechnet. Dabei handelt es sich um eine Rechtsverordnung, die durch das BMG unter Zustimmung des Bundesrates erlassen werden muss. Wenig überraschend ist diese Richtlinie hoch umstritten und bisher nicht verabschiedet. Dies ergibt sich aus den erheblichen Interessenskonflikten, die diese Festlegung zwischen Bund und Ländern mit sich bringt. Während die Länder möglichst niedrige Mindestvorhaltezahlen anstreben, um möglichst vielen Krankenhausstandorten eine Zuweisung von Vorhaltefinanzierung und somit eine tragfähige Leistungserbringung ermöglichen wollen, hat der Bund ein Interesse an einer deutlichen Reduktion der Krankenhausstandorte. Dahinter steckt, neben den vielfach angeführten Qualitätsargumenten, auch die oben bereits erklärte Kostenreduzierung durch geringere Leistungsausgaben auf Seiten der gesetzlichen Krankenkassen.
Vor diesem Hintergrund kommen die Planungsbehörden in den Bundesländern faktisch nicht umhin, eine aktive Zuweisung von Vorhaltevolumen (über Planfallzahlen) zu betreiben. Um dieser Aufgabe rechtssicher gerecht zu werden, bedarf es neuer Konzepte zur Ermittlung der relevanten Bedarfe und einer regionalen Planungslogik. Schließlich dürfte es kaum bedarfsgerecht sein, wenn im Bayerischen Wald ein Krankenhausstandort aus der Versorgung einer Leistungsgruppe ausscheidet und dadurch alle Krankenhäuser in München in dieser Leistungsgruppe eine höhere Vorhaltefinanzierung erhalten. Es ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass die Fälle aus dem Bayerischen Wald tatsächlich jemals in Münchner Krankenhäusern auftauchen. Umgekehrt stellt sich die Frage, wie eine reduzierte Vorhaltefinanzierung auf die Münchner Kliniken, die alle die gleiche Leistungsgruppe versorgen, verteilt werden soll, wenn der Krankenhausstandort im Bayerischen Wald aus Gründen der Sicherstellung eine höhere Vorhaltefinanzierung erhält, auch wenn dieser die kalkulierten Fallzahlen niemals erreicht. Wahrscheinlich wird in diesem Szenario mindestens einem Standort im gut versorgten Ballungsgebiet von München die Zuweisung der Leistungsgruppe verweigert, um auf diese Weise das Vorhaltebudget im Bayerischen Wald freizusetzen. An dieser Stelle wären differenzierte Planungskreise für die einzelnen Leistungsgruppen innerhalb eines Bundeslandes sinnvoll. Während es hochspezialisierte Leistungsgruppen gibt, die sinnvollerweise innerhalb des Bundeslandes reallokiert werden können, dürfte bei den allgemeinen Leistungsgruppen eine kleinräumige Zuweisung von Leistungsgruppen und Vorhaltefinanzierung erforderlich sein. Hierfür bietet die Leistungsgruppenplanung mit den verschiedenen Planungsebenen in NRW eine geeignete Blaupause [4]. Wahrscheinlich wird man dabei nicht umhinkommen, einen konkreten Bevölkerungsbezug in die Bedarfsplanung je Leistungsgruppe aufzunehmen. Dieser fehlt bislang (leider) in dem Regelwerk des KHVVG.
Mit einer klugen Verknüpfung von Investitionsförderung und Vorhaltefinanzierung sind die Bundesländer unter der neuen Planungslogik in der Lage, die Versorgungslandschaft in ihrem Bundesland nachhaltig zu verändern. So kann die Planungsbehörde über Planfallzahlen auch die ambulante Leistungserbringung zielgerichtet fördern. Denkbar ist, dass ein konstant hohes Vorhaltevolumen auch dann zugewiesen wird, wenn ein Krankenhausstandort immer mehr Leistungen ambulant erbringt. Auf diese Weise wird die ambulante Leistungserbringung gerade im Zusammenhang mit den notwendigen Investitionen wirtschaftlich tragfähig (quersubventioniert aus der Vorhaltefinanzierung). Im Gegenzug können die Investitionsfördermittel des Landes an einem anderen Standort gebündelt werden und auf diese Weise die stationäre Versorgung auch ohne neuerliche Mengenausweitung (angeregt durch selbstfinanzierte Investitionskosten) tragfähig finanziert werden. Durch die begrenzten Budgets der Vorhaltefinanzierung erhalten die Bundesländer einen Anreiz, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zielgerichtet auf die relevanten Standorte zu bündeln. Nur dann lassen sich wirtschaftlich tragfähige Versorgungskonzepte realisieren. Im Zusammenspiel mit der jährlichen Neukalkulation der Vorhaltebudgets je Land und Leistungsgruppe ergibt sich folgendes anschauliches Anreizsystem für die Bundesländer: Das Vorhaltevolumen wird jedes Jahr auf einen Standort weniger verteilt, damit die verbliebenen Standorte wirtschaftlich überleben können. Damit dürften die angestrebten Einsparziele auf Bundesebene im Zeitverlauf durchaus realisierbar sein.
Feste Budgets sorgen für Einsparungen in der GKV
Die Reduzierung der Mengenanreize im neuen System aus Leistungsgruppen und Vorhaltefinanzierung ergibt sich also schon daraus, dass die Vorhaltefinanzierung als festes und begrenztes Budget auf die Bundesländer und die Leistungsgruppen verteilt wird. Das Risiko einer Leistungsausweitung wird auf diese Weise für einen beträchtlichen Anteil des Krankenhausbudgets (unter Herausrechnung von Pflegebudget und der fallbezogenen Stückkosten verbleiben ca. 30 % in der Vorhaltefinanzierung) von den gesetzlichen Krankenkassen auf die Gemeinschaft der Leistungserbringer verlagert, da zusätzlich Fälle nur noch mit den variablen Rest-DRGs vergütet werden. Da das Vorhaltevolumen auf der Standortebene zudem für anfangs zwei später drei Jahre festgeschrieben ist, dürften wirtschaftlich erfolgreiche Strategien für eine Leistungsausweitung nahezu ausgeschlossen sein. Einen größeren Effekt haben Standortreduktionen durch die Planungsbehörden, weil in diesem Falle auch das Vorhaltevolumen neu verteilt wird (s. o.).
Gleichzeitig wird für die Krankenhausstandorte je Leistungsgruppe eine 80 %-Schwelle eingeführt: Überschreitet der Standort im Jahresverlauf die Schwelle von 80 % der geplanten oder kalkulierten Fallzahlen, erhält er in jedem Fall 100 % der im Voraus kalkulierten Vorhaltefinanzierung. Mit diesem Schwellenwert soll der Anreiz zur Minderleistung abgemildert werden. Eine betriebswirtschaftliche Optimierung dürfte jedoch darauf abzielen, das Leistungsvolumen an dieser Schwelle auszurichten. Aufgrund der Kalkulationslogik der Vorhaltefinanzierung ist nicht davon auszugehen, dass auf diese Weise alle Fixkosten der Krankenhäuser refinanziert sind. Insofern bleibt ein Leistungs- bzw. Optimierungsdruck auch oberhalb des Schwellenwertes bestehen. Wem es nicht gelingt, die eigene Kostenstruktur auf die neue Leistungsmenge anzupassen, wird zusätzliche Erlösquellen erschließen müssen. Hierfür bietet sich die ambulante Leistungserbringung am Krankenhaus oder die telemedizinische Versorgung über die eigenen stationären Patentinnen und Patienten hinaus an. Vor diesem Hintergrund wirkt die Vorhaltefinanzierung wie ein Subventionsprogramm für die ambulante Versorgung am Krankenhaus. Durch die Quersubventionierung aus der Vorhaltefinanzierung können auch ambulante Leistungen tragfähig angeboten werden, die bisher wirtschaftlich unattraktiv erschienen. Durch die Anreize zur Leistungsreduktion in der stationären Versorgung wird der Bundesgesetzgeber mit der Einführung der Vorhaltefinanzierung seinem Einsparziel auf Seiten der Krankenhäuser gerecht und sorgt gleichzeitig für zusätzlichen Versorgungsbedarf in der ambulanten Versorgung.
Kritiker der Vorhaltefinanzierung weisen immer wieder darauf hin, dass das Vorhaltebudget je Land und je Leistungsgruppe jährlich auf das aktuelle Casemixvolumen angepasst wird. Tatsächlich führt diese Regelung dazu, dass sich die Mengenanreize von der Standortebene auf die Bundeslandebene verlagern und insbesondere an den Bundeslandgrenzen eine bedarfsgerechte Versorgungsplanung konterkarieren. Für einen nachhaltigen Umbau der Krankenhauslandschaft wäre auch auf der Ebene der Bundesländer eine Festschreibung des Vorhaltevolumens für mindestens fünf, besser zehn Jahre erstrebenswert gewesen. Allerdings würden auf diese Weise die Einsparungen aus der Leistungsreduzierung bei den Krankenhäusern verbleiben und eben nicht zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen beitragen.
In diesem Falle bräuchte es jedoch eine zusätzliche Lösung zur Abbildung von Leistungsverschiebungen zwischen den verschiedenen Leistungsgruppen. Es ist derzeit kaum absehbar, welche Auswirkungen die Einführung der Leistungsgruppen und die Implementierung des Leistungsgruppen-Groupers auf die zukünftige Zuordnung der bisherigen Fälle auf die einzelnen Leistungsgruppen haben wird. Neben der Abrechnungsoptimierung könnten hierbei neue sachfremde Optimierungsanreize entstehen, um die Leistungen am eigenen Standort zu halten. Umso wichtiger erscheint eine gezielte Steuerung der Vorhaltevolumen zwischen den Leistungsgruppen. Mit der Berücksichtigung von „Förderbeträgen“ für einzelne Leistungsbereiche ist ein entsprechender Mechanismus ohnehin bereits etabliert.
Die aktuellen Debatten zur Aufweichung und Anpassung der gesetzlich verankerten Strukturanforderungen je Leistungsgruppe sind daher immer auch im Zusammenhang mit den erwarteten Auswirkungen auf die Leistungsmengen zu beobachten. Unabhängig von den tatsächlichen Bedarfen sorgt die demografische Entwicklung dafür, dass eine Fortsetzung der bestehenden Versorgung- und Vergütungsstrukturen die gesetzlichen Krankenkassen überfordern werden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Einführung von Leistungsgruppen und Vorhaltevergütung einen schrittweisen Einstieg in nachhaltige tragfähige Versorgungsstrukturen zu ermöglichen.
Literatur
[1] Bibliomed Manager. Warken: „Die Vorhaltepauschale wird bleiben“. www.bibliomedmanager.de. [Online] 06. 07 2025. https://www.bibliomedmanager.de/news/warken-die-vorhaltepauschale-wird-bleiben.
[2] Bundesregierung. Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – KHVVG. www.bundesgesundheitsministerium.de. [Online] 15. 05 2024. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/KHVVG_GE_Kabinett.pdf.
[3] Gesundheitsausschuss. Beschlussempfehlung zum KHVVG. dserver.bundestag.de. [Online] 16. 10 2024. https://dserver.bundestag.de/btd/20/134/2013407.pdf.
[4] Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW. Qualitätskriterien der Leistungsbereiche und Leistungsgruppen. www.mags.de. [Online] https://www.mags.nrw/system/files/media/document/file/uebersichtstabelle_ueber_die_qualitaetskriterien.pdf.

Nils Dehne
Geschäftsführer
Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V. und EKK plus GmbH
Gesundheitspolitik
Dehne N: BDC-Praxistest: Krankenhausfinanzierung anhand von Leistungsgruppen und Vorhaltefinanzierung – wird nun alles besser? Passion Chirurgie. 2025 Oktober; 15(10): Artikel 05_01.
Diesen Artikel finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Fachübergreifend.
Weitere aktuelle Artikel
01.11.2011 Politik
Wirtschaftliche Stimmung unter Ärzten sinkt
Niedergelassene Ärzte in Deutschland bewerten ihre wirtschaftliche Lage und die
01.10.2011 Fachübergreifend
Informationslogistik erhöht Effizienz, Produktivität und Qualität der Versorgung in operativen Abteilungen
Zusammenfassung des folgenden englischen Artikels von T.R. Hansen and T.H. Bank „How Clinical Logistics Can Increase Efficiency, Productivity And Quality Of Care In ORs.” durch Dr. K. Busch, MBE
01.10.2011 Politik
Health 2.0 als Klinik- und Praxismagnet: online Arzt-Patienten-Kommunikation und Terminmanagment
Das Internet hat in unserem beruflichen und privaten Alltag längst
01.10.2011 BDC|News
Honorar- und belegärztliche Tätigkeit des niedergelassenen Chirurgen – Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des BDC
Die Arbeitswelt für die Chirurginnen und Chirurgen hat sich in
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.