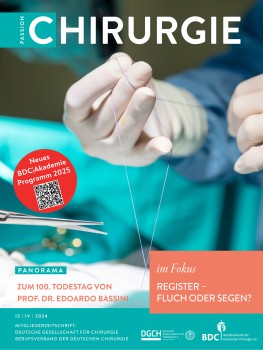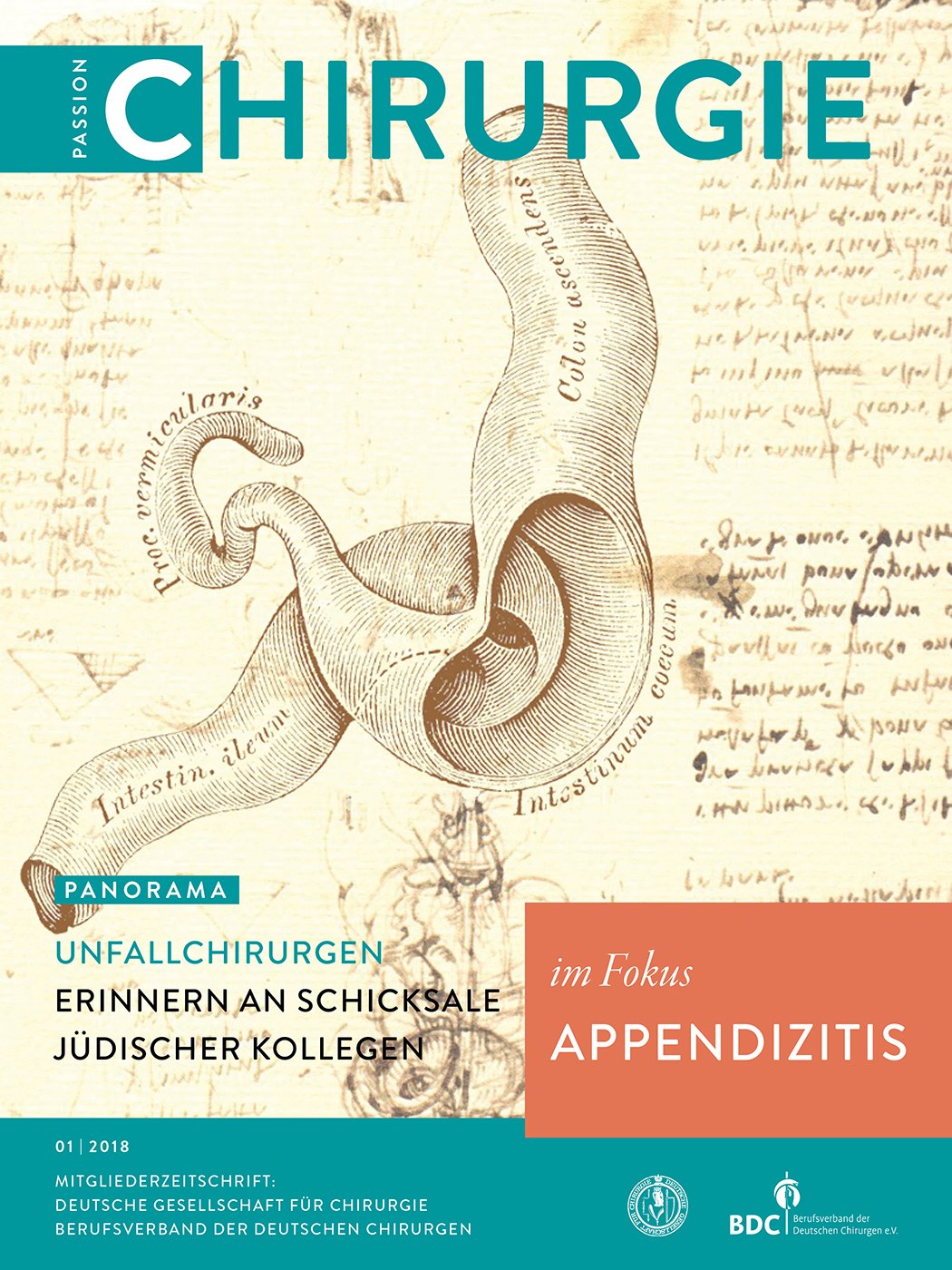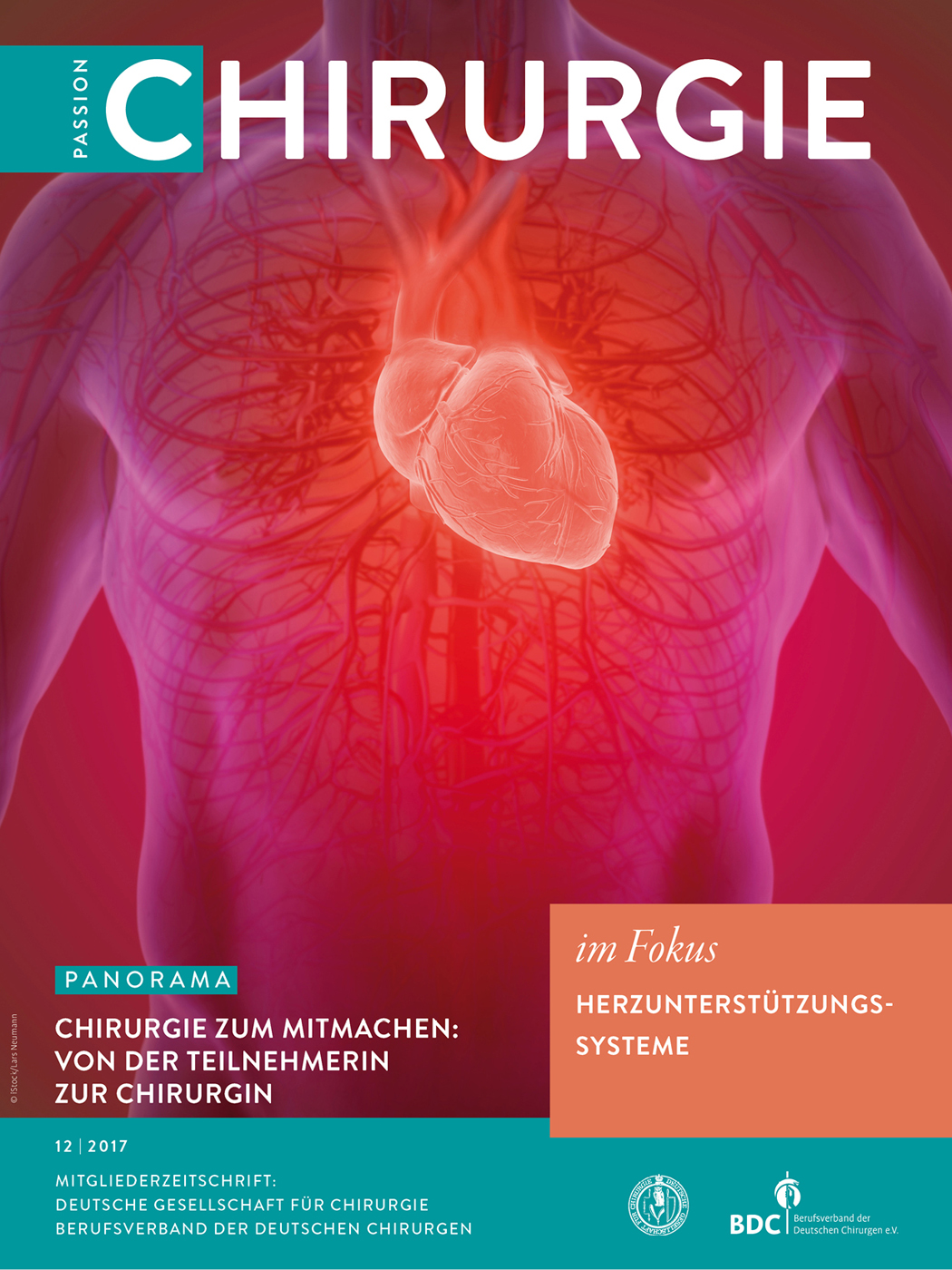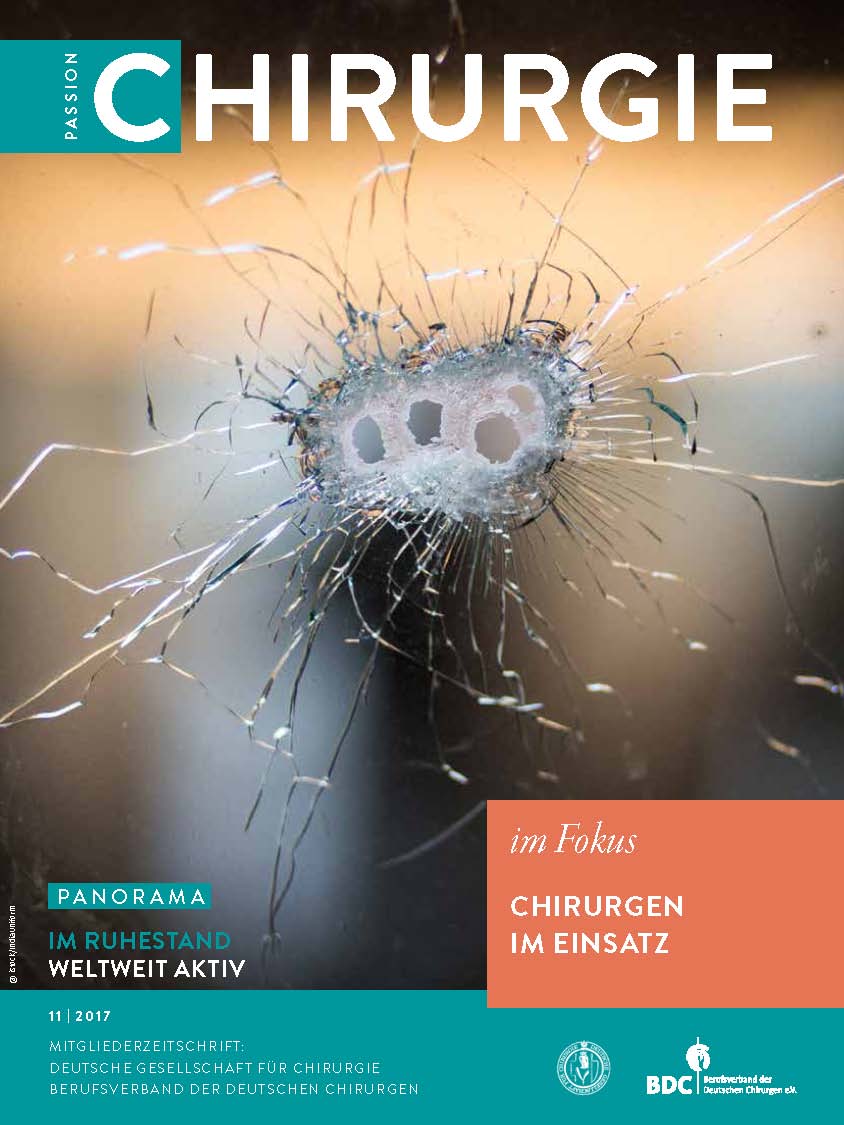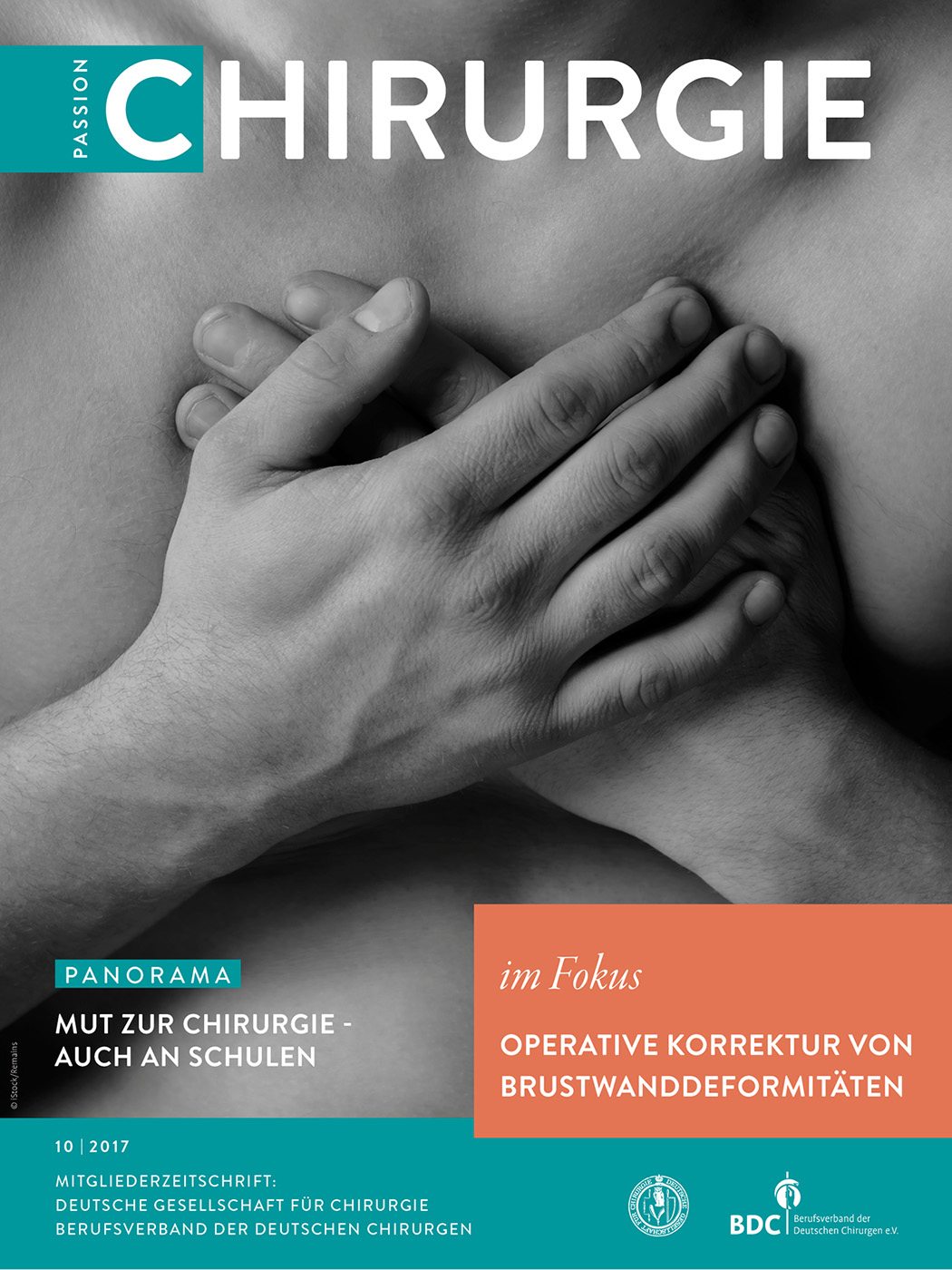01.12.2024 Fachübergreifend
Register in der Medizin: Datengrab oder wichtige Versorgungsforschung?

In der Versorgungsforschung in Deutschland, aber auch international, wird zunehmend auf Register zurückgegriffen. Diese Datensammlungen in der klinischen Medizin blicken auf eine lange Historie zurück. Die epidemiologischen Krebsregister, als wesentlicher und bedeutsamer Beitrag, blicken zurück auf eine fast 100-jährige Geschichte. Nationale Register wie beispielsweise in den skandinavischen Ländern in der Endoprothetik haben einen wichtigen Beitrag in der Versorgungsforschung und zur Versorgungssicherheit geleistet.
Ziel eines Registers in der Versorgungsforschung ist nicht der Nachweis eines absoluten Therapieeffekts unter experimentellen Bedingungen, sondern dass diese für Optimierungen genutzt werden können, insbesondere wenn die Ergebnisse der Erhebung den Beteiligten zurückgemeldet und im Sinne eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements eingesetzt werden. Wesentlicher Pfeiler in der Konzeption eines Registers ist die unabhängige Zertifizierung unter Einschluss des Peer Review Verfahrens. Laut Ärzteblatt handelte sich bei den Registern in der klinischen Medizin, die in 33 Fachgebieten eingerichtet worden sind, um einen ungehobenen Datenschatz (www.bit.ly/medRegDatenschatz).
Das Bundesgesundheitsministerium (www.bit.ly/RegDB-Websuche) ist auf diesen Sachverhalt aufmerksam geworden und hat eine Zusammenfassung der medizinischen Register in Auftrag gegeben. Erklärtes Ziel dieser vorbereitenden Arbeit einschließlich eines Rechtsgutachtens war die Schaffung einer Erleichterung der Eingabe in die Register unter dem zwischenzeitlich verabschiedeten Medizinforschungsgesetzes. Diese Hoffnung hat sich aus Sicht der klinischen Medizin jedoch nicht erfüllt.
Der immer noch erforderliche Nachweis der Zustimmung des Patienten ist im internationalen Vergleich nicht nachvollziehbar. Selbst EU-Länder wie Österreich haben eine sinnvolle Erleichterung im nationalen Datenschutzrecht umgesetzt. Die Einwilligung von Patienten zu bekommen, die bewusstlos den Schockraum erreichen, ist unmöglich und hat einen negativen Einfluss auf die Analyse der Rettungskette sowie der innerklinischen Reanimation. Hier gilt es dringend Abhilfe zu schaffen, die letzte Hoffnung ist jetzt noch das Registergesetz, welches über das Bundesministerium für Gesundheit in Vorbereitung ist.
Das TraumaRegister DGU konnte die vielschichtigen Ansätze zur Verbesserung der Unfallversorgung von der Rückkopplung an die Automobilhersteller über die schnellere Alarmierung der Rettungskette (bundesweit einheitliche Notrufnummer) bis hin zur verbesserten Ausstattung der Rettungswagen/Notarztfahrzeuge und die standardisierten Abläufe in den Kliniken eindrucksvoll als Erfolg belegen. Gerade bei Unfallverletzten handelt es sich oft um junge Menschen, der Verlust an Lebensjahren ist dementsprechend gravierend. Diese Dokumentation ermutigt uns, die zusätzlichen Belastungen, die die Erfassung macht zu rechtfertigen. Dem Dank der Autoren an alle Beteiligten kann sich die Fachgesellschaft und insbesondere der Generalsekretär nur ausdrücklich anschließen. Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung wird hier in vorbildlicher Weise wahrgenommen, das Register stellt sich in den Dienst der Schwerverletzten und hilft Leben zu retten, Lebensjahre zu erhalten und die Lebensqualität nach schweren Unfällen im Blick zu behalten.

Abb. 1: Übersicht der Register in der Unfallchirurgie
Pennig D: Register in der Medizin: Datengrab oder wichtige Versorgungsforschung? Passion Chirurgie. 2024 Dezember; 14(12/IV): Artikel 03_03.
Autor:in des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
01.02.2020 Fachübergreifend
Das neue Innovationsfondsprojekt „Einheitliche, sektorengleiche Vergütung“ schafft Einblicke in eine sektorengleiche Leistungserbringung
Patienten sollten in dem Versorgungssetting behandelt werden, das medizinisch die angemessenste Versorgung bietet. Für eine Reihe von Eingriffen ist eine Behandlung sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor denkbar. Sie gelten damit als „sektorengleich“. Zu den Klassikern zählen beispielsweise Koloskopien und Endoskopien, Eingriffe bei Leistenhernien und Katarakten.
01.02.2020 Fachübergreifend
Ambulantisierung in Deutschland: Aufwind durch aktuelle Gesetzesreformen
Das deutsche Gesundheitswesen gehört bekanntlich zu den teuersten Gesundheitssystemen weltweit: 11,5 Prozent des BIP werden für Gesundheit ausgegeben [4]. Ein besonders großer Anteil dieser Ausgaben entfällt auf die stationäre Versorgung von Patienten im Krankenhaus. Ein vergleichsweise großer Kostentreiber ist dabei die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus. Während in der Türkei und in den Niederlanden Patienten im Durchschnitt vier bzw. fünf Tage im Krankenhaus bleiben, liegt die durchschnittliche Verweildauer in Deutschland bei 7,5 Tagen [8].
23.12.2019 BDC|News
Editorial: Des einen Lust – des anderen Frust?
Es funktioniert tatsächlich: Allein 2019 hat uns Jens Spahn an die dreißig neue und laufende Gesetzgebungsverfahren beschert – Ende nicht in Sicht! Und in der Tat werden Sie einander dieser Tage nicht nur einen besinnlichen Jahresausklang wünschen, Glück, Erfolg und Freude, nach Möglichkeit im Kreise der Familie, sondern immer wieder auch Gesundheit.
29.11.2019 Fachübergreifend
Digitales Krankenhaus – ständiger Wandel ist zum Normalfall geworden
Das Krankenhaus heute entwickelt sich zu einem Digitalen Krankenhaus. Dieses wird heute als Krankenhaus 4.0, Lean Hospital oder Smart Hospital bezeichnet. Der soziodemografische Wandel, die Ökonomisierung der Medizin, die immer kürzer werdenden Gesundheitsreformen, der Fachkräftemangel und auch der medizinisch-technische Fortschritt führen dazu, dass das Thema Wandel im „Ökosystem“ Krankenhaus immer wichtiger wird.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.