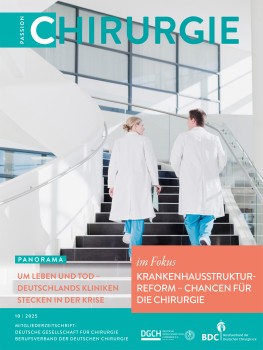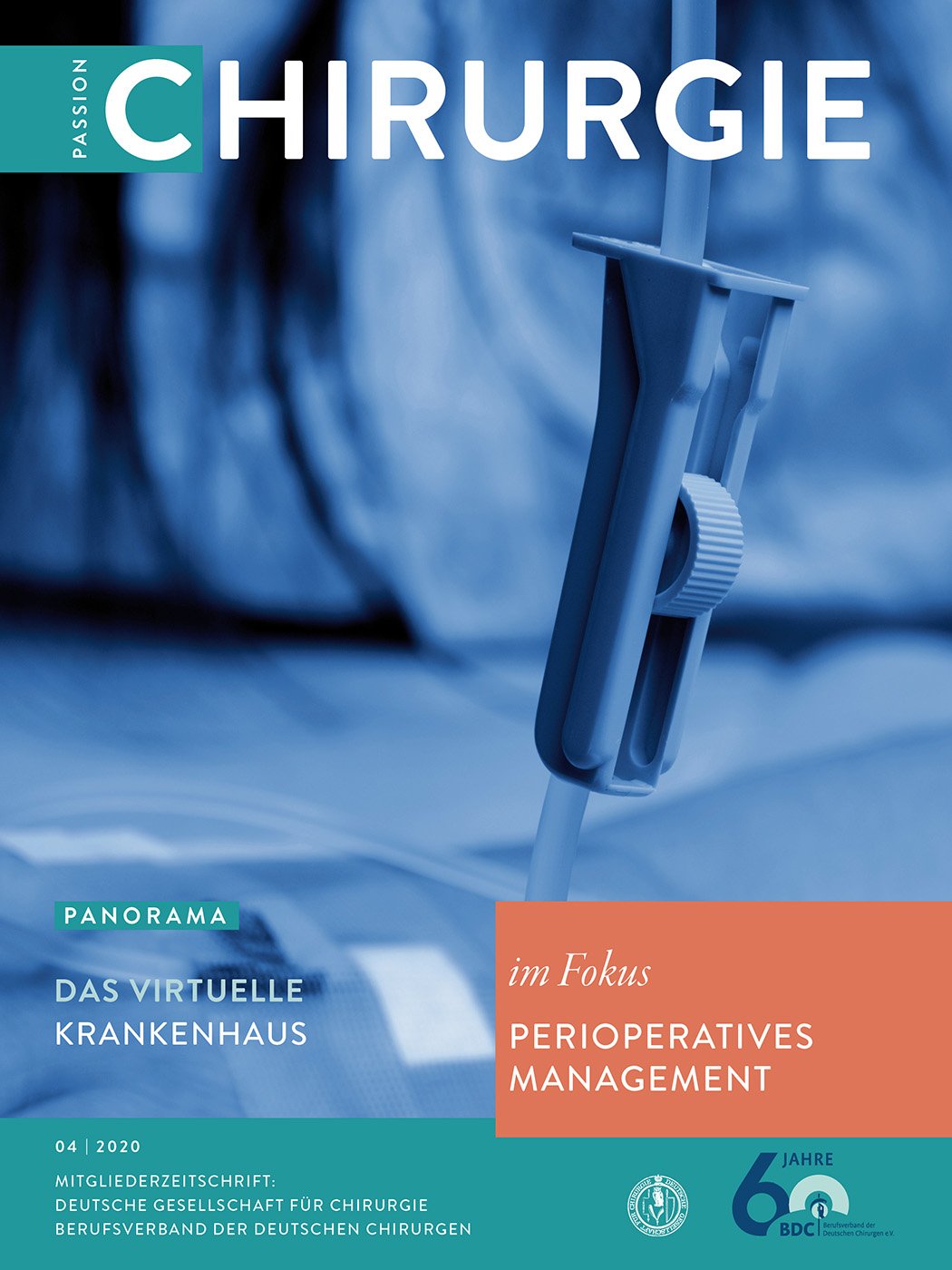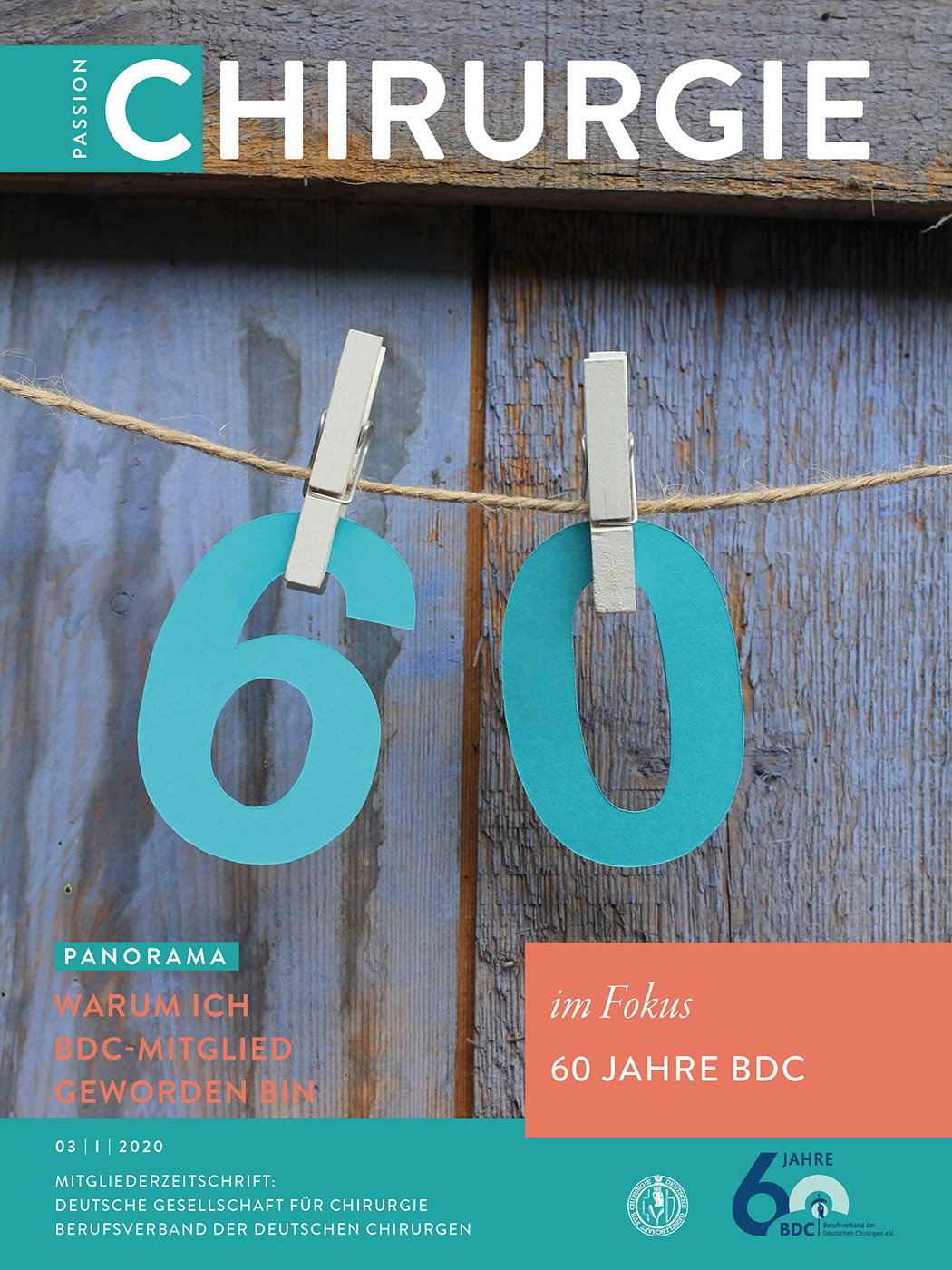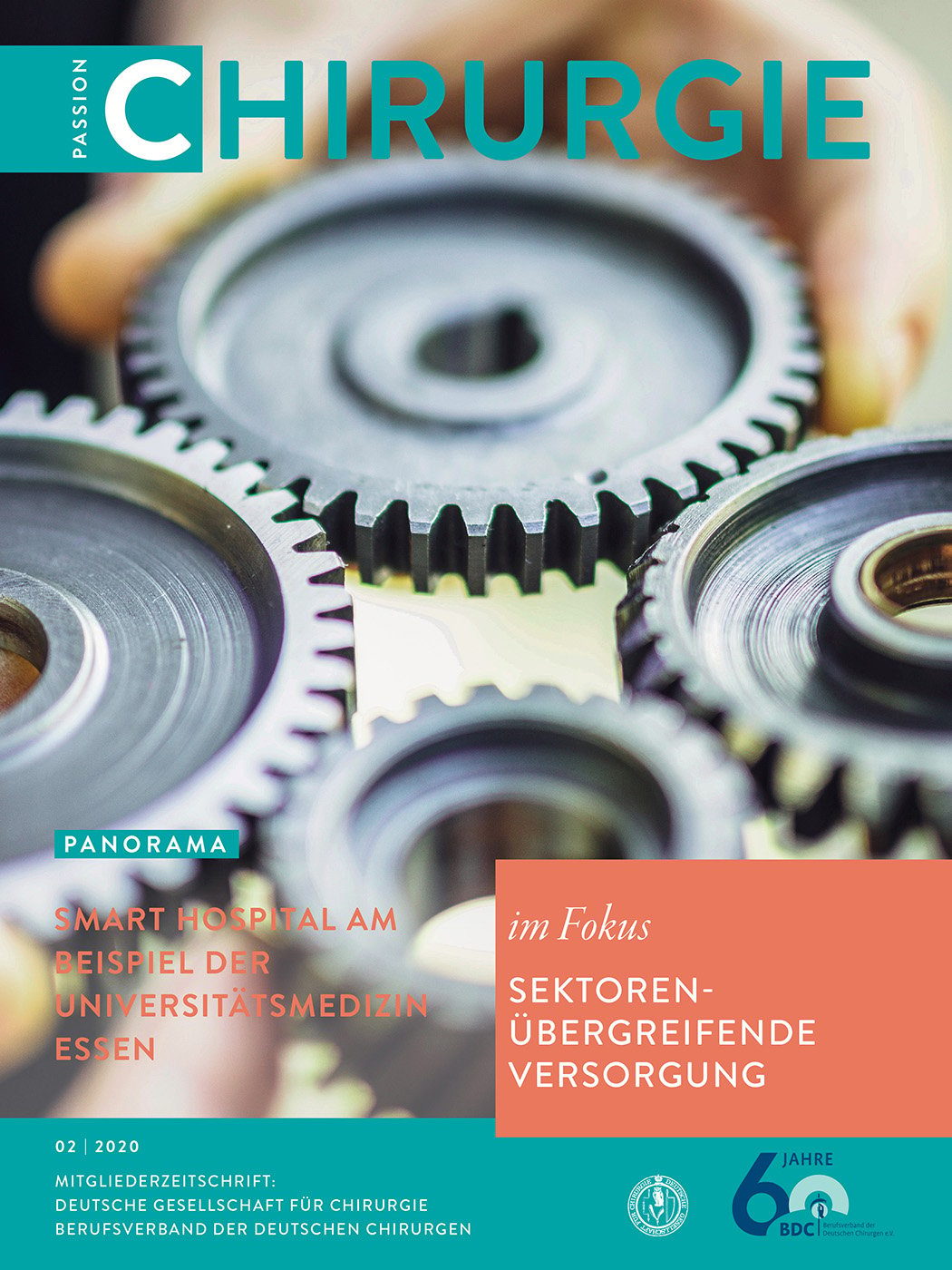20.09.2025 Politik
Umsetzung des Krankenhausplans in NRW – Lehren für die Chirurgie

Chronologie des NRW-Krankenhausplans
Das 2018 vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) beauftragte Gutachten zur Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen (Lohfert & Lohfert AG, TU Berlin) bildete die Grundlage für eine der tiefgreifendsten Reformen im deutschen Gesundheitswesen seit Jahrzehnten. Kernaussage: Die Krankenhausplanung muss sich stärker an Versorgungsbedarf und Behandlungsqualität orientieren.
Nach intensiven Abstimmungen mit Ärztekammern, Krankenkassen, der Krankenhausgesellschaft NRW und dem MAGS wurde 2022 der neue Krankenhausplan verabschiedet. Ende desselben Jahres konnten die Krankenhäuser ihre gewünschten Leistungsgruppen digital beantragen. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen schlossen im Mai 2023 ab, woraufhin die Bezirksregierungen die Anträge prüften. Nach zwei Anhörungsrunden wurden im Dezember 2024 die Feststellungsbescheide verschickt. Seit dem 1. April 2025 ist der Plan – mit wenigen Übergangsregelungen – verbindlich in Kraft.
Erfahrungen aus dem Antragsverfahren
Allgemeine Beobachtungen
Aus Sicht der Autoren ist die Grundidee des Plans – eine Strukturreform mit Fokus auf Behandlungsqualität – richtig und wichtig. Bei viszeralchirurgischen Leistungsgruppen wurde die Zuteilung jedoch nahezu ausschließlich anhand von Fallzahlen entschieden, ergänzt durch vorhandene Vorhaltestrukturen. Die Höhe der Fallzahlen orientierte sich, wenn vorhanden, an den G-BA Mindestmengen. Für die Leistungsgruppen (LG), bei denen keine G-BA Vorgaben vorlagen (Adipositas, Leber, Rektum) wurden Fallzahlen von Zertifizierungsvorgaben von Fachgesellschaften (z. B. DGAV) zugrunde gelegt. Zertifikate (DKG, DGAV u. a.) spielten in der Entscheidung nur eine untergeordnete Rolle.
Die Folge war eine deutliche Konzentration der Leistungsgruppen. Besonders drastisch ist dies in der Leberchirurgie: Rund 75 % der beantragenden Häuser erhielten keine Genehmigung für anatomische Leberresektionen. Damit wird eine zentrale Zielgröße – Qualitätssteigerung durch höhere Fallzahlen – stringent verfolgt. Ob dies allein ausreicht, muss sich jedoch zeigen. Unverzichtbar bleibt die ausreichende finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser, an der es bislang fehlt.
Da ähnliche Verfahren in anderen Bundesländern absehbar sind, lassen sich aus NRW erste Lehren ziehen.
Erste Erkenntnisse nach Inkrafttreten
Obwohl der Krankenhausplan NRW erst seit vier Monaten greift, zeichnen sich bereits zentrale Aspekte ab:
1.Online-Verfahren und Verhandlungen
Die Beantragung und Verhandlung der Leistungsgruppen sollte künftig nicht nur von Ökonomen, sondern auch von medizinischen Fachvertretern begleitet werden.
2.Eilverfahren
Die überwiegende Mehrheit, der nach Versendung der Feststellungsbescheide von einigen Klinikern eingereichten Eilanträge gegen den NRW-Krankenhausplan, wurden vom Düsseldorfer Verwaltungsgericht abgelehnt. Aus diesem Grunde scheinen die Beschlüsse weitestgehend rechtssicher zu sein, so dass sich Krankenhäuser nicht drauf verlassen sollten in späteren Rechtsinstanzen Leistungen zugesprochen zu bekommen, welche initial nicht erteilt wurden. Da zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels viele Verfahren noch nicht abschließend beschieden sind, muss hier der Verlauf zeigen, inwieweit Gerichte die Entscheidungen des MAGS am Ende widerrufen.
3.Beispiel Ösophaguschirurgie
Von 71 beantragenden Standorten erhielten 26 (37 %) die Genehmigung zur Durchführung von Ösophagusresektionen. Grundlage war die G-BA-Mindestmenge von 26 Eingriffen pro Jahr. Auffällig ist die ungleichmäßige regionale Verteilung: Alle vier beantragenden Essener Kliniken erhielten eine Zuteilung, während andere Regionen stark eingeschränkt wurden. Die Gründe für diese regionale Ungleichverteilung ist von außen nicht nachzuvollziehen. Interessant ist jedoch auch, dass alle Krankenhäuser zusammen in NRW ca. 2.400 Ösophagusresektionen beantragt haben. Im Jahr 2024 wurden ca. 1.100 Ösophagusresektionen in NRW durchgeführt, was zeigt, dass die Krankenhäuser eine massive „Überzeichnung“ der beantragten Leistungen durchgeführt haben. Dies wurde vom MAGS dahingehend korrigiert, dass insgesamt 1.229 Speiseröhrenresektionen auf die 26 Zentren verteilt wurden. Dies würde bei einer gleichmäßigen Verteilung knapp 50 Ösophagusresektionen pro Zentrum bedeuten, womit man es schaffen würde alle Zentren zu sogenannten high-volume Zentren aufzubauen. Inwieweit sich diese Verteilung in der Realität so zeigt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend zu beurteilen. Da sich die Eingriffe aktuell schon in wenigen High-Volume-Zentren konzentrieren, ist von einer gleichförmigen Verteilung auf die verbleibenden Zentren wahrscheinlich nicht auszugehen.
4.Beispiel Leberchirurgie
Besonders restriktiv verlief die Zuteilung in der Leberchirurgie: Nur 29 von 113 Häusern dürfen anatomische Resektionen durchführen (Ablehnungsquote: 74 %). Grundlage waren 20 Eingriffe pro Jahr – analog zu DGAV-Zertifizierungsvorgaben. Auch hier zeigt sich, analog der Ösophaguschirurgie, eine regionale Ungleichmäßigkeit. Während in Essen drei Zentren zugelassen wurden, fehlen in Regionen wie Niederrhein oder Sauerland wohnortnahe Angebote, wodurch Patienten teils über 50 km Fahrstrecke in Kauf nehmen müssen. Auch hier sind ist die Entscheidungsgrundlage des MAGS von außen nicht nachzuvollziehen, die individuellen Gründe für oder wider einer Leistungserbringung wurden allen Krankenhäusern individuell zugestellt und sind nicht öffentlich einsehbar.
5.Beispiel kolorektale Chiurgie
Bei der Leistungsgruppe „tiefes Rektum“ zeigte sich eine Ablehnungsquote von 52 %. Dies betrifft auch Zentren welche eine DKG Zertifizertung als Darmzentrum vorweisen können. Den Autoren ist leider nicht in der Fläche bekannt, was die Gründe für ein Leistungsverbot dieser Zentren sind. Klar ist jedoch, dass in der Mehrheit die DKG Zertifikate bei fehlender Rektumchirurgie am Zentrum mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufrechterhalten werden können. Ob es sich bei den Entscheidungen ausschließlich um regionale Effekte handelt oder andere tragende Gründe dahinterstehen, lässt sich nicht abschließend klären. Ebenso ist unklar, ob die Umstrukturierungen in Einklang mit den aktuell einführenden G-BA Mindestmengen für die kolorektale Chirurgie sind, d. h. ob alle Zentren, die aktuell den NRW LG-Zuschlag erhalten haben auch langfristig die G-BA Mindestmengen erreichen werden. Auch dies wird über die nächste Zeit abzuwarten werden.
Übertragbarkeit auf andere Bundesländer
Das Bundesland NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. In der Region Rhein/Ruhr leben ca. 11 Millionen Menschen und die Region ist eine der am dichtesten besiedelten Landstriche in Europa. Dies muss bei der Planung über Übertragung des Konzeptes NRW auf andere Regionen in Deutschland berücksichtigt werden. Auch wenn sich durch die Umstrukturierung der Leistungserbringung Fahrzeiten für Patient*innen für einige Indikationen verlängert haben, ist die Krankenhausdichte im Bundesland nach wie vor hoch und die medizinische Versorgung innerhalb überschaubarer Fahrstrecken erreichbar.
Dies ist jedoch nicht für alle Regionen in gleicher Weise übertragbar. Insbesondere für spärlich besiedelte Landstriche in Deutschland (z. B. Teile in Mecklenburg-Vorpommern) würde eine 1:1 Übertragung des NRW Konzepts zu massiven Verlängerungen von Fahrstrecken führen, teilweise können Leistungen im Land gar nicht mehr abgebildet werden. Dies kann in einer Simulation für thoraxchirurgische Eingriff in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt werden, wo möglicherweise eine Leistungsbündelung an die Universitätsklinika in Rostock und Greifswald nicht ausreichen würde, um die NRW Strukturvorgaben zu erfüllen.
Qualitätsaspekte
Der NRW-Plan setzt Qualität aktuell allein über Fallzahlen gleich. Zwar korreliert Volumen mit Ergebnisqualität, jedoch fehlen bislang begleitende Outcome-Analysen und eine zentrale Evaluation der Reform.
Offen ist zudem, ob alle Patient:innen mit relevanten Diagnosen tatsächlich in die zugelassenen Zentren gelangen. Hier braucht es verlässliche Zuweisungsstrukturen, um zu vermeiden, dass potenziell geeignete Fälle außerhalb spezialisierter Häuser behandelt werden.
WEITERBILDUNG
Der Krankenhausplan NRW wird weitreichende Auswirkungen auf die chirurgische Weiterbildung im Land haben. Durch den Wegfall bestimmter Leistungsgruppen verändern sich an vielen Standorten die Möglichkeiten der Weiterbildung grundlegend. Besonders betroffen ist die Weiterbildung in der speziellen Viszeralchirurgie, während die fachärztliche Weiterbildung in der allgemeinen Viszeralchirurgie weniger stark eingeschränkt wird.
Die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe haben bereits alle Weiterbildungsbefugten aufgefordert, Stellungnahmen zur Sicherstellung der Inhalte ihrer Befugnisse abzugeben. Unstrittig ist, dass die fachärztliche Ausbildung an vielen Einrichtungen in der bisherigen Form nicht fortgeführt werden kann. Die Weiterbildung in der speziellen Viszeralchirurgie muss an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass – angestoßen durch die Bundesärztekammer – neue Weiterbildungsinhalte definiert werden.
Darüber hinaus werden Kliniken ihre Weiterbildung künftig vermehrt in kooperativen Strukturen anbieten müssen. Für Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten bedeutet dies, dass sie – mit wenigen Ausnahmen – ihre gesamte Weiterbildung nicht mehr an einer einzigen Klinik absolvieren können. Die notwendigen Rahmenbedingungen dafür, insbesondere Finanzierung und Organisation, sind derzeit jedoch noch ungeklärt.
Standorte, die Leistungsgruppen verloren haben, befürchten zudem erhebliche Reputationsverluste bei der Rekrutierung ärztlichen Nachwuchses in einem ohnehin stark kompetitiven Umfeld. Um hier schnell Klarheit zu schaffen, ist eine verbindliche Abstimmung zwischen Ärztekammern und Gesetzgebern dringend erforderlich. Nur so können Unsicherheiten in der Weiterbildungsordnung zeitnah beseitigt werden.
Fazit
Die Umsetzung des NRW-Krankenhausplans markiert einen historischen Einschnitt in der stationären Versorgung. Positiv ist die konsequente Orientierung an Fallzahlen und die damit verbundene Bündelung komplexer Eingriffe.
Kritisch bleibt jedoch:
- die geringe finanzielle Unterstützung für die Umstrukturierung,
- regionale Ungleichheiten in der Zuteilung und
- das Fehlen von systematischen Outcome-Daten.

Prof. Dr. med. Florian Gebauer
Direktor des Chirurgischen Zentrums
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und onkologische Chirurgie
Helios Universitätsklinikum Wuppertal
Lehrstuhl für Chirurgie II an der Universität Witten/Herdecke

Prof. Dr. med. Daniel Vallböhmer
Leiter BDC-Themen-Referat „Krankenhausstrukturen, sektorenübergreifende Versorgung und Nachhaltigkeit“
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH
Chirurgie
Gebauer F, Vallböhmer D: Umsetzung des Krankenhausplans in NRW – Lehren für die Chirurgie. Passion Chirurgie. 2025 Oktober; 15(10): Artikel 03_0X.
Mehr zur Krankenhausreform lesen Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Politik.
Weitere aktuelle Artikel
01.04.2025 Politik
Einführung der Hybrid-DRGs – Erfolge und Fallstricke aus Sicht der Kliniken
Eine Analyse der EU-Kommission aus dem Jahre 2019 bescheinigt dem deutschen Gesundheitswesen, dass die Pro-Kopf-Ausgabe für die Versorgung eines Patienten mit im Durchschnitt 4.300 € mehr als 1.400 € über dem EU-Durchschnitt liegt [1].
01.03.2025 Politik
Berufspolitik Aktuell: Immer wieder einmischen
Die Wahlen zum Deutschen Bundestag sind vorbei und hinterlassen das Bild einer tief gespaltenen Gesellschaft mit teilweise unvereinbaren Positionen. Es wäre dringend geboten, jetzt wieder in einen sachorientierten gemeinsamen Diskurs einzutreten und nach einigenden Kompromissen zu suchen.
01.03.2025 Aus- & Weiterbildung
BDC-Praxistest: Erfolgreiches Ärzt:innen-Recruiting
Immer näher rückende Altersruhestände, eine steigende Abwanderung ins Ausland, begrenzte Ausbildungskapazitäten und sinkende Wochenarbeitsstunden – um nur einige Punkte zu nennen – setzen Krankenhäuser und Medizinische Versorgungszentren im Personalmanagement zunehmend unter Druck.
14.02.2025 Politik
Ärztinnen und Ärzte rufen zu demokratischem Engagement bei den Bundestagswahlen auf
Bitte unterschreiben Sie die Petition der Ärztinnen und Ärzte in Brandenburg
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.