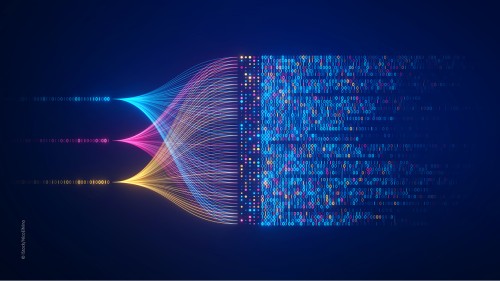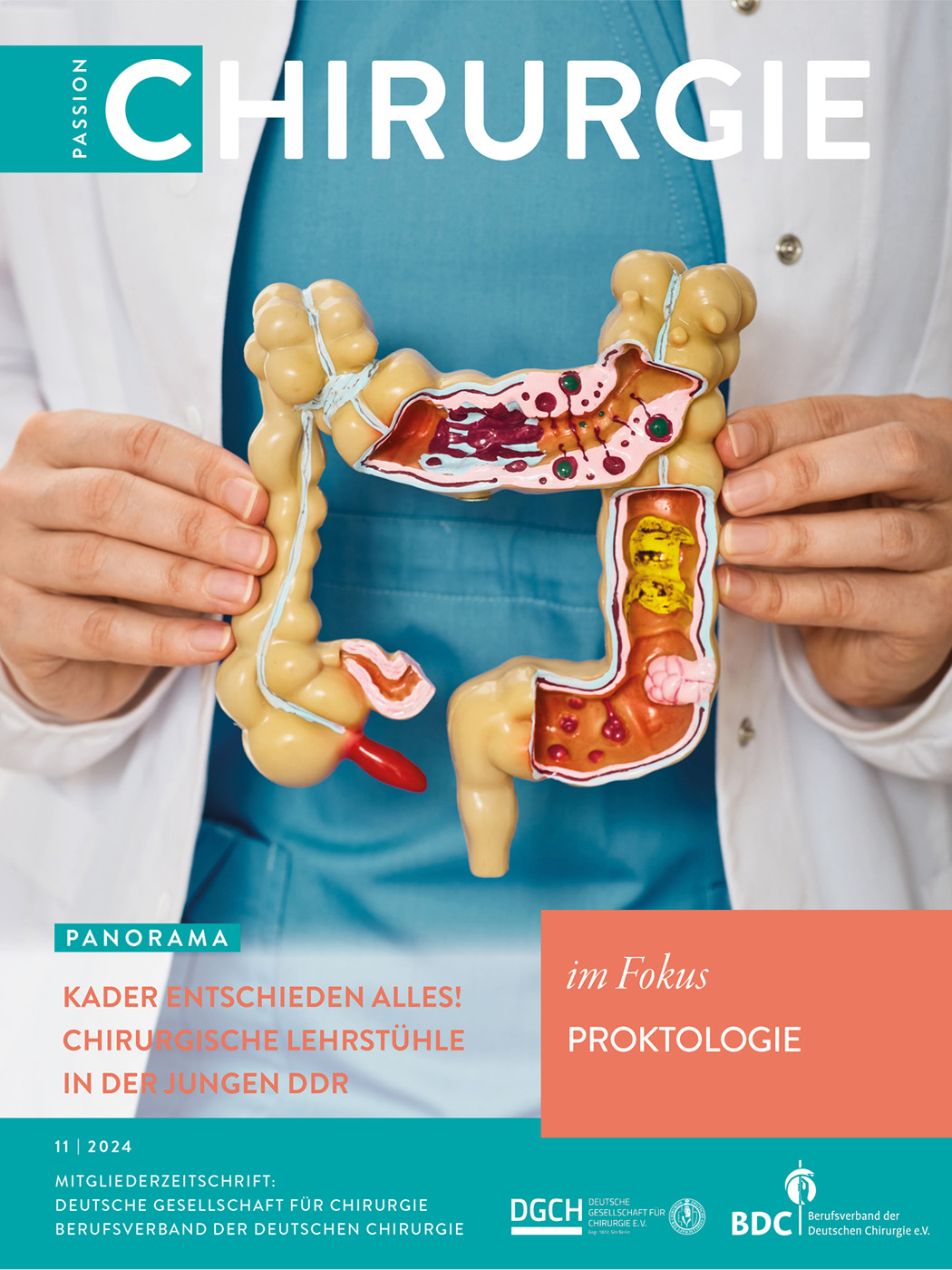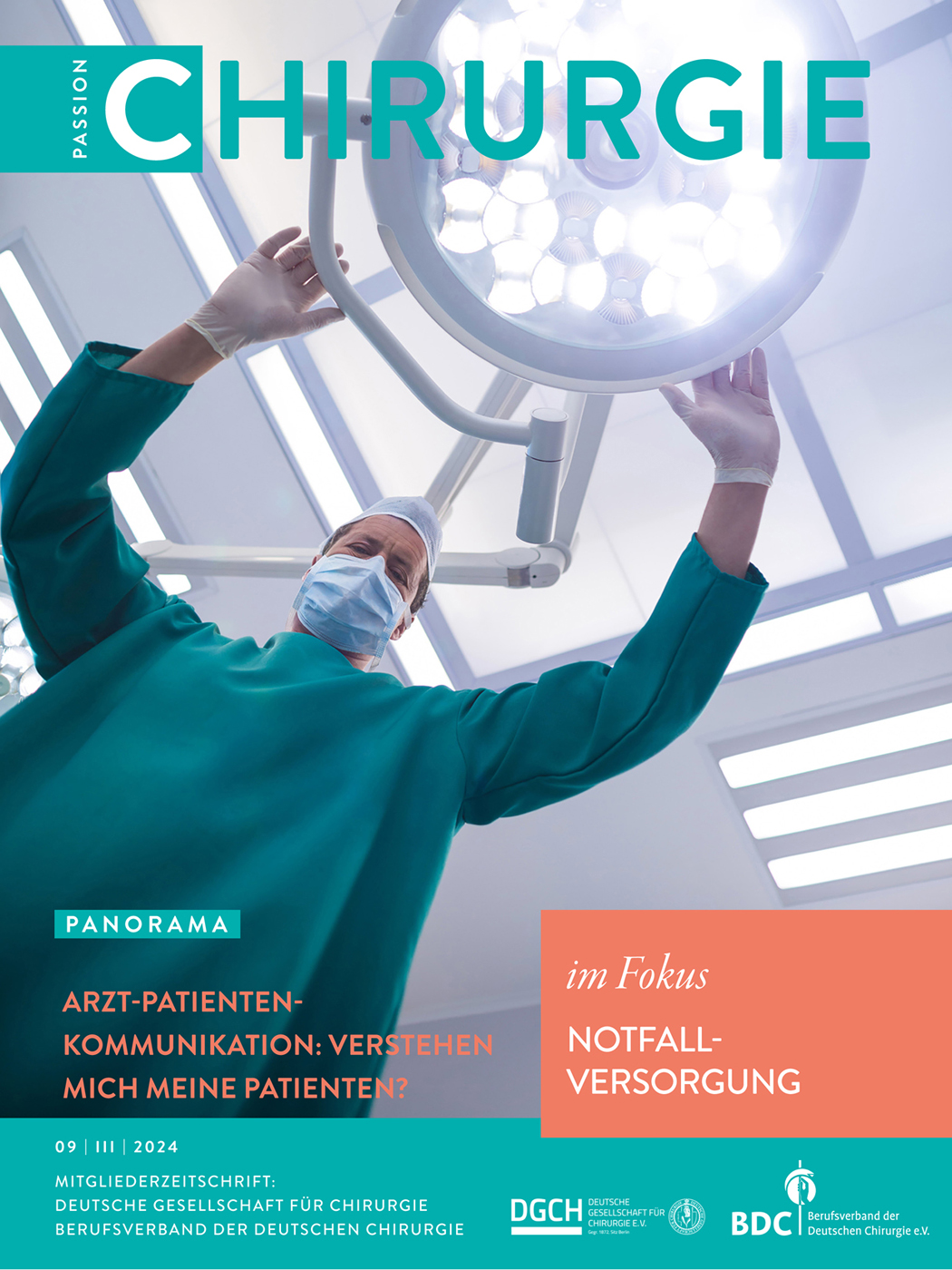01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI
KI in der Chirurgie aktiv mitgestalten
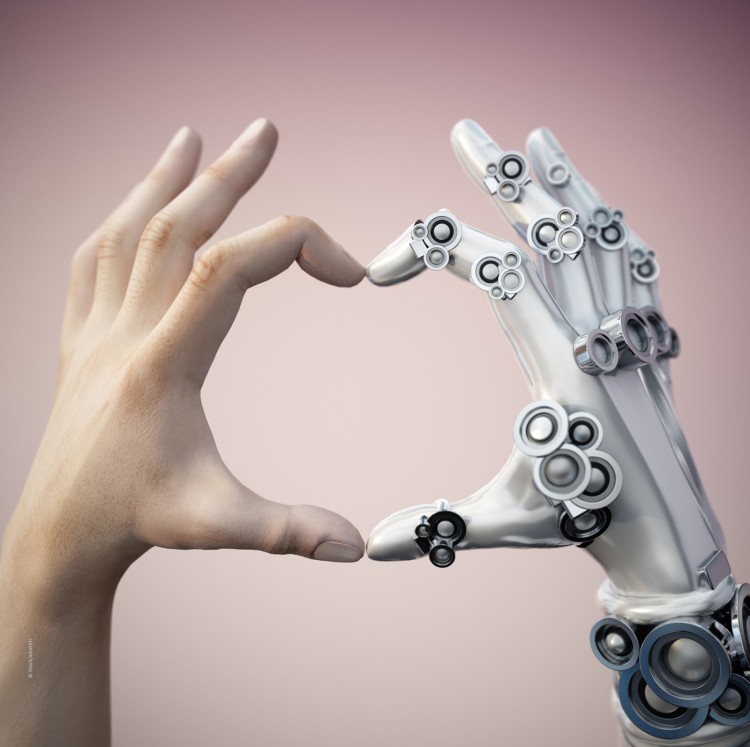
Johanna Ludwig ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat bereits mehr als zehn Jahre Erfahrungen in Kliniken gesammelt. Sie ist Mitgründerin eines Startups und war bereits parallel zur ärztlichen Tätigkeit als medizinische Beraterin in Digitalisierungsprojekten aktiv unter war sie die stellvertretende Leitung des Gutachtenboards Medizin im Trusted Health Projekt der Bertelsmann Stiftung. Gerade war sie an der Harvard Medical School und hat das Zertifikat „Leading AI Innovation in Health Care“ erworben. Das Interview führte Olivia Päßler vom BDC.
Olivia Päßler: Wie kann KI helfen, Ärztinnen und Ärzten wieder mehr Zeit für den Kontakt zu ihren Patienten zu geben? Welche Bedingungen hinsichtlich Datenschutz müssen hierfür gegeben sein?
Johanna Ludwig (JL): Als Chirurgin weiß ich: Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen im Klinikalltag. Wenn KI uns ermöglicht, bürokratische Lasten wie Dokumentation oder OP-Berichte zu automatisieren, dann gewinnen wir genau die Zeit zurück, die wir für das brauchen, was uns ausmacht – den direkten, empathischen Kontakt zu unseren Patientinnen und Patienten. Der „salutogene Effekt“ der Arzt-Patienten-Beziehung ist in der Chirurgie greifbar: Eine gute Ärztinnen-Patienten-Beziehung ist wichtig für ein gutes Outcome.
Dafür brauchen wir europäische Lösungen, die auf hohen Datenschutzstandards basieren. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Vertrauen – in die Systeme, aber auch in unseren Umgang mit Patientendaten. Wenn wir eigene Standards setzen, zeigen wir: Digitale Innovation geht auch verantwortungsvoll. Gleichzeitig ist es essentiell, dass wir eine möglichst sichere Alternative anbieten, um die Nutzung niederschwellig zu ermöglichen. Tun wir das nicht, werden die Daten in ChatGPT und co. landen.
Was verstehen wir unter Präzisions- bzw. individueller Medizin durch KI und wie sieht diese in der Chirurgie aus?
JL: Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) und Metaanalysen sind der Goldstandard der evidenzbasierten Medizin – und auch in der Chirurgie die Basis vieler Leitlinien. Sie liefern uns eine robuste Datengrundlage für Entscheidungen. Doch wenn wir wirklich jedem Menschen die individuell bestmögliche Therapie ermöglichen wollen, stoßen diese Systeme an ihre Grenzen. Denn RCTs geben uns gute Antworten auf die Frage: „Was wirkt im Durchschnitt für die Gruppe, die diese Einschlusskriterien erfüllt?“ Präzisionsmedizin fragt aber: „Was ist das Beste – für genau diesen Menschen, genau jetzt?“.
Dazu brauchen wir mehr, präzisere, personenbezogene Daten – vielleicht auch Daten, die wir aktuell noch nicht in Studien bewiesen und untersucht haben. Hier kommt das Konzept der digitalen Zwillinge ins Spiel: also virtuelle Abbilder realer Patient:innen, die mit deren individuellen Gesundheitsdaten gespeist werden – z. B. Vitalwerte, genetische Profile, Vorerkrankungen, Bildgebung und OP-Verläufe. KI kann auf Basis solcher Zwillinge hypothetische Behandlungspfade simulieren und deren Folgen abschätzen.
Ein konkretes Beispiel aus der Unfallchirurgie: Nehmen wir eine 60-jährige Patientin mit einer komplexen Sprunggelenkfraktur. Heute entscheiden wir oft basierend auf Erfahrung:
- Wieviele Schrauben setzen wir?
- Wie lange muss sie das Bein entlasten?
- Braucht sie eine zusätzliche medikamentöse Behandlung, Knochendichtemessung oder anderes?
Ein digitaler Zwilling könnte uns helfen, all diese Fragen individuell zu beantworten – basierend auf ihrem Alter, der Knochenqualität aus der Bildgebung, ihren Komorbiditäten (z. B. Diabetes, Osteoporose), dem genauen Frakturtyp und der Lebenssituation, vielleicht sogar dem Wohnort der Patientin (Stichwort „Social determinans of Health“).
Statt einer Entscheidung, die auf meiner Erfahrung basiert, bekäme ich eine unterstützende Empfehlung – wie eine unkomplizierte Zweitmeinung mit einer Empfehlung meines operativen Plans. Im Anschluss bekäme sie einen personalisierten Rehabilitationsplan – vielleicht mit einer früheren Teilbelastung, angepasster Implantatwahl oder einem gezielten Physiotherapie-Protokoll. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, für einfache Nachfragen einen KI-Assistenten zur Verfügung zu stellen, damit diese jederzeit beantwortet werden können, für eine bessere Patientenedukation und Selbstwirksamkeit.
Das Ziel der Präzisionsmedizin in der Chirurgie ist nicht die Ersetzung von ärztlicher Erfahrung – sondern ihre Ergänzung durch datenbasierte Präzision. Und genau das sollte uns als Ärztinnen und Ärzte motivieren, uns aktiv mit KI auseinanderzusetzen. Denn je besser wir verstehen, was technisch möglich ist, desto gezielter können wir es im Sinne unserer Patient:innen einsetzen.
In welche drei Bereiche kann die Unterstützung durch KI in der Medizin eingeteilt werden?
JL: 1. KI in der direkten Patientenversorgung
- Intraoperative KI-Assistenz: KI-Systeme können während einer Operation die Bildgebung in Echtzeit analysieren. Beispielsweise können sie Tumorgrenzen oder kritische Gefäße in Echtzeit markieren, um dem Chirurgen eine „zweite Meinung“ zu geben. Dies erhöht die Präzision und minimiert das Risiko, gesundes Gewebe zu beschädigen. Ein Beispiel hierfür ist die KI-gestützte Fluoreszenz-Chirurgie, die kleinste Tumorresiduen sichtbar macht, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen wären.
- Prädiktive Analysen: KI-Modelle können große Mengen an Patientendaten (Laborwerte, Vitalzeichen, Bildgebungsbefunde) analysieren, um das individuelle Risiko für postoperative Komplikationen wie Infektionen oder Sepsis vorherzusagen. Diese Frühwarnsysteme alarmieren das Team, sodass präventive Maßnahmen ergriffen werden können, bevor eine Krise eintritt.
2. KI zur Steigerung der Bevölkerungsgesundheit
- Daten zeigen, dass viele Personen nicht wissen, wer ihr richtiger Ansprechpartner in mit einem Symptom ist. Patient:innen die in Notaufnahmen gehen, obwohl sie keine notfallmäßige Behandlung brauchen, sind das beste Beispiel. KI kann unterstützen Patient:innen zum richtigen Arzt und zur richtigen Ärztin zu bringen und dadurch unsere Ressourcen schonen.
- Personalisierte Prävention: Durch die Analyse von genetischen Daten, Lebensstil-Faktoren und Krankengeschichte kann KI das Risiko einer Person für bestimmte chirurgisch relevante Erkrankungen, wie beispielsweise Darmkrebs, bewerten. Auf dieser Basis können personalisierte Empfehlungssysteme entwickelt werden, die den Patienten zu einem früheren Screening oder zu bestimmten präventiven Maßnahmen motivieren. Das ist heute schon möglich. Unsere Herausforderung besteht jetzt darin, wie wir mit diesem Wissen umgehen.
3. KI zum Selbstmanagement
- Smarte Nachsorge-Systeme: Nach einer Operation kann eine KI-basierte App den Genesungsprozess überwachen. Durch die Analyse von Eingaben des Patienten (Schmerzlevel, Bewegungsumfang) und Daten von Wearables (Schrittzahl, Schlaf) kann die App personalisierte Rückmeldungen geben. Sie könnte beispielsweise vorschlagen, die Intensität der Übungen zu steigern oder bei Abweichungen vom normalen Heilungsverlauf eine Warnung an das Behandlungsteam senden.
- Virtuelle Therapie-Assistenten: KI-gestützte Chatbots oder virtuelle Assistenten könnten Patienten in der Nachsorge anleiten und motivieren. Sie könnten Fragen zur Wundpflegebeantwortung, an Medikamenteneinnahmen erinnern oder Übungen erklären. Ein solcher Assistent könnte die Patientenversorgung außerhalb der Klinik ergänzen und sicherstellen, dass Patienten die Nachsorgeanweisungen korrekt befolgen.
Die Integration dieser KI-Systeme wird die Chirurgie von einer reinen Behandlungsmethode zu einem proaktiven, datengetriebenen Fachgebiet weiterentwickeln, das die gesamte Gesundheitslandschaft beeinflusst. Wir sollten es als weitere Technik sehen, die uns unterstütz noch bessere Ergebnisse zu erzielen.
Worauf sollten sich Chirurginnen und Chirurgen bezüglich des Einzugs von KI in ihr Fachgebiet einstellen?
JL: Chirurgie ist längst Hightech-Medizin. Wir arbeiten mit Robotik, 3D-Bildgebung, Navigation – warum also nicht auch mit Künstlicher Intelligenz? Ich bin überzeugt: KI-Kompetenz gehört fest in die medizinische Ausbildung und chirurgische Weiterbildung. Und das muss nicht kompliziert sein. Wichtig ist, dass die Angebote niedrigschwellig und praxisnah sind – damit auch Kolleg:innen im Klinikalltag einfach einsteigen können. Wir brauchen kein Informatikstudium, sondern ein gutes Verständnis:
- Wie funktioniert KI in der Medizin?
- Wo liegen ihre Stärken – und ihre Grenzen?
- Wie kann ich sie sinnvoll im OP, in der Nachsorge oder in der Planung einsetzen?
- Wann sollte ich auch die KI hinterfragen?
Wenn wir als Fachärztinnen und -ärzte verstehen, was technisch möglich ist, können wir es gezielt und verantwortungsvoll einsetzen – zum Nutzen unserer Patient:innen und zur Entlastung unseres Alltags. KI ist keine Zukunftsmusik mehr. Sie ist da – und wir sollten aktiv mitgestalten, statt abzuwarten.
Wie sollte sich die Arbeit mit KI im Weiterbildungscurriculum widerspiegeln?
JL: Aktuell ist es so zumindest in der Ärztekammer Berlin so: Im chirurgischen Weiterbildungscurriculum sind generell keine Pflichtkurse vorgesehen – dann wird es das auch nicht für Künstliche Intelligenz geben. Wenn wir wollen, dass KI-Wissen dort vermittelt wird, müssen wir einen anderen Weg gehen: über niedrigschwellige, praxisnahe und freiwillige Angebote, die trotzdem gut erreichbar und relevant sind.
Und wir müssen bei denen anfangen, die weiterbilden: Wenn wir von Weiterbildungsbefugten verlangen, KI-Kompetenz weiterzugeben, müssen wir ihnen zuerst ermöglichen, selbst Wissen aufzubauen – durch Fortbildungen, Peer-Learning, praxisnahe Tools und den Austausch mit anderen Disziplinen.
Was wir brauchen, ist:
- Raum für Diskussion und kritische Reflexion
- Best-Practice-Beispiele aus dem klinischen Alltag
- Formate, die in den vollen Arbeitsalltag passen – kurz, konkret, anwendbar
Wenn klar wird, dass KI uns ganz konkret hilft – z. B. bei der automatischen Arztbriefschreibung, Befund-und OP-Dokumentation, der Befundanalyse oder der Strukturierung von Nachsorge – dann wird auch die Akzeptanz steigen. Weil wir Zeit zurückgewinnen, Qualität steigern und uns auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: die Arbeit am Menschen.
Wie bei allen Innovationen gilt: Es wird Kolleg:innen geben, die begeistert sind – und solche, die skeptisch bleiben. Beides ist in Ordnung und eine normale Reaktion, wie beschrieben in der „Diffusion of Innovation“. Wichtig ist, gute Informationen zugänglich zu machen. Nur wer versteht, wie KI funktioniert, wo sie sinnvoll ist und wo ihre Grenzen liegen, kann fundiert entscheiden – und Verantwortung übernehmen.KI kann ein starkes Werkzeug sein. Aber sie bleibt ein Werkzeug. Deshalb müssen wir auch wissen, wann wir ihr widersprechen sollten.
Wo spielt der Mensch noch eine entscheidende Rolle, die KI nicht ersetzen kann?
JL: Kein Algorithmus der Welt wird einem Patienten die Angst vor einer Operation nehmen. Denn in diesem Moment wollen wir eine Person, der wir vertrauen können. Kein System ersetzt die beruhigende Hand vor der Narkose oder das Gespräch mit Angehörigen nach dem Eingriff.
KI hilft uns, präziser zu operieren, besser zu planen und Komplikationen früher zu erkennen. Aber Empathie, ethische Entscheidungen und Verantwortung – die bleiben beim Menschen. Deshalb müssen wir die Gestaltung der Digitalisierung aktiv in die Hand nehmen – und nicht auf Lösungen aus anderen Regionen warten, deren Standards nicht zu unserem System passen.
Ludwig J: KI in der Chirurgie aktiv mitgestalten. Passion Chirurgie. 2025 November; 15(11): Artikel 03_03.
Autor:innen des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
01.03.2024 Digitalisierung
Künstliche Intelligenz, Computer Vision und Bildgebung in der Unfallchirurgie
Kaum ein Fach ist in Diagnostik und Verlaufsbeurteilung so sehr abhängig von bildgebenden Verfahren wie die Unfallchirurgie. Von Sonographie über konventionelles Röntgen, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) bis hin zu weiteren Spezialbildgebungen sind wir für eine hochaufgelöste Darstellung des Bewegungsapparats auf diese Verfahren angewiesen.
01.03.2024 Digitalisierung
KI-basierte Arztbrieferstellung– Entlastung für Ärztinnen und Ärzte durch generative Sprachmodelle
Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI) hat bereits seit Jahren in vielen Anwendungen Einzug in unseren Alltag gefunden. Gesichtserkennung beim Smartphone, Spracherkennung und -unterstützung bei Alexa und in modernen Fahrzeugen und diverse Assistenzsysteme beim Fahren sind Teil unseres Alltags geworden.
01.03.2024 Digitalisierung
Künstliche Intelligenz in der Viszeralchirurgie
„Anstatt die etwa 50 mehr oder weniger wahrscheinlichsten Ursachen für ein akutes Abdomen in Betracht zu ziehen, versucht die intelligente Chirurgin vielmehr, ein klinisches Muster zu erkennen und aus einem begrenzten Spektrum von Behandlungsoptionen eine zielführende Vorgehensweise zu wählen.“ So steht es zu lesen in einem weltweit bekannten Lehrbuch zum Thema Notfallchirurgie des Abdomens [1].
01.03.2022 Digitalisierung/Robotik/KI
Robotergestützte Telechirurgie – Anfänge und Perspektiven
Die Telechirurgie ist definiert als ein Operationsverfahren, bei dem Chirurg:innen von einem anderen Ort aus operieren als dem, an dem sich die Patient:innen im Operationssaal befinden. Die Durchführung von telechirurgischen Operationen in der Militärchirurgie war der ursprüngliche Anreiz zur Entwicklung von Mehrzweck-Robotiksystemen für die Chirurgie.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.