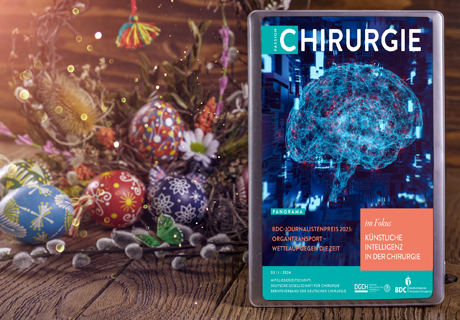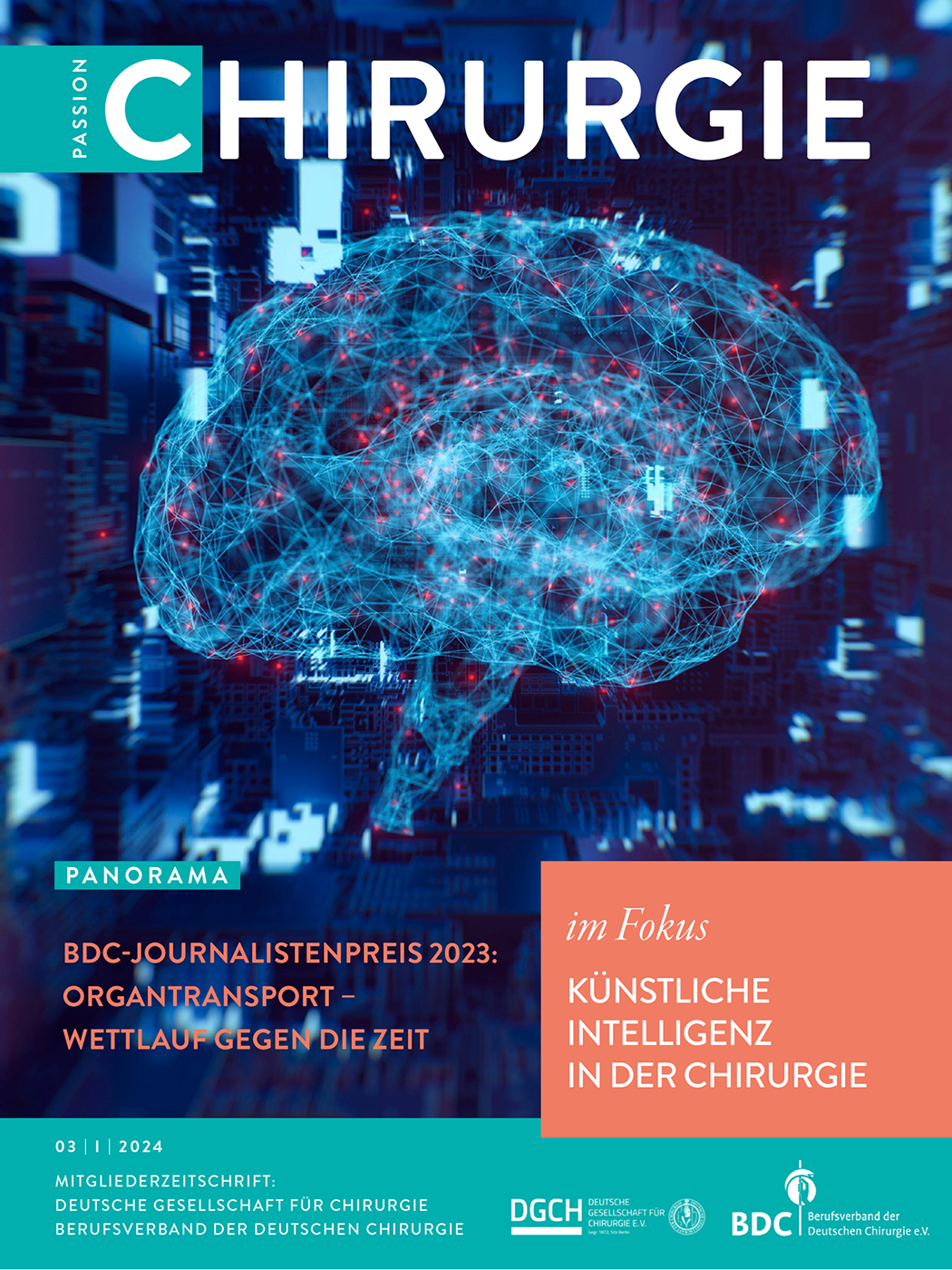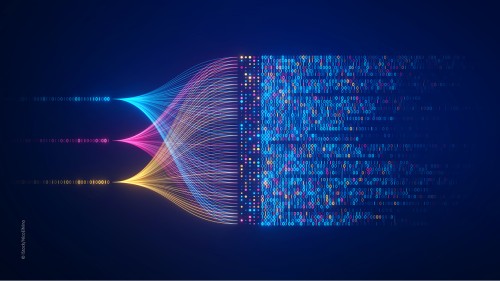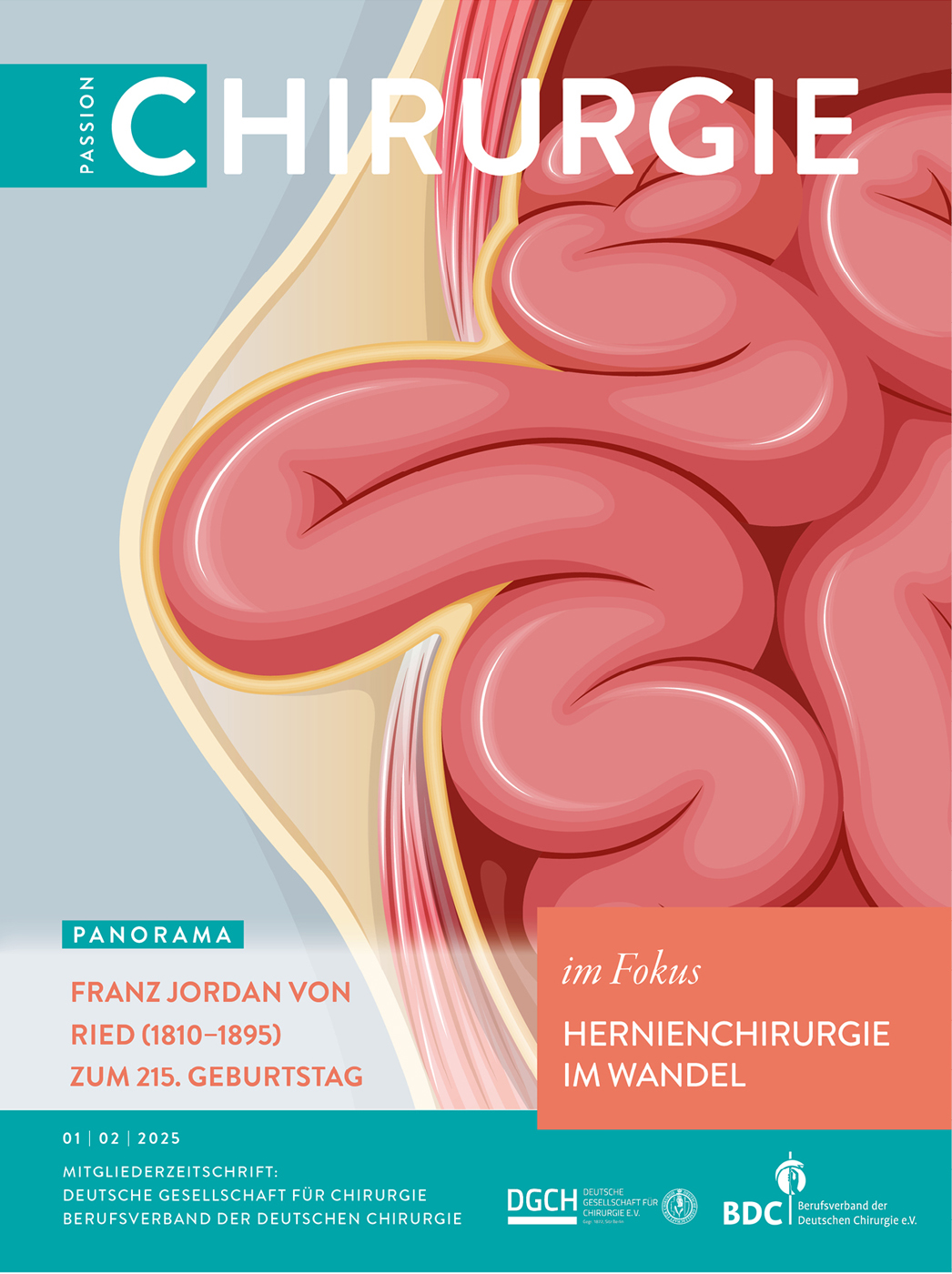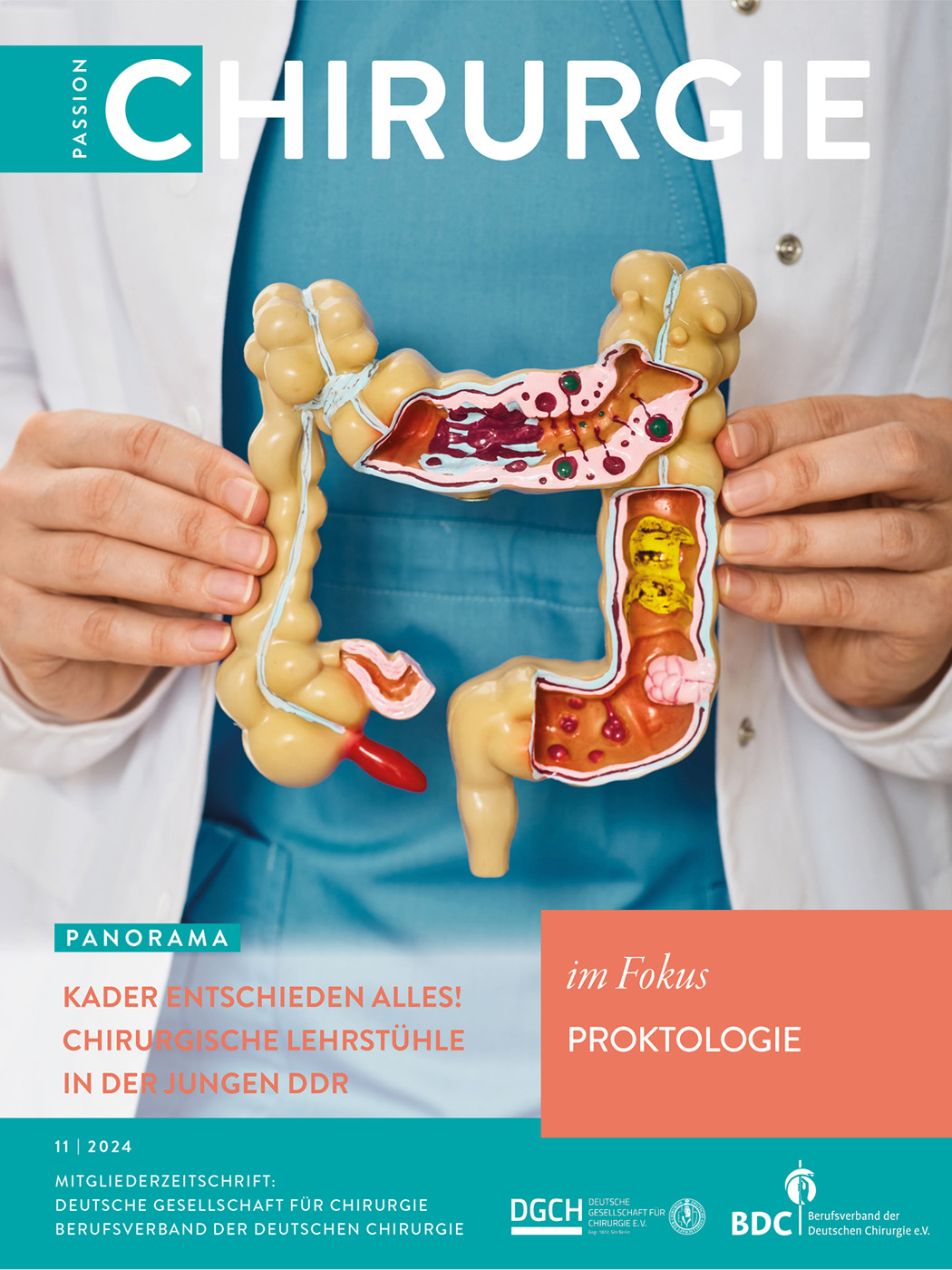01.11.2025 Digitalisierung/Robotik/KI
Die ePA – eine juristische Beurteilung

Dieser Beitrag befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der elektronischen Patientenakte und den hieraus erwachsenden Verantwortlichkeiten und Haftungsrisiken des Arztes.
Am 29. April 2025 erfolgte – etwas verzögert – der „Roll-out“ und somit die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) für alle Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser. Seit dem 01. Oktober 2025 ist die Nutzung der ePA für Gesundheitseinrichtungen in Deutschland verpflichtend.
Nach Auskunft der Techniker Krankenkasse (TK) als größter deutschen Krankenkasse mit 12,1 Mio. Versicherten nutzen aktuell rund 800.000 TK-Versicherte die ePA aktiv, jede Woche loggen sich etwa 100.000 Versicherte in die Akte ein, in der Regel natürlich im Krankheitsfall oder vor einem Arztbesuch.
Unbestreitbar hat die ePA somit bereits jetzt eine ganz erhebliche Praxisrelevanz, die auch in Zukunft zunehmen wird. Seitens der Ärzteschaft knüpfen sich dementsprechend große Hoffnungen an die ePA. Ob in einem Notfall, bei Demenz-Patienten oder auch im Praxisalltag zur schnellen Übersicht kann es enorm hilfreich sein, auf einen Gesamtüberblick zugreifen zu können. Andererseits bestehen im Hinblick auf möglichen Haftungsrisiken erhebliche Unsicherheiten, zumal es an klärenden gesetzlichen Grundlagen und bisher auch an jeglicher Rechtsprechung hierzu fehlt.
Abrechenbarkeit
Ärzte und Psychotherapeuten können nach Auskunft der Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) die außerbudgetär bezahlten Pauschalen für die Befüllung der ePA jedenfalls bis Ende 2025 weiterhin abrechnen. Der Bewertungsausschuss habe die Prüffrist für die bestehenden ePA-Leistungen entsprechend verschoben.
Aktuell gibt es drei Gebührenordnungspositionen für das Hochladen von Dokumenten:
- Die GOP 01648 ist aktuell mit 11,03 Euro bewertet und kann abgerechnet werden, wenn die ePA noch keinerlei Daten enthält und z. B. zum ersten Mal ein Arztbrief oder Befundbericht eingestellt wird. Diese GOP kann sektorübergreifend nur einmal je Patient abgerechnet werden.
- Eine weitere Befüllung danach kann nur noch mit der EBM-Ziffer 01647 abgerechnet werden, die mit 1,86 Euro bewertet ist. Sie wird als Zuschlag zur Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale extrabudgetär gezahlt und ist einmal im Behandlungsfall berechnungsfähig.
- Ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt und ohne Arzt-Patienten-Kontakt per Video bringt die Befüllung gem. Ziffer 01431 nur 37 Cent, sie ist bis zu viermal im Arztfall berechnungsfähig.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Den hohen Erwartungen an die ePA und deren praktischen Nutzen für Ärzte und Patienten steht die Tatsache gegenüber, dass sie als rein freiwillige Zusatzoption für den Patienten ausgestaltet ist und keine zusätzlichen Dokumentationsanforderungen an die behandelnden Ärzte bringen soll. So regelt der § 341 Abs. 1 SGB V in den Sätzen 2 und 3 ausdrücklich: „Die Nutzung ist für die Versicherten freiwillig. Mit ihr sollen den Versicherten Informationen, insbesondere zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen sowie zu Behandlungsberichten, für eine einrichtungs-, fach- und sektorenübergreifende Nutzung für Zwecke der Gesundheitsversorgung, insbesondere zur gezielten Unterstützung von Anamnese, Befunderhebung und Behandlung, barrierefrei elektronisch bereitgestellt werden.“
Hieraus lässt sich folgern:
- Die ePA ist weder ein Ersatz noch eine verpflichtende Ergänzung für die primäre Behandlungsdokumentation des Arztes, sodass der Arzt neben der ePA weiterhin zur Führung einer eigenständigen Behandlungsdokumentation nach § 630f des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verpflichtet ist. Die ePA kann demnach auch keinen vergleichbaren Beweiswert für den Behandlungsverlauf haben.
- Die ePA ist kein Ersatz für die Kommunikation mit dem Patienten oder vor-, weiter- und nachbehandelnder Ärzte, sodass nach wie vor das persönliche Anamnesegespräch, die Untersuchung des Patienten und die Heranziehung sowie Übermittlung von Befunden oder Arztbriefen von oder an andere Ärzte für die Behandlung maßgeblich sind. Befundberichte, Arztbriefe etc. können lediglich zusätzlich in der ePA gespeichert werden.
- Die ePA ist keinesfalls sicher vollständig. Der Patient kann nicht nur der ePA selbst, sondern auch durch die opt-out-Regelung der Befüllung mit bestimmten Inhalten, einzelnen Arztbriefen, Befundberichten etc. widersprechen. Er kann auch der Nutzung durch bestimmte Gesundheitseinrichtungen widersprechen. Sogar ausdrücklich zustimmen muss er in die Einstellung von Ergebnissen von genetischen Untersuchungen.
Die Ausübung dieser Widerspruchs- und Zustimmungsrechte ist unbedingt nachprüfbar in der Behandlungsdokumentation zu protokollieren (so auch geregelt in den §§ 347 Abs. 3 Satz 3 und § 347 Abs. 1 Satz 5 SGB V). Ausreichend wird hier allerdings der reine Vermerk sein, dass der Patient sein Widerspruchsrecht ausgeübt hat.
In der ePA ist ein Zugriffszeitraum von 90 Tagen ab Einlesen der Karte voreingestellt. Der Arzt oder Psychotherapeut hat mithin die Möglichkeit, die Behandlungsdaten innerhalb dieser 90 Tage in die ePA einzustellen. Allerdings ist er natürlich gehalten, die Relevanz der betreffenden Daten für die weitere Versorgung zu berücksichtigen. Eben solche, in ihren Konsequenzen weder gesetzlich geregelte noch von der Rechtsprechung bisher behandelte Gegebenheiten eröffnen denkbare Haftungszenarien. Dies insbesondere bei besonderen Fallkonstellationen, wenn beispielsweise die Information über die schwere Unverträglichkeit eines zu Behandlungszwecken eingesetzten Präparates nicht eingetragen wurde und es zu Patientenschäden kommt.
Die Befüllung der ePA ist allerdings primär hausärztliche Aufgabe. Für die Chirurgie kann sich aus ihr ein großer Vorteil für die Operationsvorbereitung ergeben, wenn alle Erkrankungen, eventuelle Allergien und die Medikation aktuell und verlässlich aufgeführt sind. Mit Implementierung der Anwendung (MIO) Impfpass ist auch die in unfallchirurgischen Praxen und Krankenhausnotaufnahmen täglich mehrfach gestellte Frage nach dem Tetanusimpfschutz erleichtert.
Haftungsrisiken, Datenschutz
Kann sich also der Arzt trotz der klar geregelten Freiwilligkeit, der Widerspruchsrechte und der ausdrücklich geplanten Vermeidung zusätzlicher Dokumentationspflichten für den Behandler auf die Vollständigkeit verlassen? Führt eine teilweise Nichtbefüllung ggf. zur Haftung? Führt andererseits eine Nichtbeachtung bestimmter Inhalte im Schadenseintritt zur Haftung?
a) Befüllungspflichten
§ 347 Abs. 1 und 2 SGB V statuieren für Vertragsärzte eine Befüllungspflicht der ePA mit bestimmten medizinischen Daten. Die Befüllungspflicht besteht aber wie dargelegt nur, wenn diese Daten bei der konkreten aktuellen Behandlung selbst vom Arzt erhoben wurden, die Daten elektronisch vorhanden sind bzw. elektronisch verarbeitet werden und der Patient dem Zugriff des Arztes und dem Einstellen der Daten nicht widerspricht.
Zudem besteht eine Befüllungspflicht für weitere bestimmte medizinische Daten gemäß § 347 Abs. 4, 5 SGB V, wenn der Patient deren Einstellung verlangt. Für Krankenhäuser trifft § 348 SGB V die entsprechenden Regelungen.
Es entstehen deshalb -entgegen häufiger Verlautbarungen- nach diesseitiger Auffassung eben doch zusätzliche Pflichten des Arztes im Umgang mit der ePA und in der Folge kann bei einer Verletzung der Befüllungspflicht mit einer unmittelbar kausalen Schadensfolge eine ärztliche Sorgfaltspflichtverletzung vorliegen, die in bestimmten Konstellationen zur Haftung führen kann. Denkbar wäre dies etwa, wenn der Hausarzt in Kenntnis einer anstehenden OP den Hinweis auf eine bestehende und für den Operateur relevante Medikamenten- Narkose- oder Kontrastmittelunverträglichkeit unterlässt.
b) Einsichtnahmepflichten
Dieser Erkenntnis schließt sich die unmittelbare Frage nach einer Einsichtnahmepflicht an. Zunächst gilt: Die ePA ist eine reine Ergänzung für anlassbezogenes, gezieltes Nachschauen und eben gerade kein Automatismus. Entscheidend ist nach wie vor das anamnestische Gespräch als Basis für ärztliches Handeln. Die ePA ist insofern als rein ergänzendes „Kommunikationsmittel“ zu verstehen und mithin als zusätzliche Möglichkeit, um an Informationen zu kommen, nicht als Informationsquelle, die stets regelhaft zu nutzen wäre. Die ePA ist also für den weiterbehandelnden Arzt dazu da, um nur dann gezielt nachzuschauen, wenn es auch einen konkreten Anlass gibt.
Sowohl eine Einsichtnahmepflicht als auch die sich aus einer Verletzung dieser Pflicht ergebenden Haftungsrisiken sind deshalb aus unserer Sicht nur extrem begrenzt vorhanden. Als Beispiel könnte etwa das Unterlassen der Prüfung der Medikationsliste vor einer OP beim dementen Patienten trotz objektiver Möglichkeit zur Einsichtnahme gelten.
Zu beachten ist aber auch, dass diese -begrenzten- Haftungsrisiken letztlich die zwingende Kehrseite der hinreichenden Verlässlichkeit und praktischen Nutzbarkeit der ePA sind. Ohne diese Verlässlichkeit, die es ohne hinreichende verbindliche Vorgaben kaum geben kann, würde der Nutzen der ePA ausgehöhlt und der alltägliche Nutzen sich kaum bewähren.
c) Datenschutz
Die Krankenkassen sind per Gesetz verpflichtet, ihre Versicherten vorab ausführlich über die ePA zu informieren und diese entsprechend einzurichten. Beauftragt wurde hierzu die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik). Sie ist somit im Auftrag der GKV verantwortlich für die TI im deutschen Gesundheitswesen. Dazu gehört auch die Einführung der ePA nach dem Opt-out-Verfahren. Hierzu schreibt die Firma gematik auf ihrer Homepage, die epA sei „so konzipiert, dass nur die Patientin bzw. der Patient selbst sowie das berechtigte medizinische Personal in die jeweilige ePA schauen kann. Ein Zugriff von Dritten (bspw. der Krankenkasse) wird mit technischen und organisatorischen Maßnahmen verhindert.“
Die behandelnden Ärzte sind hingegen weder „Sachbearbeiter“ der GKV, noch haben sie diesbezügliche Informationen des Patienten oder eine sonstige Gewährleistung des Datenschutzes übernommen. Ihre Verpflichtung beschränkt sich insofern auf die Verwendung des ePA-Moduls und des richtigen, mit der ePA kompatiblen PVS. Ergeben sich dann bei dieser korrekten Anwendung Sicherheitslücken, Hackerangriffe o. ä., kann dem Arzt kein Vorwurf bzgl. Verletzung des Datenschutzes gemacht werden. Er kann an die Krankenkasse des Patienten verweisen.
d) Sonstiges
Gem. § 341 Abs. 6 SGB V haben die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer gegenüber der jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen, dass sie über die für den Zugriff auf die elektronische Patientenakte erforderlichen Komponenten und Dienste verfügen. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist die Vergütung vertragsärztlicher Leistungen pauschal um 1 Prozent zu kürzen. Die Vergütung ist so lange zu kürzen, bis der Nachweis gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung erbracht ist. Diese Regelung gilt nunmehr nach KV-Verlautbarungen ab der Abrechnungsdatei für das vierte Quartal 2025.
Zunächst sollte zudem ab dem Roll-out ergänzend die Kürzung der TI-Pauschale um 50 % erfolgen, wenn die ePA 3.0 nicht installiert ist. Auch wegen Bereitstellungsverzögerungen wurde dies nicht vollzogen, es gilt nunmehr der 01.10.25 zzgl. einer möglichen dreimonatigen Übergangsphase, so dass in aller Regel die Reduzierung der TI-Pauschale durch die KVen erst zum 01. Januar 2026 umgesetzt werden wird.
Fazit
Den begrenzten Nachteilen, wie den angesprochenen Haftungsrisiken in Sonderfällen und dem – immerhin vergüteten – Verwaltungsaufwand sowie möglichen Risiken für die Patientendaten steht der große Nutzen der ePA für die zusätzliche Absicherung ärztlicher Maßnahmen gegenüber.
Dieser Nutzen bewährt sich insbesondere bei unverzüglichem Informationsbedarf, z. B. im Notfall und zur ergänzenden Absicherung des ananmnestischen Gesprächs in Bezug auf besonders wichtige Sachverhalte, wie z. B. einer Medikamentenunverträglichkeit.
Es ist deshalb zu hoffen, dass die zukünftige Rechtsprechung diese rein ergänzende, patientenbezogene Funktion der ePA in den Vordergrund stellt und deren Verwendung nicht durch überzogene Anforderungen an den behandelnden Arzt zum Risiko werden lässt.
Butzmann O: Die ePA – eine juristische Beurteilung. Passion Chirurgie. 2025 November; 15(11): Artikel 03_05.
Autor:in des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
15.03.2024 BDC|News
PASSION CHIRURGIE im März 2024
KI ist in aller Munde – wie weit sind wir denn damit in der Chirurgie? Was ist überhaupt möglich? In der Märzausgabe der PASSION beleuchten wir beispielhaft drei Themen aus diesem Bereich: Computer Vision und Bildgebung in der Unfallchirurgie, KI-basierte Arztbrieferstellung und KI-Umsetzungen in der Viszeralchirurgie.
01.03.2024 BDC|News
Editorial 03/QI/2024: Künstliche Intelligenz in der Chirurgie
Die künstliche Intelligenz (KI) bestimmt unseren Alltag mit und hält natürlich auch zunehmend Einzug in die Medizin und Chirurgie. Chatbots, wie beispielsweise ChatGPT, scheinen ungeahnte Vereinfachungen und Möglichkeiten zu bieten, aber die strukturierte Evaluierung des Nutzens in der Medizin steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Zudem sind ethische und strukturelle Voraussetzungen für die breite Anwendung im deutschen Gesundheitssystem noch nicht vorhanden.
01.03.2024 Digitalisierung
Künstliche Intelligenz, Computer Vision und Bildgebung in der Unfallchirurgie
Kaum ein Fach ist in Diagnostik und Verlaufsbeurteilung so sehr abhängig von bildgebenden Verfahren wie die Unfallchirurgie. Von Sonographie über konventionelles Röntgen, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) bis hin zu weiteren Spezialbildgebungen sind wir für eine hochaufgelöste Darstellung des Bewegungsapparats auf diese Verfahren angewiesen.
01.03.2024 Digitalisierung
KI-basierte Arztbrieferstellung– Entlastung für Ärztinnen und Ärzte durch generative Sprachmodelle
Künstliche Intelligenz (KI) oder Artificial Intelligence (AI) hat bereits seit Jahren in vielen Anwendungen Einzug in unseren Alltag gefunden. Gesichtserkennung beim Smartphone, Spracherkennung und -unterstützung bei Alexa und in modernen Fahrzeugen und diverse Assistenzsysteme beim Fahren sind Teil unseres Alltags geworden.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.