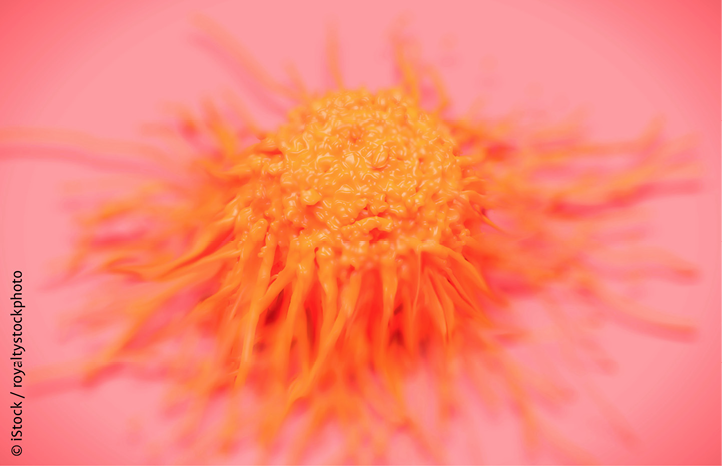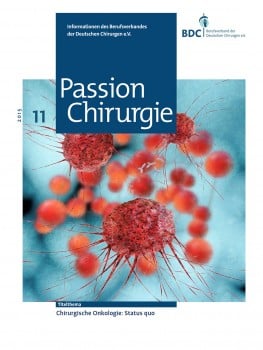Die Notwendigkeit einer Interdisziplinarität bei der Diagnostik und Therapie onkologischer Erkrankungen steht seit langer Zeit außer Frage.
Neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung, neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten sowie die Ergebnisse aus den klinischen Studien unterhalten eine lebhafte Dynamik bei der Indikationsstellung zu Prozeduren und bei den dabei begleitenden Behandlungsabläufen. Multimodale Therapiekonzepte müssen kontinuierlich hinterfragt werden und Leitlinien dementsprechend aktualisiert werden.
Lässt man die sehr wichtigen und notwendigen Studien aus der Grundlagenforschung, der Molekularbiologie, der Genforschung, der Immunologie zunächst außer Acht und betrachtet nur die klinischen Studien, so fällt eine übermächtige Dominanz der Medikamentenstudien und der strahlentherapeutischen Studien auf, chirurgisch induzierte onkologische Studien treten weit in den Hintergrund.
Damit entsteht die Frage, ob die onkologische Chirurgie ausreichend bei der Erarbeitung von multimodalen Konzepten berücksichtigt wird. Welchen Stellenwert besitzt überhaupt ein perfekt ausgeführter chirurgischer Eingriff in der Onkologie? Wie groß ist sein Einflussfaktor für den Krankheitsverlauf einer onkologischen Erkrankung?
Neben der Feststellung, dass mehr chirurgisch-induzierte Studien benötigt werden, damit der chirurgische Part auch adäquat bei den multimodalen Therapiekonzepten berücksichtigt werden kann, steht die Frage nach dem Studiendesign chirurgisch-onkologischer Studien. Wer sollte die Studien durchführen und auf welche chirurgische Qualifikationsebene sollten diese gestellt werden? Die Studienergebnisse werden dadurch zweifelsfrei ganz entscheidend beeinflusst. So ist es naheliegend, dass Schlussfolgerungen und die damit verbundenen Festlegungen erhebliche Auswirkungen auf die multimodalen Konzepte haben. Komplexe Eingriffe bedürfen chirurgischer Erfahrung sowie Training, zusammengefasst mit dem Begriff „Lernkurve“. Eine abgeschlossene Lernkurve sollte eigentlich Bedingung für die Teilnahme an einer Studie sein, die für die Erarbeitung einer Leitlinie oder bei der Erarbeitung multimodaler Konzepte zugrunde gelegt wird, andernfalls können Fehlinterpretationen und Verzerrungen der Ergebnisse resultieren.
Eine weitere Anforderung an eine künftige medizinische Forschung und damit auch insbesondere an klinische Studien besteht darin, dass nicht nur stärker der Aspekt Lebensqualität Beachtung finden muss, sondern dass Erfahrungen und Bedürfnisse von Patienten stärker in das Design und in die Interpretation der Studienergebnisse einfließen müssen. Das wird insbesondere dann erforderlich, wenn zwei oder mehrere Behandlungsmöglichkeiten miteinander verglichen werden sollen („Comparative Effectiveness Research“).
Das Stakeholder Involvement beinhaltet, dass die Betroffenen also die Patienten in die Fragestellungen bei klinischen Studien einbezogen werden. Es muss festgestellt werden, dass Fragestellungen und damit auch die Ergebnisse von klinischen Studien nicht immer mit den Bedürfnissen der Patienten korrelieren. Erhobene Ergebnisse von Studien haben mitunter nur einen erkenntnistheoretischen Wert, besitzen für die Patienten aber keinerlei Relevanz.
Durch die Anwendung des Prinzips „Stakeholder Involvement“ wird nicht nur die Mitbestimmung und die Transparenz für Patienten ermöglicht, sondern der Wert von klinischen Studien steigt durch eine verbesserte Umsetzbarkeit der Studienergebnisse. So könnte sich auch die Relevanz und die Qualität von klinischen Studien wesentlich verbessern.
Die subjektive Erfahrung mit einer Erkrankung und die den verbundenen Behandlungsverfahren erlebt nur der Patient selbst. So ist es wichtig, zukünftig mehr diesen subjektiven Faktor bei klinischen Studien zu berücksichtigen.
In Deutschland hat das „Stakeholder Involvement“ noch keinen breiten Eingang in die klinische Forschung und bei der Gestaltung von klinischen Studien gefunden.
Das Institut für komplementäre und integrative Medizin des Universitätsspitals Zürich befasst sich mittels des Stakeholder Involvement Prozesses mit der tumorassoziierten Fatigue, die für die Durchführbarkeit und den Erfolg von Tumorbehandlungen einen erheblichen Einfluss hat. In den USA existiert seit ca. 15 Jahren das „PCORI“ (Patient Centered Outcomes Research Institut). Dem Institut werden erhebliche Forschungsmittel zur Verfügung gestellt, damit das Stakeholder Involvement Eingang in die klinische Forschung findet und dort zukünftig fest mit verankert wird.
Das zentrale Instrument bei der Umsetzung der Interdisziplinarität bei der Behandlung von onkologischen Erkrankungen sind die sehr verbreiteten Tumorboards. Neben der hohen Bedeutung und den vielen Vorteilen für den onkologischen Patienten sind diese Tumorboards auch mit Nachteilen behaftet: Der Patient wird nur anhand seiner Befunde bewertet und damit Entscheidungen getroffen, der Patient selbst wird weder gesehen noch in die Entscheidung einbezogen. Es fehlt also der direkte Patientenkontakt, die individuelle Situation des Patienten kann nicht berücksichtigt werden und seine Position zu den Therapieempfehlungen ist zunächst nicht bekannt. Eine Einbeziehung des Stakeholder Involvements in die etablierten Entscheidungsprozesse würde die Nachteile dieser Boards reduzieren, zur Qualitätssteigerung und Erhöhung der Effektivität führen, ist aber aus heutiger Sicht eine logistische Herausforderung, schwierig umzusetzen und mit hohem Aufwand verbunden.