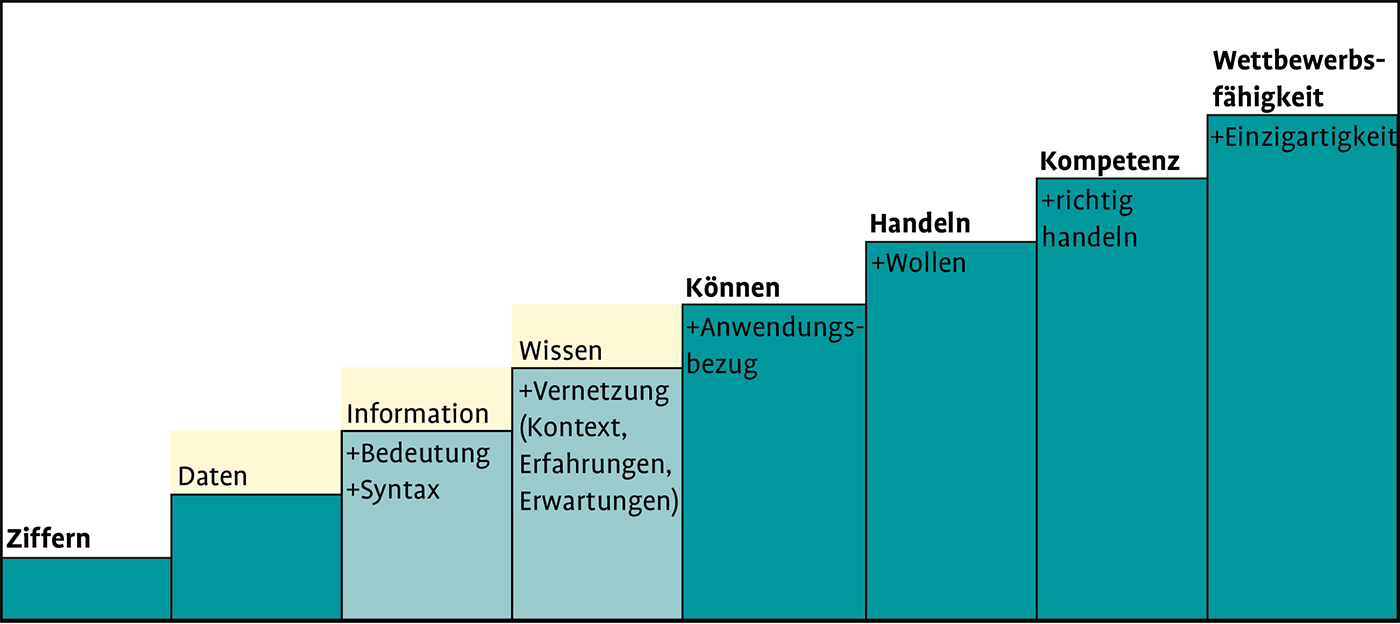Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MMK) finden seit Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Der Anteil an MMK in Allgemeinkrankhäusern ist in den letzten acht Jahren deutlich gestiegen.1 Das liegt zum einen daran, dass in der „Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung“ (QM-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Jahr 2016 die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen im Teil B § 1 Satz 6 QM-RL beispielhaft als Instrument des klinischen Risikomanagements aufgeführt werden, zu dessen Einführung die stationären Einrichtungen verpflichtet sind. Auch Ärztekammern und das Aktionsbündnis für Patientensicherheit empfehlen die Durchführung von MMKs. Zum anderen ist der Nachweis von MMKs zur Erlangung ausgewählter Zertifikate wie OnkoZert erforderlich.
Der Stellenwert der Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen begründet sich in ihrem Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit und Behandlungsqualität. In einer MMK werden Behandlungsverläufe reflektiert, sodass mögliche Abweichungen von etablierten Handlungsroutinen auffallen. Diese werden interdisziplinär besprochen, mit dem Ziel, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung abzuleiten. Damit wird die MMK zum Spiegelbild der gelebten Sicherheitskultur und einem Instrument des individuellen und organisationalen Lernens.
MMK-Leitfäden und ihre Durchdringung in der Praxis
Im deutschsprachigen Raum liegen verschiedene Leitfäden zur Methodik von MMKs vor, zum Beispiel von der Bundesärztekammer in Deutschland oder der Stiftung Patientensicherheit in der Schweiz. Mit Blick auf die Durchführung von MMKs fällt allerdings auf, dass knapp ein Viertel der MMKs ohne Struktur erfolgen, einige Gesundheitsunternehmen kein einheitliches Konzept haben und nur in etwa zwei Dritteln der Fälle ein berufsgruppenübergreifender Ansatz gewählt wird. Damit stellt sich die Frage nach der Qualität. Wenn MMKs allein dazu dienen, formale Anforderungen zu erfüllen, sind sie kein Ausdruck einer selbstkritischen und förderlichen Patientensicherheitskultur. Ihre Wirkung in dieser Hinsicht verpufft. Umso wichtiger ist die Rolle der Führungskräfte bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen.
Die Rolle der Führungskraft
Führungskräfte können aktiv Einfluss auf die Struktur einer MMK und darüber hinaus auf die Sicherheitskultur ihrer Abteilung nehmen und sie in ihrem Sinne weiterentwickeln. Folgende Fragestellungen helfen, eine MMK zu strukturieren, sodass sie ihr Ziel erfüllt, nämlich das individuelle und organisationale Lernen zu verbessern und damit auch die Patientensicherheit zu fördern.
1. Kommt es während einer MMK zu einem offenen Dialog der Anwesenden oder ist die Beteiligung gering und ein kontroverser Austausch entsteht nicht?
Im zweiten Fall könnten die Teilnehmenden Angst vor Restriktionen haben. Hier ist es Aufgabe der Führungskraft, ein Klima des offenen Dialogs zu schaffen, damit möglichst viele Mitarbeitende bereit sind, ihre Gedanken mit den Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Denn nur so werden verschiedene Perspektiven reflektiert, die letzten Endes zu einer Optimierung der Behandlung beitragen können.
2. Sind die Anwesenden bereit, mögliche Ursachen für den Outcome der Patientin bzw. des Patienten auch in der Organisation des Behandlungsablaufs zu sehen und zu diskutieren oder wird sich allein auf die medizinische Versorgung beschränkt?
Daran lässt sich erkennen, welches Verständnis die Mitarbeitenden von Fehlerentstehung in der Medizin haben. Die Mehrheit von Fehlern in der Patientenversorgung basiert nicht auf fachlichen Mängeln, sondern liegt in der Kommunikation und Organisation der Behandlung. Die Führungskraft sollte immer wieder auch dahingehende Fragen stellen, zumal die Organisation der Abteilung in ihrem Verantwortungsbereich liegt.
3. Möglicherweise werden Konflikte zwischen Berufsgruppen oder einzelnen Akteuren erkennbar. Können die Konfliktparteien konstruktiv zusammenarbeiten oder blockiert der Konflikt die weitere Zusammenarbeit und kann damit ursächlich für Patientenschäden werden?
Hier kann die Führungskraft möglichen Handlungsbedarf ableiten. Fachliche Kontroversen kann die Führungskraft in einer MMK durch die Erläuterung des aus ihrer Sicht besten Vorgehens lösen. Dadurch setzt sie den Mitarbeitenden einen Interpretationsspielraum, wie in solchen Fällen zu verfahren ist. Konflikte, die auf der Beziehungsebene liegen, können in einer MMK nicht geklärt werden. Treten sie zutage, sollte die Führungskraft prüfen, ob Handlungsbedarf besteht, der dann anderweitig realisiert wird.
4. Stellt sich heraus, dass Vorgaben bzw. definierte Behandlungsprozesse nicht eingehalten werden?
Die Führungskraft kann am dargestellten medizinischen Behandlungsverlauf erkennen, ob die von ihr gemachten Vorgaben von den Mitarbeitenden umgesetzt werden. Dies gibt Auskunft über deren Compliance und den Durchdringungsgrad in der Praxis. Sollten Vorgaben nicht eingehalten werden, ist zu eruieren, ob es sich um eine einmalige Abweichung oder um eine nicht erfüllbare Vorgabe handelt und Anpassungen erforderlich sind. Deren Evaluierung kann ebenfalls im Rahmen der MMK erfolgen.
5. Nimmt die Führungskraft an der MMK konzentriert und aktiv teil oder lässt sie sich durch nicht dringliche Telefonate ablenken, kommt zu spät und geht vor dem Ende?
Die Mitarbeitenden können am Verhalten der Führungskraft erkennen, welche Bedeutung die MMK für ihre Führungskraft und in ihrer Abteilung hat. Die Führungskraft ist Vorbild. Ihr Verhalten ahmen die Mitarbeitenden nach. Mitarbeitende kommen ebenfalls zu spät und/oder gehen eher, telefonieren o. ä. Aufgrund dieser Störungen ist ein konstruktiver Dialog nicht möglich. Im Ergebnis finden MMKs zwar der Form halber statt, können aber nicht zu einer Verbesserung der Behandlungsqualität beitragen.
6. Wie ist mit Fehlern der Mitarbeitenden umzugehen?
Bei der Bewertung des medizinischen Vorgehens und der Organisation der Behandlung können Fehler des Einzelnen erkannt werden. Wie die Führungskraft damit umgeht, wird von den Mitarbeitenden genauestens registriert. Hier kann die Führungskraft durch ihr Verhalten die Sicherheitskultur in der Abteilung aktiv beeinflussen. Die Mitarbeitenden erfahren, ob es bei einem Fehler zu einer Bloßstellung oder harten, verbalen Formulierungen kommt, und ziehen daraus ihre Schlüsse. Im schlimmsten Fall lernen die Teilnehmenden, Fehler zu verschweigen, wenn sie passieren. Das Lernen aus Fehlern wird damit deutlich eingeschränkt. Auch die gegenteilige Reaktion der Führungskraft ist für eine Sicherheitskultur im Sinne der Patientensicherheit nicht sinnvoll. Scheint der Führungskraft der gemachte Fehler bedeutungslos, nehmen die Teilnehmenden mit, dass das eigene Handeln keine Konsequenzen hat. Die Führungskraft prägt den Umgang mit Fehlern in ihrer Organisationseinheit und die Teilnehmenden lernen daraus.
7. Findet ein interdisziplinärer Austausch statt?
Für die Patientensicherheit ist die reibungslose interdisziplinäre Zusammenarbeit von großer und oftmals entscheidender Bedeutung. Daher sollten MMKs immer interdisziplinär durchgeführt werden. Innerhalb einer Abteilung ist die Anwesenheit der ärztlichen und pflegerischen Berufsgruppen sinnvoll. In ausgewählten Fällen sollten die in die Behandlung involvierten Berufsgruppen ebenfalls einbezogen werden. Eine Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz ist ein Instrument des individuellen und organisationalen Lernens. Eine Organisationseinheit kann dann lernen, wenn alle an ihr beteiligten Berufsgruppen vertreten sind. Die Mitarbeitenden erkennen am Miteinander der Führungskräfte, wie die Kommunikation und der Grad der Kooperation zwischen den Abteilungen gestaltet ist. Im besten Fall sind diese so konstruktiv, dass ein niedrigschwelliges Hinzuziehen konfliktfrei erfolgt.
Tipps zur Gestaltung von Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen im Klinikalltag
In Zeiten von Personal- und Fachkräftemangel, Krankenhausreformplänen und desolater wirtschaftlicher Lage vieler Kliniken scheint die Durchführung von Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen nebensächlich zu sein. Hinzu kommt, dass die vorhandenen Leitfäden zwar sehr gut den Ablauf und die Methodik beschreiben, deren Übertragung in die Praxis in Anbetracht der fehlenden personellen, zeitlichen und wirtschaftlichen Ressourcen allerdings visionär und nur wenig realistisch klingt. Auf deren Durchführung zu verzichten, wäre jedoch gleichbedeutend mit einem Verzicht auf individuelles und organisationales Lernen, Förderung der Patientensicherheit und letztendlich der Mitarbeiterführung. Ist eine Abteilung wegen fehlender Ressourcen gezwungen, MMKs möglichst zeit- und kostensparend umzusetzen, braucht es eine praktikable und systematische Vorgehensweise. Diese könnte wie folgt gestaltet sein:
Vorbereitung
Innerhalb der Abteilung sind Kriterien festgelegt, welche Fälle für eine MMK infrage kommen. Ob ein Fall den Kriterien entspricht, kann in den Frühbesprechungen diskutiert werden. Innerhalb eines definierten Zeitraums, zum Beispiel drei Monate, werden die Fallnummern im Sekretariat gesammelt. Der Chefarzt und/oder leitender Oberarzt wählen in Vorbereitung einer MMK drei Fälle aus. Diese werden von verschiedenen Mitarbeitenden inhaltlich aufbereitet. Zur Vereinfachung wird ein Foliensatz zur Verfügung gestellt, in den der Behandlungsverlauf eingesetzt wird. Dieser orientiert sich an einem der verfügbaren Leitfäden. Der Teilnehmerkreis wird mit Nennung von Zeitpunkt und Ort eingeladen.
Durchführung
Es wird eine Teilnahmeliste geführt. Darauf ist auch der Hinweis auf die Vertraulichkeit der MMK enthalten. Zwingend sollte ein Moderator bestimmt werden, der nicht am Behandlungsverlauf beteiligt gewesen und nicht die Führungskraft selbst ist. Der Schwerpunkt der MMK ist die konstruktive Diskussion – im Sinne einer Ursachenforschung. Die unterschiedlichen beruflichen Perspektiven auf das Geschehen sollten erläutert werden.
Nachbearbeitung
Falls Maßnahmen abgeleitet werden, sind diese in einem Ergebnisprotokoll festzuhalten. Das kann bereits während der MMK am PC in einer Vorlage erfolgen. Nach Abschluss der MMK wird das Ergebnisprotokoll an die Abteilungsleitung zur Freigabe geschickt. Die Abteilung für Qualitäts- und Risikomanagement erhält eine Kopie zur Veröffentlichung im Intranet und Maßnahmennachverfolgung.
Literatur
[1] Qualitätsmanagement-Richtlinie. Richtlinie über grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren, Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte sowie zugelassene Krankenhäuser – QM-RL
[2] https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2309/QM-RL_2020-09-17_iK-2020-12-09.pdf, zuletzt eingesehen am 16.06.2023.
[3] KHaSiMiR 21 – Krankenhausstudie zur Sicherheit durch Management innerklini-scher Risiken 2021-22, Download Bericht 1: Ergebnisse der Befragung zur Implementierung des klinischen Risikomanagements
[4] Download Bericht 2: Vergleich der Befragungsergebnisse zwischen 2010, 2015 UND 2022
[5] https://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2023/01/KHaSiMiR_ Abschlussbe-richt_Teil-II.pdf, zuletzt eingesehen am 16.06.2023.
[6] Schrappe, M. (2018). APS-Weißbuch Patientensicherheit. Sicherheit in der Gesundheitsversorgung: neu denken, gezielt verbessern. Hrsg. vom Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Gefördert durch den Verband der Ersatzkassen (vdek). Mit Geleitworten von Jens Spahn, Donald M. Berwick und Mike Durkin (1st ed.). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
[7] St. Pierre, M. & Hofinger, G. (2014). Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin (3. Auflage). Springer: Berlin/Heidelberg
1 Aktuelle Ergebnisse der „KHaSiMiR 21 – Krankenhausstudie zur Sicherheit durch Management innerklinischer Risiken 2021-22“ zeigen, dass der Anteil von Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen in Allgemeinkrankhäusern von 2015 auf 2022 zugenommen hat, von etwa 85 Prozent auf ca. 93 Prozent.
Triphaus V: Safety Clip: Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen zur Förderung der Sicherheitskultur – Auf das „Doing“ kommt es an. Passion Chirurgie. 2023 Oktober; 13(10): Artikel 04_02.