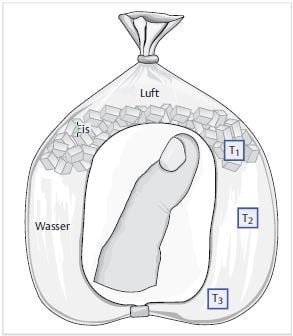Neues Buch beleuchtet Patientensicherheit aus vielen Perspektiven – Ein Lehr- und Praxiswerk für Praktikerinnen und Praktiker in Kliniken
Das Buch Patientensicherheitsmanagement, erschien am 20. Dezember 2021 in der zweiten Auflage im Verlag De Gruyter, bietet einen umfassenden Überblick zu Forschungsergebnissen, Handlungsfeldern und Präventionsmaßnahmen für Klinik und Praxis. Die mehr als 100 Autorinnen und Autoren blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Patientensicherheit – die klinische Sichtweise wird ergänzt um die Wahrnehmung aus psychologischer, betriebswirtschaftlicher, IT-technischer und juristischer Sicht sowie um die versicherungswirtschaftliche Komponente.
In dem umfassenden Werk stellen die Expertinnen und Experten mit Begeisterung und Engagement die Bedeutung, Entwicklungen, aktuelle Einflüsse und erforderliche Maßnahmen rund um das Thema Patientensicherheit dar. Das Buch ist wie die erste Auflage aus dem Jahr 2015 eine ernstzunehmende Literatur, insbesondere für den deutschsprachigen Raum. Es hat absolute Praxisrelevanz und ist eine tatsächliche Wissenslektüre, in der es sich lohnt nachzuschlagen.
„Das Buch wendet sich an die Praktikerinnen und Praktiker in den Kliniken, aber auch im ambulanten Sektor. Es ist gedacht für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende, nicht zuletzt aber auch für Qualitäts- und Risikomanagement, Vorstände und Geschäftsführungen und für die Versicherungswirtschaft“, erläutert Dr. Peter Gausmann in einer Pressemitteilung zur Buchvorstellung. Er ist Geschäftsführer der zur Ecclesia Gruppe gehörenden GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung und einer der Herausgeber des Buches.
Im Folgenden werden einige ausgewählte Kapitel vorgestellt, die insbesondere für den Fachbereich Chirurgie von Bedeutung sind, in dieser Disziplin Anwendung finden und Anregungen für den Alltag geben sollen.
„Kommunikation und Teambildung“
In dem fünften Kapitel geht es um Kommunikation und Teambildung. Die Autorin Dr. Christina Sick und die Autoren Paul Sindermann und Prof. Dr. Dr. Michael Henninger erklären unter 5.1, dass die Kommunikation als ein anerkannter Faktor für medizinische Qualität und Patientensicherheit gewertet wird (Nelson et al. 2010). Einerseits verbessert Kommunikation die Teamfunktionalität (Davies 2005), andererseits kann sie auslösender Faktor von Teamkonflikten sein und sich negativ auf die Patientensicherheit auswirken (Azoulay et al. 2009; Li, Stelfox und Ghali 2011; Okuyama et al. 2014).
Neben den Kommunikationsfähigkeiten der Gesprächsakteure sind Faktoren wie Status, Geschlecht und vorherrschende Arbeitskultur für das Gelingen der Kommunikation verantwortlich (Childress 2015). Wer im Gesundheitswesen arbeitet, hat sofort ein positives oder negatives Kommunikations-Beispiel im Kopf: Morgenbesprechungen, Übergaben, Visiten, Patientenvorstellungen oder Team-Time-Out. Entsprechend wichtig sind Kenntnisse über eine gelingende Kommunikation, um zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse im Kontext von Patientensicherheit positiv beeinflussen zu können. Jedoch besitzen die wenigsten Akteurinnen und Akteure im Krankenhaus diese wichtigen Erkenntnisse, da weder im Medizinstudium noch in der Pflegeausbildung ein Schwerpunkt auf die Kommunikation gelegt wird.
Das Kapitel befasst sich auch mit dem Missverständnis und seiner Entstehung, beispielsweise dann, wenn Informationen verschwiegen, verfälscht oder unvollständig übermittelt werden oder wenn sich Gesprächsteilnehmende verhören oder versprechen. Diese Faktoren können als Defizite menschlicher Kommunikation bezeichnet werden.
Ein weiteres Thema sind die Kennzeichen, die beschreiben, wie Kommunikation in der Medizin gelingen kann. Empfohlen wird, in Stresssituationen durch den Einsatz von Regeln – zum Beispiel mit Hilfe von Checklisten – festzulegen, wie wer wann mit wem redet. Die Handlungsanweisungen sollen den Prozess der Informationsübertragung eindeutig machen und helfen, Verständnisprobleme zu verringern (Hofinger 2012). Hingewiesen wird auf die standardisierten Kommunikationsmethoden SBAR (Institute for Healthcare Improvement) und StOP?-Protokoll zur strukturierten Kommunikation im Operationssaal (Haller und Becker 2018).
„Sicherheitskultur in der Chirurgie“
Anschaulich beschreibt Prof. Albrecht Stier, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios Klinikum in Erfurt, in Kapitel 6.9 die Einführung von Checklisten, Standard Operating Procedures (SOP), Mortalitäts- und Morbiditäts-Konferenzen und Erfassungssysteme kritischer Ereignisse (CIRS). Diese tragen zu mehr Sicherheit in der Chirurgie bei.
An vielen Praxisbeispielen wird der Nutzen für die Patientensicherheit hervorgehoben. Die Analyse der wöchentlich durchgeführten M & M-Konferenzen zeigt einen hohen Prozentsatz an Kommunikationsfehlern auf. Ebenso wird auf die Gefahr des Individualfehlers, am Beispiel der Seitenverwechslung, und auf die Notwendigkeit der permanenten Aufmerksamkeit hingewiesen. Um eine Durchdringung der Sicherheitskultur zu erhalten, ist die Akzeptanz dieser Maßnahmen beim Pflegepersonal und bei den Ärztinnen und Ärzten notwendig.
Als einer der Kernprozesse ist die prästationär durchgeführte OP-Vorbereitung aufgeführt. Nach Anamnese und Befundsichtung werden anhand einer Checkliste ausstehende Untersuchungen sowie Konsile individuell ergänzt (Pucher 2015). Am Beispiel der gemeinsam von Chirurginnen und Chirurgen sowie Anästhesistinnen und Anästhesisten auszufüllenden „Checkliste Prä OP“ wird plakativ dargestellt, wie wichtig das gemeinsame Handeln für die Patientensicherheit ist und wie viel Nutzen die Einhaltung für die Patientin oder den Patienten bringt. In dem Beispiel wird dies als erste „red flag“ bezeichnet. Es wird das individuelle Risiko der Patientin oder des Patienten und die Schwere des Eingriffs auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Eine Gesamtpunktzahl von kleiner gleich 6 führt zu einer OP-Freigabe.
„Erfolgreiche Implementierung von Checklisten“
Das Autorenteam (Prof. Dr. med. Claus-Dieter Heidecke, Janina Dubberke, PD Dr. med. habil. Alexandra Busemann und PD Dr. med. Katharina Beyer) stellt in seiner Zusammenfassung des Kapitels 7.11 fest: „Checklisten – sei es im OP, in der Geburtshilfe, der Endoskopie oder dem Bereich der Kardiologie – erhöhen nachweislich die Patientensicherheit. Sie senken die Komplikationsrate, die Morbidität und die Mortalität, indem sie die Teaminteraktion und die Kommunikation verbessern“.
Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung von Sicherheitschecklisten wird eine hohe Compliance bei den Mitarbeitenden und insbesondere bei der Führungsebene als notwendig erachtet, und damit die innerliche Bereitschaft solche Sicherheitssysteme für sich anzuwenden, und seine Verhaltensweisen zu ändern. Beschrieben werden folgende Checklisten zur Risikominimierung vermeidbarer unerwünschter Ereignisse: Perioperative Checklisten und Periinterventionelle Checklisten.
Insbesondere die Perioperative Checkliste ist aus den Operationssälen fast nicht mehr wegzudenken. Im Sinne der Multibarrieren-Strategie erfasst die „klassische“ Perioperative Checkliste die drei Phasen: 1. vor Anästhesie-Einleitung, in der Regel bei dem Einschleusungsprozess in den OP, 2. vor OP-Beginn („Schnitt“), im Rahmen des (Team)-Time-Out und 3. vor Verlassen des Operationssaals, das Sign-Out.
Fehlt bei den Mitarbeitenden die Compliance oder die Weitsicht, warum die Perioperative Checkliste zur Patientensicherheit beiträgt, kommt es zu Handlungsfehlern. Den Risikoberaterinnen und Risikoberatern der GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH ist bei einigen Patientensicherheits- und Risikoaudits aufgefallen, dass die Perioperative Checklisten vor der OP nicht komplett oder nur lückenhaft ausgefüllt waren. Die Befunde bestätigten dies, da diese weder in der Patientenakte noch im Elektronischen System vorlagen. Daher müssen alle beteiligten Mitarbeitenden über die Sinnhaftigkeit der Checkliste informiert und für die Nutzung motiviert werden. Dies kann durch eine regelmäßige Sensibilisierung über Fortbildungen und Trainingsveranstaltungen erfolgen.
Die Periinterventionelle Checkliste ist die logische Weiterentwicklung für andere komplexe Bereiche in der Medizin wie zum Beispiel die interventionelle Endoskopie, die Geburtshilfe oder das Herzkatheterlabor (HKL). In diesen Bereichen bestehen ähnliche Risikokonstellationen. Der positive Effekt auf die Patientensicherheit durch den Gebrauch von Checklisten in der Endoskopie konnte in einer schwedischen Untersuchung bestätigt werden (Dubois, Schmidt, Creutzfeld und Bergenmar 2017).
In dem Kapitel wird in weiteren Hinweisen und Beispielen erläutert, dass die Sicherheitskultur als Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung von Checklisten ist. Aber auch das Design von Checklisten trägt ebenfalls zur Akzeptanz und Nutzung bei.
„Neue Herausforderungen im Gesundheitswesen“
Mit dem Thema Sprachbarrieren im Gesundheitswesen und insbesondere im Krankenhaus beschäftigen sich Maria Kletečka-Pulker und Sabine Parrag im Kapitel 9.2. Es gibt keine Medizinerin und keinen Mediziner sowie keine Pflegekraft, die nicht schon einmal vor dieser Problematik standen. Das Arzt-Patienten-Verhältnis wird zunehmend positiv durch den Einsatz telematischer Anwendungen geprägt. Informations- und Kommunikationstechnologien flankieren die moderne Medizin (Katzenmeier und Schrag-Slavu 2010). Beschleunigt wird diese Entwicklung seit der COVID-19-Pandemie und dem Bestreben, persönliche Kontakte bestmöglich zu reduzieren.
Zwei Ziele, die konträr erscheinen, werden zugleich mit telematischer Anwendung erreicht: eine zeitnahe und qualifizierte Patientenbehandlung bei gleichzeitiger Schonung von Ressourcen ist durch den Einsatz von professionellen Dolmetscherinnen und Dolmetschern per Video möglich. Es werden Kosten gespart und gleichzeitig wird die Qualität der Patientenversorgung erhöht. Dies zu evaluieren war das Ziel des Pilotprojektes „Videodolmetschen im Gesundheitswesen“. Die diversen herausfordernden Aspekte werden im Buchkapitel 9.2 beschrieben. Insbesondere erwähnen die Autorinnen auch die rechtlichen Aspekte: zum Beispiel die Entbindung von der Schweigepflicht, die Qualifikation der Dolmetscherin oder des Dolmetschers sowie die haftungsrechtlichen Folgen bei Fehlübersetzungen. Hinzu kommen spezielle Fragen in den Bereichen Gesundheitstelematik und Datenschutz, da die Übersetzenden nicht vor Ort sind.
Fazit
„Alles in Allem sind wir auf gutem Wege, gleichwohl aber keinesfalls am Ziel“ – so endet das Vorwort der ersten Auflage des Buches Patienten-Sicherheits-Management und so beginnt das Vorwort der zweiten Auflage. Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen können dies wohl bestätigen. Es gibt immer wieder neue Ansätze, um die Patientensicherheit zu verbessern.
Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via [email protected].
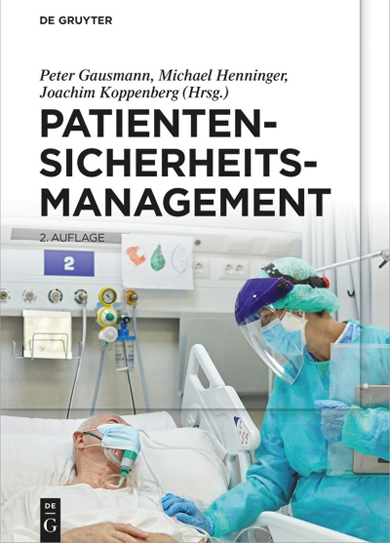
Patientensicherheitsmanagement
Hrsg.: Peter Gausmann,
Michael Henninger und
Joachim Koppenberg
2., überarbeitete und
ergänzte Auflage
750 Seiten
Verlag de Gruyter Berlin
ISBN: 9783110706406
Kraft S, Fleischer M: Safety Clip: „Fokus Chirurgie“ – Praxisrelevante Erkenntnisse aus dem Buch Patientensicherheitsmanagement. Passion Chirurgie. 2022 Oktober; 12(10): Artikel 04_04.













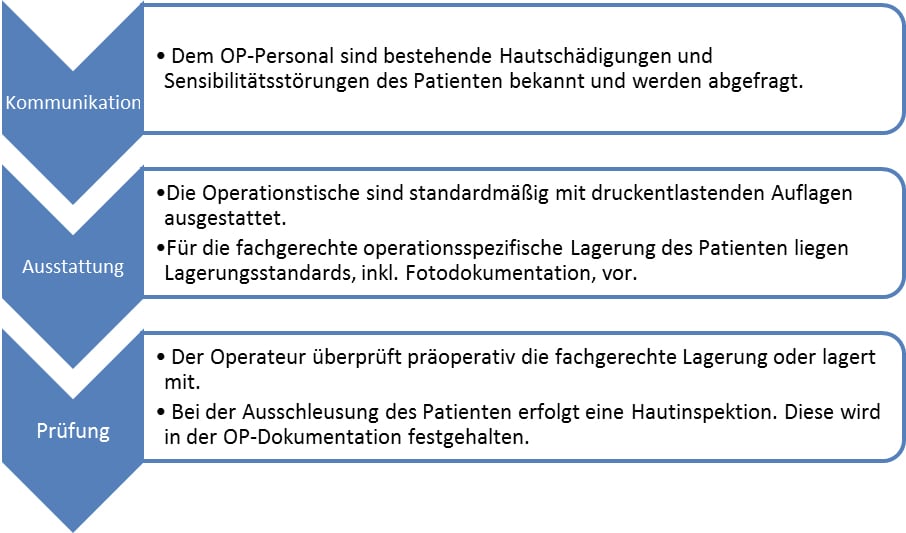

 Kraft S. Safety Clip: Lernen aus Fehlern und Schadenereignissen. Passion Chirurgie. 2017 Dezember, 7(12): Artikel 04_02.
Kraft S. Safety Clip: Lernen aus Fehlern und Schadenereignissen. Passion Chirurgie. 2017 Dezember, 7(12): Artikel 04_02.