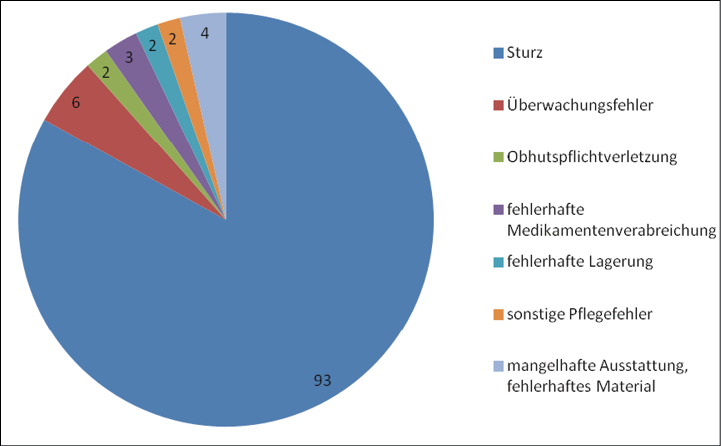Ob Belästigungen am Arbeitsplatz, sexuelle Übergriffe im Freibad, Hassparolen in sozialen Medien oder Gewalt unter Jugendlichen in Schulen – es vergeht kaum ein Tag ohne entsprechende Berichterstattungen. Allgemeiner Tenor ist, dass Menschen im gesellschaftlichen Miteinander zunehmend aggressiv reagieren und die Hemmschwelle für Gewalt gesunken ist.
Diese Entwicklung macht auch vor der Institution Krankenhaus nicht halt. In einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) gaben 73 Prozent der Krankenhäuser an, dass die Zahl der Übergriffe in ihren Häusern in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist [1].
Die Hälfte der Kliniken benennt in der Umfrage die Notaufnahme als einen besonders durch Gewalt belasteten Bereich. Die genannten Hauptursachen sind: zustandsbedingte Übergriffe durch zum Beispiel Alkohol oder Schmerz, der Verlust von Respekt gegenüber Krankenhauspersonal, krankheitsbedingtes Verhalten (wie Demenz oder psychische Erkrankungen) und lange Wartezeiten. In einer deutschlandweiten Befragung von Mitarbeitenden in deutschen Notaufnahmen zu Gewalterlebnissen gaben 97 Prozent der Befragten an, in den letzten 12 Monaten verbale Gewalt durch Patienten erlebt zu haben, 88 Prozent sogar körperliche Gewalt. In Bezug auf Negativerfahrungen mit Angehörigen berichteten 94 Prozent über verbale und rund 65 Prozent über körperliche Gewalt [2].
Die Problemstellung ist somit für Krankenhäuser nicht neu und vielerorts sind in den vergangenen Jahren erste Maßnahmen umgesetzt worden. Die Berufsgenossenschaft, Verbände und große Kliniken haben hierzu Handlungsempfehlungen veröffentlicht, die in Aufbau und Inhalt im Wesentlichen deckungsgleich sind (vgl. die weiterführende Literatur am Ende des Artikels). Ziel dieses Artikels ist, diese Empfehlungen noch einmal in komprimierter Form für die Rubrik „Safety Clip“ aufzubereiten und um eigene Aspekte zu ergänzen. Hierbei fokussiert sich der Beitrag auf Maßnahmen zur Gewaltprävention, die konkret und speziell für die Notaufnahme von Bedeutung sind, sowie auf Maßnahmen, die zentral für das Krankenhaus oder die Klinikgruppe auf übergeordneter Ebene getroffen werden sollten.
Strategische Planung und operative Führung
Im Zusammenhang mit der Fürsorgepflicht ist es Aufgabe der Krankenhausführung, für die Sicherheit der Mitarbeitenden und Patienten zu sorgen. Hierfür müssen die Rahmenbedingungen geprüft und der Handlungsrahmen für die Prävention, Intervention und Nachsorge in Bezug auf Gewalt festgelegt werden.
Grundvoraussetzungen für eine Strategie, die wirkungsvoll und nachhaltig umgesetzt werden kann, ist das klare Bekenntnis zu einer Null-Toleranz gegenüber Gewalt und die Schaffung einer Kultur, in der Achtsamkeit und Sensibilität in Bezug auf Gewaltereignisse bestehen sowie ein offener Umgang möglich ist. Nur wenn von Gewalt betroffene Mitarbeitende ohne Schamgefühle über ihre Ängste und ihr Befinden berichten können, ist eine adäquate Unterstützung möglich. Diese Strategie muss nachfolgend operationalisiert und in einem Konzept verankert werden. Hierbei sollten folgende Aspekte berücksichtigt und auf interne Umsetzung geprüft werden:
- Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen
Diese sind nicht nur Pflicht (§ 5 ArbSchG), sondern auch ein geeignetes internes Instrument zur Identifikation von Gefahren an unterschiedlichen Arbeitsplätzen und bei spezifischen Tätigkeiten. Da die Gefährdungsbeurteilungen nach dem Deming-Kreis (PDCA-Zyklus) durchgeführt werden, kann hiermit auch die Umsetzung und Wirksamkeit von Maßnahmen geprüft werden. - Darstellung des rechtlichen Rahmens
– Schutz der Mitarbeitenden (Notwehr § 32 StGB und Rechtfertigender Notstand § 34 StGB)
– Bestrafung für Gewalt oder Gewaltandrohung gegen Hilfeleistende einer Notaufnahme (§ 115 StGB) Hinweis: Aktuell gibt es den Vorstoß durch Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für eine härtere Strafbemessung bei Gewalt gegen Klinikpersonal [3]. Die DKG fordert hierfür eine Gleichstellung mit Rettungskräften. [4] - Übertragung des Hausrechts auf Mitarbeitende
- Stellen von Strafanzeigen nach Gewaltereignissen
- Etablierung eines Meldesystems zur internen Erfassung von Vorfällen
- Erstellung von Notfallplänen, in denen die Abläufe bei Eskalation vorgeplant sind. Hierbei ist zu beachten, dass keine Parallelstrukturen aufgebaut werden (Alarm- und Einsatzplan und/oder „Krisenhandbuch“).
- Entwicklung eines Betreuungs- und Nachsorgekonzepts für Opfer von Gewalt mit vorgeplanten Nachsorgeangeboten und externen Unterstützungsmöglichkeiten
– Krisenintervention durch psychologische Unterstützung (kurzfristig, kurzzeitig)
– Begleitung bei posttraumatischen Belastungen (längerfristig)
– Teamsupervision
– Bezugnahme auf Betriebliches Eingliederungsmanagement - Berücksichtigung der Anforderungen, Leistungen und Angebote der Berufsgenossenschaft (Verbandbuch, D-Arzt-Verfahren, Meldung Arbeitsunfälle, Rehabilitation/Wiedereingliederung)
Organisatorische Präventionsmaßnahmen
Eine suffiziente Patientenversorgung mit erträglichen Wartezeiten, eine respektvolle Behandlung mit verständlicher und direkter Kommunikation sowie eine gute Organisation und Betreuung tragen maßgeblich zur Zufriedenheit der Patienten bei. Um diesen Erwartungen gerecht werden zu können, braucht es einen bedarfsorientierten Personaleinsatz.
Auslöser für ein aggressives Verhalten seitens des Patienten kann Unzufriedenheit mit der Behandlung sein. Bei dem allgemeinen Personalmangel und bestehenden Liquiditätsengpässen darf dies nicht vergessen werden.
Eine Pflegeperson allein in der Notaufnahme, wie es im Nachtdienst kleinerer Krankenhäuser vorkommt, ist in Hinblick auf den Umgang mit herausfordernden Patienten besonders bedenklich, da keine unmittelbare Unterstützung durch das Team möglich ist und der Mitarbeitende sich nicht ohne weiteres aus der Situation herausziehen kann. Die Möglichkeit einer niederschwelligen Unterstützung einer weiteren Person ist hier besonders wichtig, im Szenario des Nachtdiensts im kleinen Krankenhaus jedoch per se organisatorisch herausfordernd.
Bei der Dienstplanung sollte darauf geachtet werden, dass mindestens jeder Dienst mit einem gut geschulten und hinsichtlich Gewaltprävention erfahrenen Mitarbeitenden besetzt ist.
Eine entsprechende Frequentierung der Notaufnahme vorausgesetzt, kann der Einsatz eines Sicherheitsdiensts geprüft werden. Hierbei ist auf gut geschultes Personal mit zurückhaltendem und deeskalierendem Auftreten zu achten. Damit im Ernstfall auch ohne lange Erklärungen die Unterstützung der Polizei angefordert werden kann, sollten klare Absprachen getroffen und ggf. auch eine Regelkommunikation vereinbart werden. Auch in somatisch ausgerichteten Notaufnahmen kommt eine Erstbehandlung von psychiatrischen Patienten durchaus vor. Unabhängig vom Versorgungsspektrum des Krankenhauses sollten in jeder Notaufnahme Grundkenntnisse zu den häufigsten psychiatrischen Krankheitsbildern vorhanden sein. Die (abgelaufene, aber in Überarbeitung befindliche) S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie gibt einen guten Überblick zu Symptomen und Therapie. [5]
Bauliche und technische Präventionsmaßnahmen
Neben den allgemeinen Empfehlungen zur Gestaltung von Krankenhäusern, die für eine ruhige und angenehme Atmosphäre sorgen sollen (Tageslicht, Beleuchtung, lärmreduzierende Materialien) und den Zugang vereinfachen (Beschilderung, Barrierefreiheit), sind in der Notaufnahme eine Reihe weiterer baulich-räumlicher und technischer Aspekte von Bedeutung.
Viele Notaufnahmen sind regelmäßig durch Overcrowding (Überfüllung) und Exit Block (Abflussblockade) belastet. Beide Phänomene können im Normalfall nicht durch die Notaufnahme beeinflusst werden. Ein Hebel kann jedoch eine bessere Steuerung der Patientenströme innerhalb der Notaufnahme sein. Weniger Patienten geballt auf einem Fleck führen zu mehr Übersicht und einem ruhigeren Umfeld. Empfehlungen sind:
- Getrennte Wartebereiche für liegende und sitzende Patienten
- Auslagerung von ambulanten Patientenversorgungen (Nachsorgeambulanz, Zweitmeinungsverfahren)
- Auslagerung von Patienten, die fertig behandelt sind (und noch auf Entlassbrief oder Abholung warten), in einen separaten Wartebereich
Um den Überblick darüber zu behalten, wer sich in welchem Bereich der Notaufnahme aufhält, ist es sinnvoll, den Zugang zu kontrollieren und steuern.
- Für eine größtmögliche Flexibilität ist ein elektronisches Zutrittskontrollsystem sinnvoll. Hiermit lassen sich der Zutritt tageszeitabhängig steuern, auf berechtigte Personen beschränken und/oder Türen bei Bedarf öffnen (mit Gegensprechanlage), was insbesondere bei Nebeneingängen sinnvoll ist (zum Beispiel Infektionseingang).
- Die Anzahl an Zugängen „von vorne“ und „nach hinten“ sollte sich an dem Weg des Patienten orientieren und möglichst gering gehalten werden.
- Hierbei kann auch der Aspekt des unkontrollierten Zugangs aus der Notaufnahme in das Krankenhaus hinein berücksichtigt werden.
Die Empfehlung eines „kontrollierten Zugangs“ bezieht sich aber nicht nur auf die Notaufnahme insgesamt, sondern auch auf die Räumlichkeiten innerhalb des Bereichs. Anmeldebereich, Dienstzimmer und andere Räume, die nicht der Patientenversorgung dienen, sollten nicht nur optisch getrennt, sondern für Dritte nicht zugänglich sein. Mindestens ein zentral gelegener Raum sollte zudem als gesicherter Schutz- und Zufluchtsraum deklariert und ausgestattet sein: ein Raum mit stabiler Tür inkl. Türspion und der Möglichkeit, Hilfe herbeizurufen.
Für die Hinzuziehung von Hilfe bestehen unterschiedliche technische Möglichkeiten, die auch abhängig von der Ausstattung des Krankenhauses sind. Grundsätzlich gilt, je näher „am Mann“ und je niederschwelliger ein Alarm abgegeben werden kann, desto besser. Empfehlungen sind:
- mobile Telefone mit integriertem Personenalarm
- separate Notfallknöpfe als Wandschalter
- direkte Alarmschaltung zur Polizei
- Patientenrufanlage („Schwesternruf“)
- Gruppenruf über die Telefonanlage
- Telefonat
In vielen Krankenhäusern sind mittlerweile Videokameras installiert, um Zugänge, Flure und Wartebereiche besser im Blick zu haben. Vor dem Einsatz einer Videokamera muss festgelegt werden, welches Ziel hiermit verfolgt wird, nicht zuletzt aufgrund der DSGVO in Hinblick auf die Datenerfassung immer das mildeste Mittel zu wählen. Für einen Nebeneingang, der nur auf Klingeln geöffnet wird, dürfte eine Videoüberwachung reichen.
Vor der Installation muss der Einsatz hierbei aus zwei Perspektiven geprüft werden:
- Reicht eine Videoüberwachung (im Sinne einer Bildübertragung) aus oder bedarf es einer Videoaufzeichnung? Die DSGVO fordert in Hinblick auf die Datenerfassung immer das mildeste Mittel zu wählen (Verhältnismäßigkeit). In vielen Fällen (zum Beispiel Nebentür, an der geklingelt werden muss) reicht eine einfache Bildübertragung aus.
- Ist die Kamera nur für den Bedarfsfall installiert (Beispiel Nebentür) oder ersetzt sie die Augen des Personals? Eine Kamera im Wartebereich ist nur zielführend, wenn jemand am Monitor sitzt und regelmäßig das Bild prüft. Andernfalls entsteht eine Scheinsicherheit.
Personenbezogene Präventionsmaßnahmen
Ein inzwischen verbreitetes Instrument zur Qualifikation und Stärkung der Mitarbeitenden stellen Deeskalationstrainings dar. Unter dem Begriff sind eine Vielzahl unterschiedlicher Formate und Inhalte am Markt verfügbar, die sowohl von externen Anbietern als auch von Landesärztekammern oder der Berufsgenossenschaft angeboten werden, auch zur Ausbildung interner Trainer. Zumeist sind die Trainings modular und zielgruppenorientiert aufgebaut und beinhalten Kommunikations- und Deeskalationstechniken, Körpersprache und theoretische Anteile wie zum Beispiel rechtliche Grundlagen. In weiterführenden Modulen wird häufig auch der Körpereinsatz trainiert, also das Abwehren, Lösen oder Halten von Patienten. Für eine hohe Durchdringung der Trainings im interprofessionellen Team sollten diese zudem als verpflichtend deklariert werden.
Bereits bei der Konzeption der Deeskalationstrainings ist zu berücksichtigen, dass die Ausbildungsinhalte regelmäßig wiederholt und eingeübt werden müssen, damit diese im Bedarfsfall abrufbar und routiniert angewendet werden können. Dies betrifft sowohl Simulationen mit Fokus auf die verbale Deeskalation als auch praktische Übungen zu den körperlichen Techniken und ggf. erlernten Eingriffstechniken.
Weitere Angebote zur Resilienzförderung (zum Beispiel emotionale Abgrenzung, Umgang mit Stress) runden die Deeskalationstrainings sinnvoll ab. Bei kontinuierlicher und fortwährender Belastung des Teams sind darüber hinaus Team-Supervisionen hilfreich.
Patientenperspektive und Fazit
Die hier vorgestellten Präventionsmaßnahmen sind als Maßnahmenbündel zu verstehen, das alle relevanten Perspektiven berücksichtigt. Sie zielen jedoch auf unterschiedliche Phasen der Konflikteskalation ab. Ein Wartebereich in sanften Blautönen kann in einer frühen Phase der Erregung beruhigend auf den Patienten wirken. Wenn ein Patient motorisch unruhig ist und lautstark Drohungen ausstößt, wird die Farbgebung allein wahrscheinlich nicht mehr für eine Entspannung der Situation sorgen können. Andersherum ist es nicht zielführend, Gewaltprävention erst ab den Themen „Sicherheitsdienst“ und „Schutzraum“ zu denken und andere Maßnahmen außen vor zu lassen.
Gewaltsituationen entstehen oft durch das Zusammenwirken unterschiedlicher sozialer und individueller Faktoren. Substanzmissbrauch und psychische Erkrankungen sind zwei individuelle Faktoren, die bereits in der Einleitung dieses Artikels als Ursache für Übergriffe genannt wurden. Wenn aufgrund formaler und inhaltlicher Denkstörungen kein geordnetes Gespräch mit dem Patienten möglich ist, ist auch eine verbale Deeskalation schwierig bis unmöglich.
Mehrheitlich ist glücklicherweise ein Gespräch mit den Patienten möglich. Aber auch hier gibt es typische Umstände, die als Auslöser zu einer Eskalation beitragen können. Es macht daher Sinn, sich noch einmal die Situation der Patienten zu vergegenwärtigen, die in der Notaufnahme vorstellig werden: Patienten kommen kurzfristig in die Notaufnahme, ohne sich auf die Situation einstellen zu können, sie kommen nach einem anstrengenden Tag oder mitten in der Nacht. Sie sind vielleicht plötzlich bewegungseingeschränkt oder haben starke Schmerzen, fühlen sich unwohl in der Krankenhausumgebung und ein Stück weit hilflos ausgeliefert. Sie kommen mit Sorge um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben.
Bei all den vorgestellten Maßnahmen darf somit eine Perspektive nicht außer Acht gelassen werden: die der Patienten und Begleitpersonen. Die Räumlichkeiten und Abläufe sollten daher immer auch aus diesem Blickwinkel betrachtet werden.
- Können sich Patienten gut in den Räumlichkeiten zurechtfinden?
- Sind unsere Informationen und Erläuterungen für Laien verständlich?
- Haben wir die unterschiedlich langen Wartezeiten durch die Triage-Farben gut erklärt?
- Können sich wartende Angehörige ausreichend beschäftigen und ablenken?
Literatur
[1] Deutsche Krankenhausgesellschaft (2024). Krankenhaus-Personal deutlich stärker von Gewalt betroffen. DKG zu Übergriffen auf Klinik-Beschäftigte (Pressemitteilung). https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaus-personal-deutlich-staerker-von-gewalt-betroffen/ (abgerufen am 16.07.2025).
[2] Schablon A, Kersten JF, Nienhaus A et al (2022). Risk of burnout among emergency department staff as a result of violence and aggression from patients and their relatives. https://doi.org/10.3390/ijerph19094945
[3] Geinitz, C (2025). „Diejenigen anzugreifen, die anderen helfen, ist absolut inakzeptabel“. Nina Warken. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.07.2025. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nina-warken-diejenigen-anzugreifen-die-anderen-helfen-ist-absolut-inakzeptabel-110588435.html (abgerufen am 16.07.2025)
[4] Deutsche Krankenhausgesellschaft (2025). Strafverschärfungen wären wichtiges Signal an die Betroffenen. DKG zum Vorstoß, Gewalt im Krankenhaus härter zu bestrafen (Pressemitteilung). https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/strafverschaerfungen-waeren-wichtiges-signal-an-die-betroffenen/ (abgerufen am 16.07.2025).
[5] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (2019). S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie, Version 1.0, 13.04.2019. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/038-023 (abgerufen am 16.07.2025).
Quellen & weiterführende Literatur
- BGW: https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/gesund-im-betrieb/umgang-mit-gewalt/kliniken-mindeststandard-fuer-die-gewaltpraevention-in-der-notaufnahme-106366
- DGUV: https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3429/praevention-von-gewalt-und-aggression-im-gesundheitsdienst-und-wohlfahrtspflege-eine-handlungshilfe
- KGNW: https://www.kgnw.de/klinik-welt/gewaltpraevention
- UKE: https://www.uke.de/dateien/institute/versorgungsforschung-in-der-dermatologie-und-bei-pflegeberufen-(ivdp)/cvcare/gina/neuer-ordner/broschu%CC%88re_pra%CC%88vention_notaufnahme_einzelseiten_2023.pdf

Michael Schrewe
Senior Berater
GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH
Ecclesiastraße 1 – 4
32758 Detmold
Schrewe M: Safety Clip: Gewaltprävention in Notaufnahmen. Passion Chirurgie. 2025 Oktober; 15(10): Artikel 04_02.