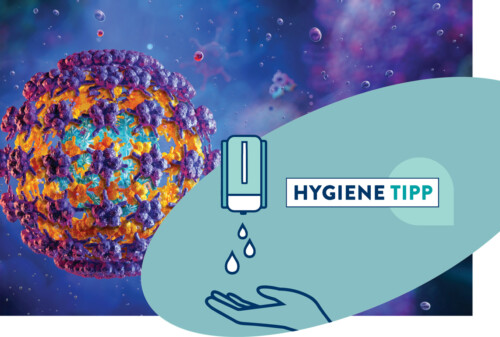Die Hygiene in der niedergelassenen Arztpraxis spielt eine wichtige Rolle im Rahmen der medizinischen Versorgung der Patienten. Diese werden immer früher nach einer Krankenhausbehandlung entlassen, was wiederum teilweise Tätigkeiten am Patienten, die bisher im Krankenhaus durchgeführt wurden, in die Arztpraxis verlagert.
Da die meisten Infektionskrankheiten wie Atemwegsinfektionen oder Magen-Darm-Entzündungen über Kontakt oder Tröpfchen übertragen werden, kann eine gewisse räumliche Distanz als hygienische Barriere die Vermeidung von Erregerübertragungen unterstützen. Gerade in Wartebereichen wird allerdings z. B. der nötige Abstand von etwa zwei Metern, welche eine Tröpfchenübertragung verhindern würde, oftmals unterschritten. Die Patienten berühren zudem in schneller Aufeinanderfolge die gleichen Oberflächen, sodass bei etwaiger Kontamination eine Erregerübertragung möglich ist.
Durch bestimmte hygienische Voraussetzungen und gezielte Gegenmaßnahmen können allerdings viele Infektionsgefahren für die Patienten minimiert werden.
Risikoeinschätzung von Räumlichkeiten
Die KRINKO sieht in Bezug auf häufig angefasste Oberflächen in Wartezimmern kein erhöhtes Infektionsrisiko im Vergleich zum allgemeinen Risiko in der Bevölkerung. Das heißt, dass das Infektionsrisiko nicht höher ist als in anderen Wartebereichen (z. B. bei Behörden). Auch hier hinterlassen Personen einige Mikroorganismen z. B. von ihrer Hautflora auf Oberflächen und diese werden anschließend von anderen Personen berührt.
Von entscheidender Bedeutung für die Wartebereiche in Arztpraxen und anderen med. Einrichtungen ist vielmehr, dass ein Kontakt zu kontaminierten Oberflächen oder Materialien bereits im Vorfeld organisatorisch minimiert wird. Dies betrifft u.a. die Etablierung geeigneter Desinfektionsroutinen bei sichtbaren Verschmutzungen sowie den Umgang mit Patienten mit akuten Infektionskrankheiten.
Die für Untersuchungs- und Behandlungsräume festgelegte Anforderung desinfektionsmittelbeständiger Oberflächen gilt nicht für Wartezimmer, sodass hier (formal gemäß TRBA 250) beispielsweise auch Teppichboden verlegt sein kann.
Oberflächen reinigen oder desinfizieren?
Von Seiten der KRINKO wird für Treppenhäuser, Flurbereiche und auch für Wartebereiche kein hygienischer Nutzen einer regelmäßigen und unspezifischen Flächendesinfektion gesehen. Die häufig angefassten Oberflächen wie Türklinken, Lichtschalter oder Armlehnen wären trotz regelmäßiger Flächendesinfektion ohnehin sehr schnell wieder kontaminiert – überwiegend mit „harmlosen“ Umgebungskeimen. Sinnvoll sind hingegen die regelmäßige Reinigung zur Beseitigung von Staub etc. sowie eine gezielte Desinfektion von Oberflächen, die z. B. mit Körperflüssigkeiten kontaminiert wurden. Es ist daher sinnvoll, wenn Mobiliar in Wartezimmern einer feuchten Reinigung/Wischdesinfektion unterzogen werden kann.
Eine tägliche Desinfektion des Bodens oder der höher gelegenen Oberflächen ist auch aufgrund der hohen Berührungsfrequenz der Oberflächen und des Fehlens körperlicher Untersuchungen oder invasiver Maßnahmen nicht sinnvoll.
 Patienten mit ansteckenden Infektionskrankheiten
Patienten mit ansteckenden Infektionskrankheiten
Um die Ansteckungsgefahren innerhalb von Wartebereichen gering zu halten, empfiehlt es sich, Patienten mit entsprechenden Erkrankungen (z. B. fiebrige Atemwegsinfekte oder akutem Brechdurchfall) erst gar nicht im Wartezimmer unterzubringen. Zumindest bei telefonischem Vorkontakt könnten durch Abfrage der entsprechenden Symptomatik gezielt ansteckende Patienten herausgefiltert und ggf. zum Ende der Sprechstunde eingeladen (Stichwort „Infektionssprechstunde“) oder direkt in einen Behandlungsraum gebracht werden. Die Kontaktzeiten zu anderen Patienten würden hierdurch verringert.
Weitere Maßnahmen
Zur Verringerung des Erregereintrags in die Arztpraxis und damit auch in das Wartezimmer empfiehlt sich die Positionierung eines Händedesinfektionsmittelspenders am Praxiseingang. Die richtige Durchführung wird durch einen ergänzenden Aushang, welche auf die Methodik der Benetzung und die nötige Einwirkzeit von 30 Sekunden eingeht, positiv beeinflusst.
Wasserspender in Wartezimmern müssen ebenfalls im Sinne der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung auf mikrobiologische Unbedenklichkeit geprüft werden.
Wenn Spielzeug für jüngere Patienten bereitgestellt wird, sollte dieses nach Möglichkeit desinfektionsmittelbeständig sein. Das Spielzeug sollte täglich auf sichtbare Verunreinigung geprüft und ggf. gezielt desinfiziert werden.
Hinsichtlich der Zeitschriften im Wartezimmer kann häufig beobachtet werden, dass die Finger beim Weiterblättern mit der Zunge befeuchtet werden. Dieses Verhalten wirkt sehr unhygienisch und ist zweifellos mit einer gewissen Übertragungsgefahr von Erregern verbunden. Die Gefahr ist hier aber nicht zwingend höher, als wenn dieses Verhalten beispielsweise bei einem Friseur an den Tag gelegt wird. Eine Notwendigkeit zur Abschaffung der Zeitschriften o. ä. ergibt sich hieraus nicht.
Der Kurztipp im Auftrag der DGKH gibt die Meinung der Autoren wieder.
Groth M, Hübner NO, Jatzwauk L, Kohnen W: Hygiene-Tipp: Hygiene in Wartezimmer und Wartebereichen. Passion Chirurgie. 2025 April; 15(04): Artikel 04_04.